Südtirol, Italien)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Surveys for Desmoulin's Whorl Snail Vertigo Moulinsiana on Cors Geirch
Surveys for Desmoulin’s Whorl Snail Vertigo moulinsiana on Cors Geirch NNR/SSSI and the Afon Penrhos floodplain & for Geyer’s Whorl Snail Vertigo geyeri on Cors Geirch NNR in 2017 Martin Willing NRW Evidence Report No. 258 D8 Figure1. Newly discovered Vertigo moulinsiana habitat at Afon Penrhos. NRW Evidence Report No. 258 About Natural Resources Wales Natural Resources Wales is the organisation responsible for the work carried out by the three former organisations, the Countryside Council for Wales, Environment Agency Wales and Forestry Commission Wales. It is also responsible for some functions previously undertaken by Welsh Government. Our purpose is to ensure that the natural resources of Wales are sustainably maintained, used and enhanced, now and in the future. We work for the communities of Wales to protect people and their homes as much as possible from environmental incidents like flooding and pollution. We provide opportunities for people to learn, use and benefit from Wales' natural resources. We work to support Wales' economy by enabling the sustainable use of natural resources to support jobs and enterprise. We help businesses and developers to understand and consider environmental limits when they make important decisions. We work to maintain and improve the quality of the environment for everyone and we work towards making the environment and our natural resources more resilient to climate change and other pressures. Evidence at Natural Resources Wales Natural Resources Wales is an evidence based organisation. We seek to ensure that our strategy, decisions, operations and advice to Welsh Government and others are underpinned by sound and quality-assured evidence. -

Zur Verbreitung Der Bauchigen Windelschnecke Vertigo Moulinsiana
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 2000 Band/Volume: 190_110 Autor(en)/Author(s): Mildner Paul Artikel/Article: Zur Verbreitung der Bauchigen Windelschnecke Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda,Stylommatophora, Vertiginidae) in Kärnten 172-180 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Carinthia II M 190/110- Jahrgang M Seiten 172-180 M Klagenfurt 2000 173 Zur Verbreitung der Bauchigen Windelschnecke Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda, Stylommato phora, Vertiginidae) in Kärnten Von Paul MILDNER EINLEITUNG Kurzfassung: Die Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana Die Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Dupuy, 1849) gilt als eine in Österreich sehr seltene Art (Gastropoda, Stylommatophora, (KLEMM, 1974). REISCHÜTZ (1997) berichtet von einem Le- Vertiginidae) bendfund am Innstausee unterhalb von Reichersberg (Ober- konnte innerhalb der letzten Jahre in österreich, 7/96) und bemerkt dazu: Sehr wahrscheinlich Kärnten an 32 Standorten lebend eines der letzten bekannten Lebendvorkommen der Art in nachgewiesen werden. Weitere Österreich. In Kärnten hingegen konnte Vertigo moulinsia- Meldungen dieser Art aus Öster- reich: Kärnten (Meynrad von GALLEN- na (Dupuy, 1849) in den letzten Jahren an 32 Standorten STEIN, 1848,1852; Hans von GALLEN- lebend nachgewiesen werden. STEIN, 1900; KLEMM, 1960; KUHNA & SCHNELL, 1965; KLEMM, 1974; FRANK & REISCHÜTZ, 1994; MILDNER, 1998). Bur- genland (KLEMM, 1960; KLEMM, 1974; FRANK & REISCHÜTZ, 1994). Oberöster- reich (REISCHÜTZ, 1997). Niederöster- reich (REISCHÜTZ, 1999). Im „Catalo- gus Faunae Austriae", Teil VII a, Mollusca, (KLEMM, 1960) ist weiters die Steiermark angegeben, aller- dings mit einem Fragezeichen. Summary: Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda, Stylommatophora, Ver- tiginidae) could be recorded from 32 habitats in Carinthia, Austria, within the last years. -

Liste Rouge Mollusques (Gastéropodes Et Bivalves)
2012 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces menacées en Suisse, état 2010 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces menacées en Suisse, état 2010 Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par le Centre suisse de cartographie de la faune CSCF Berne, 2012 Valeur juridique de cette publication Impressum Liste rouge de l’OFEV au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance Editeurs du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage Office fédéral de l’environnement (OFEV) (OPN; RS 451.1), www.admin.ch/ch/f/rs/45.html L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). La présente publication est une aide à l’exécution de l’OFEV en tant Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), Neuchâtel. qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées Auteurs provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application Mollusques terrestres: Jörg Rüetschi, Peter Müller et François Claude uniforme de la législation. Elle aide les autorités d’exécution Mollusques aquatiques: Pascal Stucki et Heinrich Vicentini notamment à évaluer si un biotope doit être considéré comme digne avec la collaboration de Simon Capt et Yves Gonseth (CSCF) de protection (art. 14, al. 3, let. d, OPN). Accompagnement à l’OFEV Francis Cordillot, division Espèces, écosystèmes, paysages Référence bibliographique Rüetschi J., Stucki P., Müller P., Vicentini H., Claude F. -

Langourov Et Al 2018 Inventory of Selected Groups.Pdf
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Zoogeography and Faunistics Acta zool. bulg., 70 (4), 2018: 487-500 Research Article Inventory of Selected Groups of Invertebrates in Sedge and Reedbeds not Associated with Open Waters in Bulgaria Mario Langourov1, Nikolay Simov1, Rostislav Bekchiev1, Dragan Chobanov2, Vera Antonova2 & Ivaylo Dedov2 1 National Museum of Natural History – Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 1 Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] 2 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Gagarin Street, 1113 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] Abstract: Inventory of selected groups of the invertebrate fauna in the EUNIS wetland habitat type D5 “Sedge and reedbeds normally without free-standing water” in Bulgaria was carried out. It included 47 locali- ties throughout the country. The surveyed invertebrate groups included slugs and snails (Gastropoda), dragonflies (Odonata), grasshoppers (Orthoptera), true bugs (Heteroptera), ants (Formicidae), butterflies (Lepidoptera) and some coleopterans (Staphylinidae: Pselaphinae). Data on the visited localities, identi- fied species and their conservation status are presented. In total, 316 species of 209 genera and 68 families were recorded. Fifty species were identified as potential indicator species for this wetland habitat type. The highest species richness (with more than 50 species) was observed in wetlands near Marino pole (Plovdiv District) and Karaisen (Veliko Tarnovo District). Key words: Gastropoda, Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Formicidae, Lepidoptera, Pselaphinae, wetland. Introduction According to the EUNIS Biodiversity Database, all known mire and spring complex according to the wetlands (mires, bogs and fens) are territories with occurrence of rare and threaten plant and mollusc water table at or above ground level for at least half species. -
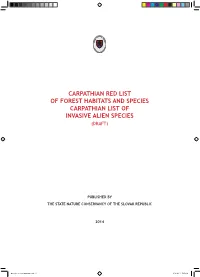
Draft Carpathian Red List of Forest Habitats
CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT) PUBLISHED BY THE STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 1 227.8.20147.8.2014 222:36:052:36:05 © Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014 Editor: Ján Kadlečík Available from: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Slovakia ISBN 978-80-89310-81-4 Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme Slovenská republika This publication was elaborated within BioREGIO Carpathians project supported by South East Europe Programme and was fi nanced by a Swiss-Slovak project supported by the Swiss Contribution to the enlarged European Union and Carpathian Wetlands Initiative. zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 2 115.9.20145.9.2014 223:10:123:10:12 Table of contents Draft Red Lists of Threatened Carpathian Habitats and Species and Carpathian List of Invasive Alien Species . 5 Draft Carpathian Red List of Forest Habitats . 20 Red List of Vascular Plants of the Carpathians . 44 Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca) . 106 Red List of Spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. 118 Draft Red List of Dragonfl ies (Odonata) of the Carpathians . 172 Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains . 186 Draft Red List of Butterfl ies (Lepidoptera: Papilionoidea) of the Carpathian Mts. 200 Draft Carpathian Red List of Fish and Lamprey Species . 203 Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia) . 209 Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia) . 214 Draft Carpathian Red List of Birds (Aves). 217 Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) . -

Les Mollusques Continentaux De La Région Nord-Pas-De-Calais Liste Des Espèces, Échantillonnage Et Base De Données
Université des Sciences et Technologies de Lille – U.F.R. de Biologie Année 2003 n°ordre Diplôme Supérieur de Recherche en Sciences Naturelles Présenté et soutenu publiquement par XAVIER CUCHERAT le 2 juillet 2003 Les Mollusques Continentaux de la Région Nord-Pas-de-Calais Liste des espèces, Échantillonnage et Base de Données Jury PR. M. DESCAMPS Université de Lille I Président DR. A. LEPRETRE Université de Lille I Rapporteur DR. S. DEMUYNCK Université de Lille I Examinateur DR. J. GODIN Université de Lille I Examinateur DR. J. PRYGIEL Agence de l’Eau Artois-Picardie Examinateur Université des Sciences et Technologies de Lille – U.F.R. de Biologie Année 2003 n°ordre Diplôme Supérieur de Recherche en Sciences Naturelles Présenté et soutenu publiquement par XAVIER CUCHERAT le 2 juillet 2003 Les Mollusques Continentaux de la Région Nord-Pas-de-Calais Liste des espèces, Échantillonnage et Base de Données Arion rufus (LINNAEUS 1758) Lymnaea stagnalis (LINNAEUS 1758) Adultes en parade nuptiale / Forêt Domaniale Adulte / dunes d’Erdeven / Erdeven de Mormal / Locquignol (Nord). 09/2001. (Morbihan). 05/2001. Taille des individus : 90 mm. Taille de l’individu : 60 mm. Photo : GUILLAUME EVANNO Photo : GUILLAUME EVANNO Malacolimax tenellus (O. F. MÜLLER 1774) Cepaea nemoralis nemoralis (LINNAEUS Adulte / Forêt Domaniale de Mormal / 1758) Locquignol (Nord). 09/2001. Adulte / Guebwiller (Haut-Rhin). 04/2003. Taille de l’individu : 35 mm. Taille de l’individu : 25mm. Photo : GUILLAUME EVANNO Photo : ALAIN LEPRETRE Jury PR. M. DESCAMPS Université de Lille I Président DR. A. LEPRETRE Université de Lille I Rapporteur DR. S. DEMUYNCK Université de Lille I Examinateur DR. -

Malakológiai Tájékoztató 11. (Eger, 1992.)
M ALAKOLÓGI AI TÁJÉKOZTATÓ 11. MALACOLOGICAL NEWSLETTER • Kiadja a MÁTRA MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA Published by THE NATURAL SCIENCE SECTION OF MÁTRA MUSEUM Szerkesztő (Editor) Dr. FÜKÖH LEVENTE HU - ISSN 0230-0648 Distribution of Molluscs of the Molluscan Clay of Two Localities According to Habitats and Feeding Habits (Wind Brickyard, Eger and Nyárjas Hill. Novaj; Hungary) A. Dávid Abstract: Among the Egerian Age exposures of North-east Hungary the Molluscan Clay of Wind Brickyard (Eger) and Nyárjas Hill (Novaj) contain fossils in exceptional richness. Distribution of molluscs of the Molluscan Clay of these two outcrops according to habitats and feeding habits is examined and compared. There are definite differences between the two localities. Introduction Among the several Upper-Oligocene outrops of North-Hungary the Molluscan Clay layers «f _Wind Brickyard, Eger and Nyárjas Hill, Novaj is compared (Fig.l.). These layers contain well-preserved „micro-mollusc" fossils abudantly. The bivalves, gastropods and schaphopods which were living here during the Egerian stage have belonged into the Hinia — Cadulus fossil community. It refers to similar paleoenvironments in case of both localities. The sea was deeper than 120 metres and the bottom was covered by fine-gra ined, clayey sediments. The aim of the investigation was to examine the distribution of the molluscs according to habitats and feeding habits in the collected materials. Methods Fifteen kilograms of clay was taken from both localities. After drying the samples were treated with hot water and peroxide of hydrogen. This material was washed out through a 0,5 nun sieve. At the end the molluscan remains were assorted from among the other fossils (e.gJ^oraminifera, Decapoda, Echinoidea, Osteichthyes). -

Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України Наказ 27.06.2018 № 237 Зареєстровано В Міністерстві Юстиції України 19 Липня 2018 Р
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.06.2018 № 237 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 р. за № 847/32299 Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області Відповідно до статті 44 Закону України "Про тваринний світ", абзацу двадцять другого підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою охорони, використання і відтворення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (далі - Перелік), що додається. 2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І.О.) забезпечити контроль за охороною, раціональним використанням і відтворенням видів тварин, занесених до Переліку. 3. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Богданович Г.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйка В.Ю. Заступник Міністра В.М. Вакараш ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державної екологічної інспекції України І.О. Яковлєв Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон Перший заступник Міністра аграрної -

Malaco 04 Full Issue 2007.Pdf
MalaCo Le journal électronique de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Paris / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] (Editeur en chef du numéro 4) Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIE / Montpellier / [email protected] Collaborateurs de ce numéro Gilbert COCHET Robert COWIE Sylvain DEMUYNCK Daniel PAVON Sylvain VRIGNAUD Pour soumettre un article à MalaCo : 1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme aux recommandations aux auteurs (en fin de ce numéro ou consultez le site www.journal-malaco.fr). Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit de refuser l’article. 2ème étape – Joindre une lettre à l’éditeur, en document texte, en suivant le modèle suivant : "Veuillez trouvez en pièce jointe l’article rédigé par << mettre les noms et prénoms de tous les auteurs>> et intitulé : << mettre le titre en français et en anglais >> (avec X pages, X figures et X tableaux). Les auteurs cèdent au journal MalaCo (ISSN1778-3941) le droit de publication de ce manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, n’a pas été publié auparavant et que tous sont en accord avec le contenu." 3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit complet (texte et figures) en format .doc et la lettre à l’éditeur à : [email protected]. -

Klicken, Um Den Anhang Zu Öffnen
Gredleria- VOL. 1 / 2001 Titelbild 2001 Posthornschnecke (Planorbarius corneus L.) / Zeichnung: Alma Horne Volume 1 Impressum Volume Direktion und Redaktion / Direzione e redazione 1 © Copyright 2001 by Naturmuseum Südtirol Museo Scienze Naturali Alto Adige Museum Natöra Südtirol Bindergasse/Via Bottai 1 – I-39100 Bozen/Bolzano (Italien/Italia) Tel. +39/0471/412960 – Fax 0471/412979 homepage: www.naturmuseum.it e-mail: [email protected] Redaktionskomitee / Comitato di Redazione Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone), Dr. Peter Ortner (Bozen/Bolzano), Dr. Gerhard Tarmann (Innsbruck), Dr. Leo Unterholzner (Lana, BZ), Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Schriftleiter und Koordinator / Redattore e coordinatore Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone) Verantwortlicher Leiter / Direttore responsabile Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Graphik / grafica Dr. Peter Schreiner (München) Zitiertitel Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol. ), 1 (2001): ISSN 1593 -5205 Issued 15.12.2001 Druck / stampa Gredleriana Fotolito Varesco – Auer / Ora (BZ) Gredleriana 2001 l 2001 tirol Die Veröffentlichungsreihe »Gredleriana« des Naturmuseum Südtirol (Bozen) ist ein Forum für naturwissenschaftliche Forschung in und über Südtirol. Geplant ist die Volume Herausgabe von zwei Wissenschaftsreihen: A) Biologische Reihe (Acta Biologica) mit den Bereichen Zoologie, Botanik und Ökologie und B) Erdwissenschaftliche Reihe (Acta Geo lo gica) mit Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Diese Reihen können jährlich ge mein sam oder in alternierender Folge erscheinen, je nach Ver- fügbarkeit entsprechender Beiträge. Als Publikationssprache der einzelnen Beiträge ist Deutsch oder Italienisch vorge- 1 Naturmuseum Südtiro sehen und allenfalls auch Englisch. Die einzelnen Originalartikel erscheinen jeweils Museum Natöra Süd Museum Natöra in der eingereichten Sprache der Autoren und sollen mit kurzen Zusammenfassun- gen in Englisch, Italienisch und Deutsch ausgestattet sein. -

Land Snails of Leicestershire and Rutland
Land Snails of Leicestershire and Rutland Introduction There are 50 known species of land snail found in Leicestershire and Rutland (VC55) which represents about half of the 100 UK species. However molluscs are an under-recorded taxon group so it is possible that more species could be found and equally possible that a few may now be extinct in our two counties. There was a 20 year period of enthusiastic mollusc recording between 1967 and 1986, principally by museum staff, which account for the majority of species. Whilst records have increased again in the last three years thanks to NatureSpot, some species have not been recorded for over 30 years. All our land snails are in the class Gastropoda and the order Pulmonata. Whilst some of these species require damp habitats and are generally found near to aquatic habitats, they are all able to survive out of water. A number of species are largely restricted to calcareous habitats so are only found at a few sites. The sizes stated refer to the largest dimension of the shell typically found in adult specimens. There is much variation in many species and juveniles will of course be smaller. Note that the images are all greater than life size and not all the to the same scale. I have tried to display them at a sufficiently large scale so that the key features are visible. Always refer to the sizes given in the text. Status refers to abundance in Leicestershire and Rutland (VC55). However molluscs are generally under- recorded so our understanding of their distribution could easily change. -

Методика За Мониторинг На Малки Сухоземни Охлюви, Stylommatophora (1)
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Методика за мониторинг на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1) I. Обекти на мониторинга Тип: Mollusca Клас: Gastropoda Разред: Stylommatophora Семейство: Valloniidae Vallonia enniensis (Gredler 1856) Семейство: Vertiginidae Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy 1849) Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys 1830 II. Описание на обектите НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 1. Разпространение в Vallonia enniensis: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (Варна и околностите; дюни северно от Несебър, България района на “Янкови кашли”); Тракийската низина (наносите на река Марица до Пловдив); Родопите; Средна Гора (с. Дюлево; Панагюрище) и Западна България. (A. Wagner (1927), Urbanski (1960), Дамянов и Лихарев (1975), Georgiev & Stoycheva (2009)). Общо разпространение: Европа (Австрия, Балеарските острови, Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Южна и Източна Испания, Северна Италия, Швеция, Швейцария), в т.ч. Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна гора), както и Турция и Египет. Vertigo moulinsiana: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (с. Топола, Варненско; с. Белослав, Варненско); Тракийската низина (Пловдивско, поречието на река Марица) и Северно от Стара планина (A. Wagner (1927), Urbanski (1960 a), Дамянов и Лихарев (1975)). Дамянов и Лихарев (1975) споменават вида за цялото Черноморие, но няма посочени конкретни находища, нито последващи достоверни данни, потвърждаващи това предположение. Общо разпространение: Европа (Австрия, Балеарските острови, Беларус, Белгия, Британия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сардиния, Словакия, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария), Балканите (България, Хърватия), както и Южна Армения. Vertigo angustior: в България е съобщаван за: Пловдивско (поречието на река Марица), Варненско (с. Белослав, Варненско, курорта Златни пясъци) и Бургаско (A.