Bezirk Visp & Schattenberge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Streiflichter Zur Hotel- Und Tourismusgeschichte Im Saastal Bis Zum Ersten Weltkrieg 1
STREIFLICHTER ZUR HOTEL- UND TOURISMUSGESCHICHTE IM SAASTAL BIS ZUM ERSTEN WELTKRIEG 1 Roland Flückiger-Seiler 1 Die Entdeckung und Erforschung der Alpenwelt Wichtige Grundlagen für die Entdeckung der Schweizer Alpen als «Garten Edens» leisteten engagierte Forscher und Schriftsteller bereits im frühen 18. Jahrhun- dert. Einer der Ersten war der Zürcher Arzt und Universalgelehrte Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), der sich als erster Naturforscher nach dem lähmenden 17. Jahrhundert mit wissenschaftlichen Absichten in die Alpen wagte. In den Som- mermonaten durchstreifte er mit seinen Studenten alpine Gegenden und sammelte alle erdenklichen Daten über Natur und Umwelt. Mit diesem Wissen publizierte er 1713 eine vierteilige Karte der Schweiz, die lange Zeit als beste Darstellung der Eidgenossenschaft galt. Die von ihm erhobenen Daten und die eigene Beobach- tung des Gebirges auf seinen Wanderungen über fast alle Schweizer Alpenpässe bildeten die Basis für das seit 1702 in mehreren Auflagen erschienene Lebenswerk ‹Itinera per Helvetiae alpinas regiones›. Bereits 1704 nahm ihn die «Royal Socie- ty» in London als Mitglied auf, eine damals äusserst seltene Ehre für einen Aus- länder. Die Verbreitung seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten über die Schweiz 1 Diese Übersicht basiert auf Texten, die der Autor in seinem Buch ‹Berghotels zwischen Alp- weide und Gipfelkreuz› 2015 im Verlag Hier und Jetzt, Baden, veröffentlicht hat. Inzwischen sind noch weitere Fakten zum Vorschein gekommen und die Texte zum Saastal sind hier über- sichtlich zusammengefasst. Der Autor möchte bei dieser Gelegenheit allen danken, die ihn bei seinen Forschungen im Saastal unterstützt haben und noch unterstützen: In erster Linie Damian Bumann als Archivar im «Historischen Archiv Saastal» (HAS). Dann geht der Dank auch an den Stiftungsrat von «Saas ischi Heimat» sowie an Beat Anthamatten und Bernhard Andenmatten, die mir zu wertvollem Material verholfen haben. -

Goats As Sentinel Hosts for the Detection of Tick-Borne Encephalitis
Rieille et al. BMC Veterinary Research (2017) 13:217 DOI 10.1186/s12917-017-1136-y RESEARCH ARTICLE Open Access Goats as sentinel hosts for the detection of tick-borne encephalitis risk areas in the Canton of Valais, Switzerland Nadia Rieille1,4, Christine Klaus2* , Donata Hoffmann3, Olivier Péter1 and Maarten J. Voordouw4 Abstract Background: Tick-borne encephalitis (TBE) is an important tick-borne disease in Europe. Detection of the TBE virus (TBEV) in local populations of Ixodes ricinus ticks is the most reliable proof that a given area is at risk for TBE, but this approach is time- consuming and expensive. A cheaper and simpler approach is to use immunology-based methods to screen vertebrate hosts for TBEV-specific antibodies and subsequently test the tick populations at locations with seropositive animals. Results: The purpose of the present study was to use goats as sentinel animals to identify new risk areas for TBE in the canton of Valais in Switzerland. A total of 4114 individual goat sera were screened for TBEV-specific antibodies using immunological methods. According to our ELISA assay, 175 goat sera reacted strongly with TBEV antigen, resulting in a seroprevalence rate of 4.3%. The serum neutralization test confirmed that 70 of the 173 ELISA-positive sera had neutralizing antibodies against TBEV. Most of the 26 seropositive goat flocks were detected in the known risk areas in the canton of Valais, with some spread into the connecting valley of Saas and to the east of the town of Brig. One seropositive site was 60 km to the west of the known TBEV-endemic area. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Das Freigericht Baltschieder-Gründen
www.burgerschaftvisp.ch/geschichtliches/historisches/DasFreigerichtBaltschieder-Gründen.pdf Das Freigericht Baltschieder-Gründen Das Gebiet des alten Zenden Visp war früher in vier Viertel eingeteilt. Zum ersten Viertel gehörten die Gemeinden Visp, Eyholz, Lalden, Baltschieder, Visperterminen und Zeneggen; zum zweiten Viertel Stalden, Staldenried, Grächen, Embd und Törbel; zum dritten Viertel die Talschaft Saas und die Gemeinde Eisten; und zum vierten Viertel schliesslich gehörte das Gebiet von Kipfen und die jetzigen Gemeinden Sankt Niklaus, Randa, Täsch und Zermatt. Alle vier Viertel waren im Zendenrat gleichberechtigt. Die Gerichtsbarkeit im Zenden unterteilte sich jedoch in sechs Gerichtsterritorien, von denen jede seine eigene Geschichte hat: Die Kastlanei Visp, früher Meiertum. Sie umfasste die drei Viertel Visp (Visp, Eyholz, Lalden, Visperterminen, Zeneggen, Törbel), Stalden (Stalden, Staldenried, Embd und Grächen) und Saas. Der Richter über dieses Gebiet trug den Titel “Grosskastlan der löblichen drei Viertel Visp“. Als alter Brauch wird 1682 bezeichnet, jedes Jahr um das Fest der hl. Jungfrau und Märtyrerin Katharina einen Kastlan zu setzten. Das Freigericht Baltschieder-Gründen, seit dem 17. Jh. im Besitz der Burgerschaft Visp. Das Meiertum Kipfen, gelegen zwischen Stalden und Sankt Niklaus. Das Meiertum Sankt Niklaus oder Chouson (Gasen), welches das Gebiet der heutigen Ge- meinde Sankt Niklaus umfasste. Das Meiertum Zermatt, früher Herrschaft mehrerer Familien. Die Kastlanei Täsch-Randa. © www.burgerschaftvisp.ch 1/7 N. Pfaffen, -

Pro Senectute Oberwallis Überbielstrasse 10 3930 Visp Tel
Pro Senectute Oberwallis Überbielstrasse 10 3930 Visp Tel. 027 /948 48 50 [email protected] / www.vs.prosenectute.ch Seniorenwanderungen Frühjahr 2021 Region Stalden Stalden – Staldenried – Eisten – Törbel – Embd Wanderungen Frühjahr 2021 04. Mai Staldenried - Stalden ** 11. Mai Hohtenn - Raron *** 18. Mai Saas Balen - Eisten ** 25. Mai Venthone, Bisse neuf - Varen *** 01. Juni Greich - Lax ** 08. Juni Birgisch - Mund - Birgisch ** 15. Juni Finnen - Eggen *** leichte Wanderung, Gelände flach oder leicht geneigt, 3 Std. - bis 300 Höhenmeter Mittlere Wanderung, einige kleine Auf- und Abstiege, 3 - 4.5 Std., 300 – 600 Höhenmeter Anspruchsvolle Wanderung, mittlere Auf- und Abstiege, 4.5 - 5.5 Std., 600 – 900 Höhenmeter Neu: Ab diesem Jahr wird bei jeder Wanderung CHF 5.00 pro Teilnehmer einkassiert. Das Geld wird für die Weiterbildungskurse der Wanderleitenden verwendet! Besammlung: 15 Minuten vor der Abfahrt des angegebenen öffentlichen Verkehrsmittels. Billette: Halbtax Abo immer mitnehmen. Fahrkarten für Bahn und Postauto besorgen die Wanderleiter! Programmänderungen bleiben vorbehalten. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Achtung: Bitte beachten Sie die momentane Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr (Bahn, Bus, Seilbahn, Schiff)! Bei zweifelhafter Witterung gibt Ihnen die Wanderleitung Auskunft: Doris Gsponer, Stalden 027 952 10 84 078 914 17 92 Esther Lengen, Embd 027 952 12 91 079 394 61 18 Nathalie Andenmatten, Eisten 027 952 26 46 079 694 21 69 Co-Leitung Willy Andres, Stalden 027 952 13 68 076 577 88 46 Co-Leitung Charles Zenhäusern, Stalden 027 952 21 78 079 840 71 36 Viel Vergnügen wünscht das Leiterteam von Pro Senectute! Dienstag, 04. Mai 2021 Leitung: Nathalie & Charles Wanderung Staldenried - Stalden Route: Staldenried – zer Chirchu – Chastolegga – Achersand – Stalden Marschzeit: 2.5 Std. -

Alexander Burgener „König Der Bergführer“ * 10
Alexander Burgener „König der Bergführer“ * 10. Januar 1845 und † 8. Juli 1910 im Jungfraugebiet (BE) Ausstellung Sommer 2010 und 2011 in Huteggen, Eisten im Saastal (VS) Gedenktafel Alexander Burgener Auf dem Mahnmal Mittelallalin und bei der Ruine des Elternhauses von Alexander Burgener auf der Huteggen Geboren in Saas-Fee, getauft in Saas-Grund, geheiratet in Stalden und ansässig und begraben in Eisten im Saastal Zum 100sten Todestag von Alexander Burgener dem „König der Berge“ Neben dem Hotel Huteggen, wo einst die ersten Touristen auf ihrem Weg ins hintere Saastal nächtigten, stand das Haus Alexander Burgeners. Davon ist nur noch die Ruine des Erdgeschosses erhalten. Sein Leben und seine Taten sowie sein tragischer Tod werden in einer Ausstellung in der ehemaligen Herberge „Huteck“ gewürdigt. Diese ist noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten und wird aus einem 70-jährigen Dornröschenschlaf erweckt. Als Zeichen und Hinweis auf die Ausstellung wird das Elternhaus Alexander Burgeners im Profil markiert. Beide Gebäude sind von der neuen Kantonsstrasse aus gut sichtbar und Parkplätze sind vorhanden. Ein Gedenkhalt vor der geplanten oder nach der gelungenen Bergtour wird nachhaltig in Erinnerung bleiben. Dieser spezielle Ort eignet sich zur Beherbergung einer gemeinnützigen Stiftung. Hot. Huteck 1246m (Zimmer nebst Licht und Bedienung 2 FR., Frühstück / Café complet 1 Fr., Mittagessen Hauptmahlzeit 3 Fr. , gelobt) Zitat Baedeker‘s Schweiz 1951 Hotel Huteggen und Elternhaus von Alexander Burgener Foto Archiv G. Supersaxo Saas Fee vor 1934 Hotel Huteggen und die Ruine des Elternhauses von Alexander Burgener (Aufnahme 1985) Projekt der Gedenkausstellung 2010 / 2011 Ställe des Elternhauses von Alexander Burgener, dessen Leben und Taten in einer Ausstellung im 1. -

The Imeschs from the Upper Valais - Glimpses of a Swiss and North-American Family
Swiss American Historical Society Review Volume 42 Number 1 Article 3 2-2006 The Imeschs from the Upper Valais - Glimpses of a Swiss and North-American Family Marianne Burkhard Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Burkhard, Marianne (2006) "The Imeschs from the Upper Valais - Glimpses of a Swiss and North- American Family," Swiss American Historical Society Review: Vol. 42 : No. 1 , Article 3. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol42/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Burkhard: The Imeschs from the Upper Valais THE IMESCHS FROM THE UPPER V ALAIS - GLIMPSES OF A SWISS AND NORTH-AMERICAN FAMILY by Marianne Burkhard 1. Introduction The Valais is the third-largest canton of Switzerland covering 2016 square miles of which only 1107 are productive. It is also a world of its own: it received its name "the valley" from the 100 mile long valley of the Rhone River which has its source above the small town of Gletsch below the highest point of the Furka pass. This main valley is flanked on the north and south side by many of the highest peaks of the Swiss Alps. The northern side toward the Canton of Bern is forbiddingly steep, and the Lotschental and the valley leading to the Leukerbad are the only valleys which branch off on this side while many long and deep valleys branch off on the southern side, e.g. -

Kanton Wallis
Kanton Wallis zuständige Ausgabestelle Bitte entnehmen Sie aus der Liste unten welcher Bezirk für Ihre Gemeinde für die Ausgabe der Ausweiskarte für Reisende mit einer Behinderung zuständig ist. PLZ Ortschaft (alphabetisch) Gemeinde Distrikt 3951 Agarn Agarn Leuk 3955 Albinen Albinen Leuk 3963 Aminona Randogne Sierre 1972 Anzère Ayent Hérens 1994 Aproz (Nendaz) Nendaz Conthey 1974 Arbaz Arbaz Sion 1957 Ardon Ardon Conthey 1966 Argnou (Ayent) Ayent Hérens 1986 Arolla Evolène Hérens 1991 Arvillard (Salins) Sion Sion 1914 Auddes-sur-Riddes Isérables Martigny 3938 Ausserberg Ausserberg westl. Raron 3995 Ausserbinn Ernen Goms 1976 Aven Conthey Conthey 1966 Ayent Ayent Hérens 3961 Ayer Anniviers Sierre 1996 Baar (Nendaz) Nendaz Conthey 3937 Baltschieder Baltschieder Visp 1996 Basse-Nendaz Nendaz Conthey 3914 Belalp Naters Brig 3997 Bellwald Bellwald Goms 3991 Betten Betten östl. Raron 3992 Bettmeralp Betten östl. Raron 1996 Beuson (Nendaz) Nendaz Conthey 3989 Biel VS Grafschaft Goms 1996 Bieudron (Nendaz) Nendaz Conthey 3996 Binn Binn Goms 3903 Birgisch Naters Brig 3983 Bister Bister östl. Raron 3982 Bitsch Bitsch östl. Raron 3919 Blatten (Lötschen) Blatten westl. Raron 3914 Blatten b. Naters Naters Brig 1966 Blignou (Ayent) Ayent Hérens 3989 Blitzingen Blitzingen Goms 1966 Botyre (Ayent) Ayent Hérens 1946 Bourg-St-Pierre Bourg-St-Pierre Entremont 1897 Bouveret Port-Valais Monthey Kanton Wallis zuständige Ausgabestelle der Ausweiskarte für Reisende mit einer Behinderung. Seite 1 von 8 PLZ Ortschaft (alphabetisch) Gemeinde Distrikt 1932 Bovernier Bovernier Martigny 1967 Bramois Sion Sion 3957 Bratsch Gampel-Bratsch Leuk 3900 Brig Brig-Glis Brig 3900 Brigerbad Brig-Glis Brig 1996 Brignon (Nendaz) Nendaz Conthey 1934 Bruson Bagnes Entremont 3935 Bürchen Bürchen westl. -
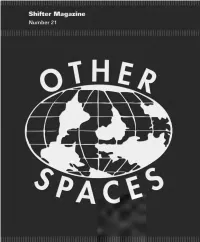
Other Spaces Spreads03.Pdf
9 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 1 Shifter Magazine INCH Number 21: Other Spaces ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER 14 8 Editors’ Note . 5. Luis Camnitzer . *6. Sean Raspet . 7. 7 Joanne Greenbaum . .*18 Blithe Riley . 20. Tyler Coburn . 31. Sheela Gowda . 39. Blank Noise . 42. Lise Soskolne . 55. 6 Mariam Suhail . 77. Julia Fish . *89. Dan Levenson . 90. Beate Geissler / Oliver Sann . .102 Alison O’Daniel . .110 Greg Sholette / Agata Craftlove . 115. Jacolby Satterwhite . .126 5 Josh Tonsfeldt . 130. Jeremy Bolen . .138 Kitty Kraus . 140. Tehching Hsieh . .143 * Work by these artists is dispersed throughout the issue . The page number marks the first 4 occurrence of their work . Publisher . SHIFTER Editor . .Sreshta Rit Premnath 3 Editor . .Matthew Metzger Designer . Dan Levenson SHIFTER, Number 21, September, 2013 Shifter is a topical magazine that aims to illuminate and broaden our understanding of the inter- sections between contemporary art, politics and philosophy .The magazine remains malleable and 2 responsive in its form and activities, and represents a diversity of positions and backgrounds in its contributors . shifter-magazine .com shiftermail@gmail .com This issue of SHIFTER was funded by a grant from the Graham Foundation © 2013 SHIFTER 1 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 Other Spaces A city square is occupied by hundreds of shouting voices, and transformed 8 by hundreds of sleeping bodies building together a polis for action as well as a home for repose . -

Regionaler Sicherheitsdienst Saastal Winterbericht 2014 /2015
Regionaler Sicherheitsdienst Saastal 12. November 2014, Tauwetter nach Schneefall (natürliche Schneeskulpturen) Winterbericht 2014 /2015 Regionaler Sicherheitsdienst Saastal Winterbericht 14 / 15 Inhaltsverzeichnis 1. Organigramm 3 2. Wetter, Schnee und Lawinen 4 3. Beurteilung der Lawinengefahr 23 4. Künstliche Lawinenauslösung 24 5. Getroffene Massnahmen (Sperrungen) 24 6. Projekte Naturgefahren 24 7. Schneeprofile 25 8. Kosten 26 9. Zusammenfassung / Schlusswort 26 29. Juli 2014, Schneefall oberhalb der Waldgrenze. 2 Regionaler Sicherheitsdienst Saastal Winterbericht 14 / 15 Organigramm 2014 / 2015 Kommission Regionaler Sicherheitsdienst Saastal (RSD Saastal) Kommissionspräsident Zurbriggen Pius Gemeinderat Saas-Grund 079 622 26 07 / 027 957 18 28 Dienststelle für Wald und Landsch. Norbert Carlen DWL Kreis Oberwallis 079 353 63 79 / 027 606 97 72 Gemeinde Eisten Andenmatten Urban Gemeinderat 078 820 25 05 / 027 952 19 10 Gemeinde Saas-Almagell Zeiter Stefan Gemeinderat 079 516 43 16 / 027 957 29 08 Gemeinde Saas-Balen Ruppen André Gemeinderat 079 327 61 80 / 027 957 20 72 Gemeinde Saas-Fee Bumann Damian Gemeinderat 079 220 28 53 RSD Saastal Urs Andenmatten Chef Einsatzleitung 079 606 43 27 / 027 957 15 85 Eisten Saas-Balen Saas-Almagell Saas-Fee Felskinn Automatische 4SE 4SB 4SA 4SF 4EG Messstationen Furrer Vitus Burgener Philipp Andenmatten Peter Sporrer Bertha Bergbahnen Seetal Saas-Fee AG Schwarzmies 027 952 22 57 027 957 22 08 027 957 27 56 027 957 23 63 Hofer Lars Gibidum 027 958 78 00 079 628 43 63 079 300 42 18 Regionaler Sicherheitsdienst Saastal (RSD) DWL Naturgefahren Einsatzzentrale Carlen Norbert Telefon 027 957 15 85 Fax 027 957 15 89 079 353 63 79 [email protected] Kontaktstelle Kanton Chef Einsatzleitung Stellvertreter Einsatzleitung Seiler Jules SLF / IFKIS Andenmatten Urs Zurbriggen Gregor T 027 932 21 81 Natel 079 606 43 27 Natel 079 435 13 87 N 079 418 85 17 Empfehlungen an die Gemeinden Tel. -

Das Postnetz Im Kanton Wallis 2020 Stand 1. Juni 2020
Das Postnetz im Kanton Stand Wallis 2020 1. Juni 2020 Kt. Regulatorisch relevante Formate Servicepunkte Total VS Eigenbetriebene Hausservices Geschäfts- Aufgabe-/ My Post 24- Zugangs- Filialen und kundenstellen Abholstellen Automaten möglich- Partnerfilialen keiten Heute 133 104 5 14 5 261 PLZ Bezeichnung Gemeinde Zugangsmöglichkeit 3951 Agarn Agarn Filiale mit Partner 3955 Albinen Albinen Hausservice 3961 Ayer Anniviers Hausservice 3961 Chandolin Anniviers Filiale mit Partner 3961 Grimentz Anniviers Filiale mit Partner 3960 Niouc Anniviers Hausservice 3961 St-Luc Anniviers Filiale mit Partner 3961 Vissoie Anniviers Filiale 3961 Zinal Anniviers Filiale mit Partner 1974 Arbaz Arbaz Filiale mit Partner 1957 Ardon Ardon Filiale mit Partner 3938 Ausserberg Ausserberg Filiale mit Partner 1972 Anzère Ayent Filiale mit Partner 1966 Ayent Ayent Filiale mit Partner 1934 Bruson (Le Châble) Bagnes Hausservice 1948 Fionnay Bagnes Hausservice 1934 Le Châble VS Bagnes Filiale 1948 Lourtier Bagnes Hausservice 1948 Sarreyer Bagnes Hausservice 1936 Verbier Bagnes Filiale 1947 Versegères Bagnes Filiale mit Partner 3937 Baltschieder Baltschieder Filiale mit Partner 3937 Baltschieder GKS Baltschieder Geschäftskundenstelle 3997 Bellwald Bellwald Filiale mit Partner 3991 Betten Bettmeralp Hausservice 3992 Bettmeralp Bettmeralp Filiale mit Partner Das Postnetz im Kanton Wallis 2020 PLZ Bezeichnung Gemeinde Zugangsmöglichkeit 3994 Martisberg Bettmeralp Hausservice 3996 Binn Binn Filiale mit Partner 3982 Bitsch Bitsch Filiale mit Partner 3919 Blatten (Lötschen) -

Gemeindekalender Saas-Fee
Saas Fee alpine energy power 2021 Gemeindekalender Saas-Fee – Veranstaltungen – Abfallentsorgung – Telefonnummern und Informationen Liebe Saas-Feer*innen, liebe Gäste Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Gemeinde Saas-Fee wünschen Ihnen für die anstehenden Weihnachts-Feiertage und im neuen Jahr alles erdenklich Beste bei guter Gesundheit. Respektvoll, zuversichtlich und mutig wollen wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit Ihnen, zum Wohle der Gemeinde, angehen. Januar 2021 Abfallentsorgung Kehricht und Sperrgut Neujahr Fr 1 werden nicht abgeholt. Sa 2 Berchtoldstag Schulferien So 3 Mo 4 Di 5 Mi 6 Drei Könige Do 7 Fr 8 Sa 9 So 10 Mo 11 Di 12 Mi 13 Do 14 Fr 15 Sa 16 So 17 Mo 18 Gedenkfeier von Carl Zuckmayer in der Kirche Saas-Fee Di 19 Mi 20 Do 21 Fr 22 Sa 23 So 24 Mo 25 Di 26 Mi 27 Do 28 Kath. Frauen- und Mütterverein: Winterabend Fr 29 Sa 30 So 31 Hauskehricht Karton Elektrogeräte Sperrgut Küchenabfälle Februar 2021 Abfallentsorgung Mo 1 Di 2 Mi 3 Do 4 Fr 5 Sa 6 So 7 Mo 8 Kath. Frauen- und Mütterverein: Senioren z’Mittag Di 9 Mi 10 Do 11 «Feist Frontag» Fr 12 Sa 13 So 14 Valentinstag Mo 15 «Gigisch Montag» Di 16 Mi 17 Aschermittwoch Do 18 Fr 19 Sa 20 So 21 Mo 22 Di 23 Mi 24 Do 25 Fr 26 Sa 27 So 28 Hauskehricht Karton Elektrogeräte Sperrgut Küchenabfälle März 2021 Abfallentsorgung Mo 1 Di 2 Mi 3 Do 4 Schulferien Fr 5 Sa 6 Eidgenössische Abstimmung So 7 Grossratswahlen / Staatsratswahlen Mo 8 Di 9 Mi 10 Do 11 Fr 12 Sa 13 So 14 Mo 15 Di 16 Mi 17 Do 18 Fr 19 St.