LWL Kulturagenda Westfalen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Goals and Management of the Ruhr Reservoir System Since the Beginning of Our Century
Scientific Procedures Applied to the Planning, Design and Management of Water Resources Systems (Proceedings of the Hamburg Symposium, August 1983). IAHSPubi. no. 147. Goals and management of the Ruhr reservoir system since the beginning of our century F, W, RENZ Ruhr Reservoir Association, Kronprinzenstrasse 37, D-4 300 Essen 1, FR Germany ABSTRACT In the last 85 years a system of reservoirs has provided augmentational low flows in the Ruhr drainage area. The necessary discharge of the reservoirs compared with the water losses of the basin (i.e. the amount of water pumped over the watershed into adjacent areas for public water supply and the losses due to evaporation within the Ruhr basin) gives the gross efficiency rating of the reservoir system with respect to the goals of water management. The periods when parts of the reservoir system are not fully available for water manage ment are presented as a duration curve. Moreover the predicted water demand in the Ruhr area is compared with the measured amount. Today, the time which is needed to introduce a new reservoir within the system is longer than the period of time for which reliable forecasts of water demand are possible. Objectifs et aménagement du système de réservoirs de la Ruhr depuis le début de notre siècle RESUME Au cours des 85 dernières années, un système de réservoirs a été réalisé sur le bassin versant de la Ruhr en vue d'augmenter le débit de basses eaux. Le débit sortant exigé des réservoirs comparé aux pertes en eau du bassin (c'est à dire le volume d'eau pompée dans le bassin vers les zones voisines pour la fourniture d'eau au public et les pertes par evaporation dans le bassin de la Ruhr) conduit au calcul de l'efficacité globale du système de réservoirs par rapport aux objectifs de l'aménagement des eaux. -
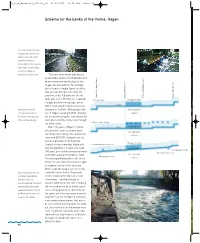
Scheme for the Banks of the Volme, Hagen
E_03_a_dreiseitl_078-111_16 20.09.2005 11:15 Uhr Seite 98 Scheme for the banks of the Volme, Hagen The Volme inside the town of Hagen was constrained within a box profile with embankment walls 3 metres high. As the concrete bed slowly crumbled away, a complete change of direction was envisioned. There are some towns that have a considerable number of inhabitants and whose names are familiar, but do not trigger any associations. For example, you’ve heard of Hagen, but it’s unlikely that you can describe more than the platform on the ICE train line. It’s the Weir at Kaufmannschule Weir Bridge at Rathausstraße at Marktstraße Weir Bridge at Badstraße same with rivers. The Ennepe is familiar 1. Previous state 100 year floodline enough, but how many people know that it flows into the Volme, which is a Volme Hydraulic assessment tributary of the Ruhr? Only people who Laid aggregate of the previous state of live in Hagen, you might think. Anyway, riverbed the Volme and projected the rivers come together just outside the effects of a new design town gates, and the Volme runs through the town centre. 2. Effects of the design But in the case of Hagen’s inhabit- Volme Rise of water level ants you can’t even be certain about Laid aggregate the Volme. As in many other places, this riverbed town with 200,000 inhabitants at the southern gateway of the Ruhr has 100 year floodline treated its river somewhat shabbily. It 3. Compensatory measures was downgraded to a canal in the past Steeper slope Volme Laid aggregate ramp 100 years, polluted with industrial waste Raised riverbed level and hidden away behind factory halls. -

EEG Anlagenstammdaten 2016
EIC-Netzbetreiber 11YR000000018733 BNetzA-Nr 10001905-01 Kennungen Standort / Lage der Anlage Technische Anlageninformationen Aggregatzustand Einsatzstoffe (nur bei Biomasse) Einspeisemanag Installierte Lastgang- Einspeise- Inbetriebnahmeda Außerbetrieb- Stromsteuerbef Regionalnach Bundesland- Netzzugangs- Netzabgangs- ement-Typ Anlagenschlüssel (!!! 33-stellig !!!) Zählpunktbezeichnung (!!! 33-stellig!!!) Ort / Gemarkung PLZ Straße / Flurstück Gemeindeschlüssel (optional) Leistung gemessen spannungs- Energieträger tum nahmedatum fest flüssig gasförmig reiung weise kürzel datum [TT.MM.JJJJ] datum [TT.MM.JJJJ] 0, 1, 2, 3 (siehe § [kW] Ja/Nein ebene [TT.MM.JJJJ] [TT.MM.JJJJ] [x] [x] 9 EEG 2014) E31905010000000000020407040100000 DE0002525823900000000000204070401 Schwerte 58239 Bergerhofweg 24 NW 3,60 Nein NS SOL 22.10.2002 22.10.2002 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729000000 DE0074095823900000000001000007290 Schwerte 58239 Am Winkelstück 14 NW 96,00 Ja MS SOL 19.12.2007 19.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729100000 DE0074095823900000000001000007291 Schwerte 58239 Goethestr. 17 NW 9,52 Nein MS SOL 17.12.2007 17.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100001166600000 DE0074095823900000000001000011666 Schwerte 58239 Gut Halstenberg 5 NW 99,66 Ja MS SOL 28.06.2010 28.06.2010 31.12.2012 2 E3190501NEM00RLM00000005701600001 DE00740958239NEM00RLM000000057016 Schwerte 58239 Hagener Str. 400 NW 78,72 Ja MS SOL 09.03.2012 09.03.2012 31.12.2012 2 E31905010000000000018556930100001 DE0002525170900000000000185569301 Marienheide 51709 Kempershöher -

Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung Und Geoinformation
Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation Begründung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Lüdenscheid (Ausschnitt) 1. Anlass und Ziel der Planung Aufgrund einer von der Bahn AG durchgeführten Entbehrlichkeitsprüfung sind im Bereich des Bahnhofes Brügge nicht mehr bahnnotwendige Flächen frei geworden und der Stadt Lüdenscheid zum Kauf angeboten worden. Die Stadt Lüdenscheid hat die nicht mehr benö- tigten Flächen erworben, um diese z. T. brachliegenden und untergenutzten Flächen städte- baulich aufzuwerten und zu entwickeln. Für einen östlichen Teilbereich der Gesamtfläche soll diese 6. Änderung des Flächennut- zungsplanes aufgestellt werden. Hieraus wird der Bebauungsplan Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ entwickelt werden. Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig am Einmündungsbereich der Bun- desstraßen 54 (Volmestraße) und 229 (Talstraße) und soll zukünftig durch den Bau einer neuen Brücke über die Volme erschlossen werden. Die Stadt Lüdenscheid beabsichtigt, auf dem ehemaligen Bahngelände ein sonstiges Son- dergebiet gem. § 11 BauNVO sowie ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO zu entwickeln. Das sonstige Sondergebiet soll u. a. der Aufnahme von großflächigem Einzelhandel dienen. Aus dem im Jahre 2005 durch das Büro Junker und Kruse Stadtforschung Planung erarbei- teten gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept geht hervor, dass im Ortsteil Brügge sowie im angrenzenden Ortsteil Stüttinghausen ein Defizit bezüglich der Nahversorgung -

Kulturentwicklungsplan „Oben an Der Volme“ Ein Interkommunales Modellprojekt Der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1
Kulturentwicklungsplan „Oben an der Volme“ Ein interkommunales Modellprojekt der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1. Kontext ......................................................................................................................6 1.1. REGIONALE 2013 - Südwestfalen ....................................................................................... 6 1.1.1. RIEHK und das OadV-Leitbild ..................................................................................... 6 1.1.2. Das Kulturfestival „Lampenfieber“ .......................................................................... 10 1.2. Die (Kultur)region Südwestfalen und der Märkische Kreis ................................................. 12 1.2.1. Die regionale Kulturpolitik [RKP] .............................................................................. 12 1.2.2. Tourismus ................................................................................................................ 13 1.3. Kulturagenda Westfalen .................................................................................................. 16 2. Bestandsaufnahme OadV ......................................................................................18 2.1. Bevölkerung..................................................................................................................... 18 2.2. Kulturlandschaft .............................................................................................................. 26 2.2.1. Institutionen und private Kulturakteure -

In Elektrischer Mission Wie Der Caritasverband Aufs Fahrrad Kam Ab Seite 4 Caritaz Heft 2.2012 Caritaz Heft 2.2012
CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZDIE HAGENER CARITASZEITUNG · HEFT 2 · 2012 · 22. JAHRGANG IN ELEKTRISCHER MISSION Wie der Caritasverband aufs Fahrrad kam ab Seite 4 CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZDIE HAGENER CARITASZEITUNG · HEFT 2 · 2012 · 22. JAHRGANG MEHR ALS 6 UNTERSTÜTZEN IN ELEKTRISCHER PLANTSCHEN UND SPIELEN MISSION Wie der Caritasverband aufs Fahrrad kam ab Seite 4 Frühe Hilfen bieten Babyschwimm-Kursus dank Spenden der WP-Leser an GLÜCKLICHE GESICHTER STATT 28 KINDER Liebe Leser, UNENDLICH VIELER KARTONS Die ersten Tage in St. Christophorus – TITELBILD: Christof Becker Das Foto zeigt Sandra Schablack ein persönlicher Bericht und Michael Sonntag vom Integrationsfachdienst. Worum es geht, Das Dach der Caritas – es bietet jedem Platz. Und es wird immer größer: Zwei neue lesen Sie ab Seite 4 Einrichtungen unter dem roten Caritas-Kreuz bieten den Menschen in Hagen nun ihre Dienste an. Die beiden Neuen in unserer Gemeinschaft spiegeln gleichzeitig die Vielfalt CaritaZ – die Hagener Caritaszeitung und Breite unseres Angebotes wider: An der Hochstraße 61 erfüllt in der Kindertages- 22. Jahrgang, Ausgabe 2 | 2012 TÜR AN TÜR MIT DER CWH 40 BEHINDERUNG stätte St. Christophorus nun Kinderlachen das ehemalige Gemeindezentrum der Stadt- Neue Räume für die St. Laurentius-Werkstätte kirchengemeinde. Und auf Emst sind die Mieter in das neu erbaute Senioren-Service- HERAUSGEBER Caritasverband Hagen e. V. für Menschen mit Behinderung Wohnen am Köhlerweg eingezogen. Hierbei ist der Verband eine Kooperation mit einer Hochstraße 83 a, 58095 Hagen am Konrad-Adenauer-Ring Hagener Wohnungsgesellschaft eingegangen. Telefon (0 23 31) 91 84 - 0 Telefax (0 23 31) 18 30 07 Dies sind zwei sehr eindrückliche Beispiele für die Dynamik, die uns täglich antreibt. -

City County Lat-Long Aabauerschaft Hopsten 522157N0073734E
City County Lat-Long Aabauerschaft Hopsten 522157N0073734E Aabauerschaft Laer 520409N0072239E Aabauerschaft Wettringen 521143N0072015E Aachen Aachen 504629N0060504E Aacherhof Königswinter 504110N0071557E Aamühlen Brilon 512408N0083246E Aaperhöfe Wesel 513838N0063924E Abbenburg Brakel 514722N0091140E Abbenhaus Rosendahl 520239N0071114E Abbenroth Nümbrecht 505608N0073226E Abbing Borken 515414N0064543E Abel Dorsten 514424N0070256E Abelkath Wesel 514047N0063925E Abelmannshof Rheinberg 513421N0063316E Abelshof Wesel 514048N0063834E Abelsnaaf Overath 505611N0072311E Abenden Nideggen 504026N0062823E Aberham Hamminkeln 514750N0063234E Abrahamstal Lindlar 510208N0072139E Abt Dülmen 514905N0071934E Abtei Mariawald Heimbach 503712N0062912E Abtsküche Heiligenhaus 512009N0065947E Achenbach Siegen 505206N0075859E Achermer Mühle Mechernich 503847N0063651E Achterathsheide Moers 512406N0063544E Achterberg Kempen 512439N0063126E Achterhoek Kevelaer 513456N0062110E Achterhook Bocholt 514749N0063511E Achtermann Werne 514100N0074033E Ackenbrock Iserlohn 512207N0074106E Acker Aachen 504803N0060438E Ackermannshof Rheinberg 513138N0063642E Ackersiepen Ennepetal 511434N0071834E Ackfeld Ahlen 514317N0075330E Ackfeld Hamm 514315N0074910E Ackfeld Wadersloh 514537N0081510E Ackfeld Wadersloh 514536N0081234E Ackhof Kalletal 521001N0090022E Adalbertshöhe Hemer 512242N0074431E Adendorf Wachtberg 503658N0070307E Adener Mühle Lünen 513532N0073530E Adick Hopsten 522230N0073919E Adrian Verl 515314N0082807E Adscheid Hennef (Sieg) 504525N0072109E Aechterhoek Emsdetten 521136N0072959E -

Anlage C6 Schutzgut Landschaft
Schutzgut Landschaft Naturräumliche Gliederung 3) Naturräumliche Einheiten Empfindlichkeit gegenüber technischer Überformung 542.4 Übergänge zwischen den 542.4 gering Witten-Hörder Mulde naturräumlichen Einheiten mit Nummer und Bezeichnung 331.0 gering-mittel 542.4 mittel 1) Empfindlichkeit gegenüber Verlust Visuelle Leitlinien, Orientierungspunkte flächiger Landschaftsbildkomponenten Taleinschnitt SP 15 Höhenzug hoch / Wald Vorzugstrasse (mit Stationierungspunkt) Aussichtspunkt SP 1 Vorzugstrasse/ Abzweig (mit Stationierungspunkt) Bergkuppe SP 1 Fließgewässer Variante (mit Stationierungspunkt) Anbindungspunkte Untersuchungskorridor 5000 m Flächige Landschaftsbildkomponenten 1) Vorbelastungen 1) Grenzen 2) Wald Hochspannungsfreileitung Landesgrenze Gehölze und Baumreihen Gewerbe- und Industrieflächen Ver- und Entsorgungsanlage Kreisgrenze Gewässer Verkehrsflächen Gemeindegrenze Landwirtschaftlich genutzte Flächen Autobahn, Bundes- oder Landesstraße Offenlandbiotope Quelle: Hinweis: (Säume und Ruderalfluren, Heiden, Bahnlinie 1) Nutzungstypenkartierung Lange, 2010 Die Blattnummerierung bezieht sich extensiv genutzte Wiesen etc.) 2) infas GEOdaten GmbH, 2008 auf den Gesamtverlauf der Trasse Bahnanlage 3) Naturräumliche Gliederung Deutschlands Offenlandbiotope feuchter Standorte Abschnitt NRW: Blatt 01 - 06 Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 1969/72 (Nasswiesen, Gewässerbegleitvegetation etc.) Abschnitt Rheinland-Pfalz: Blatt 07 Siedlungsflächen Netzausbau Kruckel - Dauersberg Neubau einer 110-/380-kV-Freileitung Freizeit und Grünanlagen -

Restoration of Fish Passage and Results of a Master Plan Established for the Ruhr River Basin
RR 2004 3rd European Conference on River Restoration RIVER RESTORATION 2004 Zagreb, Croatia, 17-21 May 2004 Restoration of fish passage and results of a master plan established for the Ruhr River Basin Marq Redeker, Michael Weyand, Ernst A. Nusch ABSTRACT: According to the central aim of the European Water Framework Directive, the ecological and chemical conditions will be primary quality elements in future for surface waters. Population diversity and abundance of fish and macroinvertebrates is decisive in aiming at the good ecological status in surface water bodies,. Free passage in river systems is a prerequisite to allow the natural migration of fish and other aquatic organisms. In order to point out potentiali- ties for the Ruhr River Basin a study was commissioned to develop a master plan for river conti- nuity restoration. This study was complemented by investigations into the sediments in the riv- ers, in order to identify river sections or tributaries which presumably provide a suitable habitat for the successful reproduction of salmonides. The master plan illustrates the inherent problems of projects aimed at the restoration of fish migration in surface waters which are strongly affected by anthropogenic modifications. The results obtained can be transferred to other river basins with similar conditions. KEYWORDS: European Water Framework Directive, river basin management, river restoration, river continuity, fish passage, fishway, hyporheic interstitial, master plan 1 Introduction The European Water Framework Directive (WFD) [1] came into force in December 2000. Its central goal is the protection and sustainable management of the aquatic eco- systems. According to the new provisions, the quality of surface waters is assessed by biological and chemical elements, as well as various hydromorphological parameters supporting the biological elements. -

River Basins 2017
International Conference RIVER BASINS 2017 International Conference RIVER BASINS 2017 Transboundary Management of Pollutants Editors: O. Zoboli, M. Zessner, S. Fuchs Vienna, 2017 Institute for Water Quality, Resource and Waste Management TU Wien Karlsplatz 13/226 1040 Vienna, Austria In cooperation with International Conference RIVER BASINS 2017 Table of contents 1. Oral presentations ........................................................................................................................... 3 Session 1: Monitoring .......................................................................................................................... 4 A monitoring network platform for automated data assessment and its long-term application as surveillance system for transboundary water pollution ................................................................. 5 Ship-borne measurements of enzymatic GLUC activity on large water bodies: A rapid screening tool to localize point sources of potential microbial pollution ....................................................... 7 The impact of the Sava river pollution on biomarkers response in the liver and gills of three cyprinid species ............................................................................................................................... 8 Session 2: Monitoring and Modelling................................................................................................ 10 Multidimensional monitoring of microbial faecal pollution reveals dominance of human contamination -

Inhaltsverzeichnis
3 INHALTSVERZEICHNIS 1. EIN LEITUNG ....................................................................................................9 1.1 Anlass .............................................................................................................. 10 1.2 Das Entwurfsverfahren ....................................................................................16 1.3 Leitlinien Regionalplan ....................................................................................18 1.4 Bindungswirkung und Lesehinweise .............................................................28 2. KLIMA UND KLIMAWANDEL ........................................................................ 31 2.1 Klimaschutz .....................................................................................................33 2.2 Klimafolgenanpassung ................................................................................... 35 2.3 Regionale Grünzüge ........................................................................................ 41 3. ÜBERGREIFENDE PLANUNGSANSÄTZE .................................................. 45 3.1 Kulturlandschaftsentwicklung .......................................................................46 3.2 Freizeit, Erholung, Tourismus .........................................................................50 4. SIEDLUNGSRAUM ........................................................................................57 4.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum ..........................................58 4.2 Allgemeine -

Obere Wasserbehörde - Aktenzeichen: 54.50.85-023
Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid für die Bezirksregierung Arnsberg Bezirksregierung Arnsberg, Januar 2021 - Obere Wasserbehörde - Aktenzeichen: 54.50.85-023 Bekanntmachung gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 83 (2) Landeswassergesetz (LWG) Auslegung des Entwurfes der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete der Gewässer Volme, Ennepe, Hasper Bach, Heilenbecke, Krähenberger Bach, Selbecker Bach und Stefansbecke in der Ma- nagementeinheit Volme (ME_RUH_1100) im Regierungsbezirk Arnsberg einschließlich Anlagen, Az.: 54.50.85-023 Die Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Obere Wasserbehörde beabsichtigt gem. § 76 Wasserhaushaltsgesetz - WHG eine Verordnung zur Festsetzung der Überschwemmungs- gebiete an den oben genannten Gewässern zu erlassen. Der Entwurf der Ordnungsbehördlichen Verordnung eines Überschwemmungsgebietes ist gemäß § 83 LWG für 2 Monate auszulegen. Jeder kann in dieser Zeit die Verordnung sowie die Karten einsehen und eine Stellungnahme abgeben. Näheres ist im Erläuterungstext be- schrieben. Die Überschwemmungsgebiete in der Managementeinheit Volme im Regierungsbezirk Arns- berg erstrecken sich auf Flächen in den folgenden Kommunen: Stadt Hagen (kreisfreie Stadt) Stadt Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) Stadt Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) Gemeinde Schalksmühle (Märkischer Kreis) Stadt Lüdenscheid (Märkischer Kreis) Stadt Halver (Märkischer Kreis) Eine ortsübliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Entwurfs-Unterlangen er- folgt auch in den oben genannten Kommunen. Die