Robert Gerwarth/Stephan Malinowski
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hitler Und Bayern Beobachtungen Zu Ihrem Verhältnis
V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE SITZUNGSBERICHTE · JAHRGANG 2004, HEFT 4 Erstversand WALTER ZIEGLER Hitler und Bayern Beobachtungen zu ihrem Verhältnis Vorgetragen in der Sitzung vom 6. Februar 2004 MÜNCHEN 2004 VERLAG DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN In Kommission beim Verlag C. H. Beck München V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 ISSN 0342-5991 ISBN 3 7696 1628 6 © Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 2004 Gesamtherstellung: Druckerei C. H. Beck Nördlingen Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 Inhalt 1. Zur Methode ............................... 8 2. Hitlers Aufstieg in Bayern ...................... 16 3. Im Regime ................................ 33 4. Verhältnis zu den bayerischen Traditionen ........... 73 5. Veränderungen im Krieg ....................... 94 Bildnachweis ................................. 107 V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 Abb. 1: Ein bayerischer Kanzler? Reichskanzler Adolf Hitler bei seiner Wahlrede am 24. -
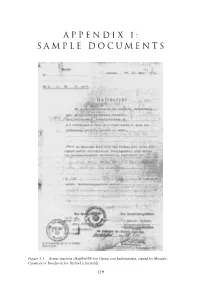
Appendix 1: Sample Docum Ents
APPENDIX 1: SAMPLE DOCUMENTS Figure 1.1. Arrest warrant (Haftbefehl) for Georg von Sauberzweig, signed by Morgen. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 129 130 Appendix 1 Figure 1.2. Judgment against Sauberzweig. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Appendix 1 131 Figure 1.3. Hitler’s rejection of Sauberzweig’s appeal. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 132 Appendix 1 Figure 1.4. Confi rmation of Sauberzweig’s execution. Courtesy of Bundesarchiv Berlin- Lichterfelde Appendix 1 133 Figure 1.5. Letter from Morgen to Maria Wachter. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut APPENDIX 2: PHOTOS Figure 2.1. Konrad Morgen 1938. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 134 Appendix 2 135 Figure 2.2. Konrad Morgen in his SS uniform. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 136 Appendix 2 Figure 2.3. Karl Otto Koch. Courtesy of the US National Archives Appendix 2 137 Figure 2.4. Karl and Ilse Koch with their son, at Buchwald. Corbis Images Figure 2.5. Odilo Globocnik 138 Appendix 2 Figure 2.6. Hermann Fegelein. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.7. Ilse Koch. Courtesy of Yad Vashem Appendix 2 139 Figure 2.8. Waldemar Hoven. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.9. Christian Wirth. Courtesy of Yad Vashem 140 Appendix 2 Figure 2.10. Jaroslawa Mirowska. Private collection NOTES Preface 1. The execution of Karl Otto Koch, former commandant of Buchenwald, is well documented. The execution of Hermann Florstedt, former commandant of Majdanek, is disputed by a member of his family (Lindner (1997)). -

Geschichte Neuerwerbungsliste 3. Quartal 1999
Geschichte Neuerwerbungsliste 3. Quartal 1999 Geschichte: Einführungen.........................................................................................................................................................2 Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie........................................................................................................................2 Historische Hilfswissenschaften..............................................................................................................................................7 Allgemeine Weltgeschichte, Geschichte der Entdeckungen, Geschichte der Weltkriege ...........................................11 Alte Geschichte.........................................................................................................................................................................19 Europäische Geschichte in Mittelalter und Neuzeit............................................................................................................22 Deutsche Geschichte................................................................................................................................................................26 Geschichte der deutschen Laender und Staedte..................................................................................................................37 Geschichte der Schweiz, Österreichs, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei...........................................................48 Geschichte Skandinaviens ......................................................................................................................................................50 -

Text Für Einleitung Zu „Stolpersteine in Bielefeld“
1 U. Horst 5/07 NATIONALSOZIALISMUS IN BIELEFELD – MACHTSICHERUNG – VERFOLGUNG - WIDERSTAND 1. Machtsicherung vor Ort Wie fast überall im Deutschen Reich so gelang den Nationalsozialisten auch in Bielefeld nach der Machtübertragung in Berlin innerhalb kürzester Zeit eine rasche und beinahe vollständige Machtsicherung vor Ort. Spielten dabei – neben der unzweifelhaften Begeisterung für das neue Regime – Repression und nackter Terror eine vorrangige Rolle, so besaß auf der Grundlage der breiten Zustimmung der Bevölkerung die massenhafte Denunziation erhebliche Bedeutung bei der Verfolgung der Gegner. Repression und Terror Am Abend des 30. Januar 1933 feierte die NSDAP in Bielefeld wie in vielen Orten des Deutschen Reichs mit einem Fackelzug die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Im Vergleich zu den rund 1200 NSDAP-Anhängern schien die Zahl von ca. 8000 Teilnehmern, die dem Aufruf von SPD und Gewerkschaften am Folgetag zu einer Gegendemonstration auf dem Kesselbrink gefolgt waren, ein deutlicher Beweis zu sein für den Slogan - so titelte die letzte Ausgabe der SPD-Zeitung „Vorwärts“ - „Bielefeld ist rot und bleibt rot“. Doch diese Zahlen täuschten, genau so wie die ideologisch zerstrittenen Parteien von SPD und KPD sich in ihrer Annahme, dass das Kabinett Hitlers nur von kurzer Lebensdauer sei, getäuscht hatten: Dem unmittelbar nach dem Regierungswechsel einsetzende brutalen Terror waren sie bald hilflos ausgeliefert, obwohl die SPD sich durch einen Legalitätskurs zu retten versuchte und die KPD die Arbeit im Untergrund vorbereitet -

1918-1923 Bayern
1923 - 1918 Kriegsende, Revolution und Räterepublik, die Ermordung Kurt Eisners, der Bürgerkrieg um München und die Putschversuche gegen die junge Demokratie: 1918-1923 war Bayern ein Brennpunkt der deutschen Geschichte. Die Ausstellung im Bayerischen Armeemuseum dokumentiert mit einer Fülle von Objekten, AYERN Fotografien und Zeugnissen die Geschichte der Gewalt in den Jahren nach dem Krieg. Dahinter steht die bren- B nende Frage, wie nach dem verlorenen Krieg ein wirklicher Frieden nach außen und innen zu gewinnen war. FRIEDENSBEGINN ISBN 978-3-8062-3900-3 9 783806 239003 Friedensbeginn? Bayern 1918-1923 Friedensbeginn? Bayern 1918-1923 Herausgegeben von Dieter Storz und Frank Wernitz Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Band 18 Herausgegeben von Ansgar Reiß Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Bayerischen Armeemuseums und des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. wbgTHEISS ist ein Imprint der wbg. © 2018 by Bayerisches Armeemuseum, Paradeplatz 4, 85049 Ingolstadt und wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht. Umschlag: Die Umschlagabbildung basiert auf einer Fotografie -

Aufrecht Gegen Nazis Me E R a N E
junge Welt Mittwoch, 25. August 2010, Nr. 197 antifa 15 Montag:politischesbuch|Dienstag:betrieb&gewerkschaft|Mittwoch:antifa|Donnerstag:wissenschaft&umwelt|Freitag:feminismus|Samstag:geschichte Braune Schläger greifen Party an Aufrecht gegen Nazis Me e r a n e . Im sächsischen Meera- ne (Landkreis Zwickau) haben in der Nacht zum Sonntag etwa Leben einer »Unverbesserlichen«: Zum Tod der Düsseldorfer Antifaschistin und Kommunistin 30 Neonazis die Gäste einer Maria Wachter Von Hans Daniel Party attackiert. Nach Anga- ben der Polizei überfielen die Rechten gegen 2 Uhr die private b sie stolz sei auf ihr Alter, und anschließender Haft im KZ Ra- Feier von 15 Angehörigen der wurde Maria Wachter gefragt, vensbrück. Davor bewahrte sie die Be- linken Szene. Dabei erlitten Oals sie am 21. April dieses Jah- freiung Mitte April 1945. sieben junge Männer Verletzun- res in Düsseldorf im Kreis von Freun- Wieder in Düsseldorf erlebte sie gen, vier mußten im Kranken- den und Genossen ihren 100. Geburts- bald, daß der Antikommunismus er- haus behandelt werden. Es sei tag beging. Auf ihr Alter sei sie nicht neut zur Staatsdoktrin wurde. Anti- einer der schimmsten Angriffe stolz, dafür könne sie ja nichts. »Aber faschisten wurden aus den Ämtern von Neonazis in Meerane seit ich bin natürlich stolz darauf, jetzt fast gedrängt, 1951 wurde die FDJ verbo- Jahren gewesen, sagte Stadtrat 80 Jahre der Kommunistischen Par- ten, die Vereinigung der Verfolgten Lothar Schilling (Die Linke) tei anzugehören«, sagte Wachter. Im des Naziregimes (VVN) wurde mit am Dienstag gegenüber junge September wollte sie dieses Jubiläum Verbot bedroht. 1956 dann wurde die Welt. Schilling kündigte an, daß feiern. -

Antifa BEILAGE · MÄRZ/APRIL 2010 1 AUS DEN LANDESVEREINIGUNGEN UND MITGLIEDSVERBÄNDEN BRANDENBURG
AUS DEM VERBAND VOM RHEIN BIS ZUR ODER Maria Wachter wird 100 Ein widerständiges Leben Die Ehrenvorsitzende der VVN- Schule in Moskau. Von 1937 bis BdA von NRW Maria Wachter 1939 arbeitete sie in Amsterdam wird 100 Jahre alt. für die Abschnittsleitung West der KPD und reiste in dieser Zeit im- Am 21. April 1910 wurde sie in mer wieder mit gefälschten Papie- Düsseldorf geboren. 1930 wurde ren nach Deutschland, um Wider- sie Mitglied der KPD, seit 1931 standsgruppen im Raum Bielefeld spielte sie in der von Wolfgang zu unterstützen. Langhoff gegründeten Agit-Prop- 1939 wurde Maria in Paris ver- Gruppe »Nordwest-Ran«. Mit die- haftet und in Rieucros interniert. Maria Wachter auf ser Gruppe trat sie auch 1932 vor Nach ihrer Verhaftung durch die einer Delegierten- dem Gebäude des Industrieclubs deutschen Besatzer wurde sie konferenz der VVN- auf, wo Hitler seinen Pakt mit der 1942 in Deutschland mit einer BdA in Düsseldorf Ruhrindustrie schmiedete, um Zuchthausstrafe belegt, die sie im Februar 2008. Krieg und Faschismus vorzuberei- erst im Zuchthaus Anrath absaß; ten. dann wurde sie zur Zwangsarbeit angeordneten Verbringung in das an der Arbeit der VVN-BdA, deren Von 1933 bis 1935 war Maria in einem Rüstungsbetrieb nach KZ Ravensbrück. Mitglieder ihr herzlich zum Geburts- Wachter im illegalen Widerstand Steinhagen in Westfalen ge- Seit Gründung der VVN ist Ma- tag gratulieren und voll Dankbar- in Düsseldorf, dann ging sie von bracht. Die Befreiung im April ria Wachter ihr aktives Mitglied. keit auf ihr Wirken blicken. 1935 bis 1937 auf die Lenin- 1945 rettete sie vor der bereits Sie nimmt bis heute regen Anteil U.S. -

Hannah Arendt's Ghosts: Reflections on the Disputable Path from Windhoek to Auschwitz', Central European History, Vol
Edinburgh Research Explorer Hannah Arendt's Ghosts Citation for published version: Malinowski, S & Gerwarth, R 2009, 'Hannah Arendt's Ghosts: Reflections on the Disputable Path from Windhoek to Auschwitz', Central European History, vol. 42, no. 02, pp. 279-300. https://doi.org/10.1017/S0008938909000314 Digital Object Identifier (DOI): 10.1017/S0008938909000314 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: Central European History Publisher Rights Statement: Malinowski, S., & Gerwarth, R. (2009). Hannah Arendt's Ghosts: Reflections on the Disputable Path from Windhoek to Auschwitz. Central european history, 42, 279-300, doi: 10.1017/S0008938909000314 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 Central European History 42 (2009), 279–300. Copyright # Conference Group for Central European History of the American Historical Association doi:10.1017/S0008938909000314 Printed in the USA Hannah Arendt’s Ghosts: Reflections on the Disputable Path from Windhoek to Auschwitz Robert Gerwarth and Stephan Malinowski If race-thinking were a German invention, as it has been sometimes asserted, then “German thinking” (whatever that may be) was victorious in many parts of the spiritual world long before the Nazis started their ill-fated attempt at world conquest. -

From German South West Africa to the Third Reich. Testing the Continuity Thesis Klaus Bachmann*
Journal of Namibian Studies, 23 (2018): 29 – 52 ISSN: 2197-5523 (online) From German South West Africa to the Third Reich. Testing the continuity thesis Klaus Bachmann* Abstract The connections between the atrocities committed by German colonial forces in German South West Africa and the mass murders perpetrated by Nazi Germany later in Central and Eastern Europe have become an important aspect of the scholarly debate about German colonialism. This article tests several elements of these continuity claims: whether there was elite continuity between the Kaiserreich and the Third Reich, whether formal and informal knowledge about the atrocities in the German colony were available to and used by the Nazi elites and whether the former German colonies played a role in foreign policy strategies of the Third Reich. The author deems it more appropriate to speak about a rupture rather than continuity between colonial elites and the Nazi movement, he argues, that formal knowledge about colonial violence was hardly available to the Nazis and they did not even consult the scarce institutional knowledge which would have been available. Informal knowledge was available but tended to downplay or negate the atrocities and therefore was unsuitable to inform policy makers of the Third Reich. Their main objective in Southern Africa was to pull South Africa out of the British war effort, rather than reconquering their former colonies. Introduction In 1904, the German colonial authorities reacted to uprisings of first the Herero and then the Nama in the South West African colony by resorting to extreme violence. 1 After the Schutztruppe , a special military force created for deployment in the German colonies, had crushed the Herero uprising and forced the Herero to flee into the desert, * Klaus Bachmann is professor of social sciences at SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland. -

Festschrift Für Robert Steigerwald
FESTSCHRIFT FÜR ROBERT STEIGERWALD PHILOSOPHIE UND POLITIK Festschrift für Robert Steigerwald Herausgegeben von Willi Gerns, Hans Heinz Holz, Hermann Kopp, Thomas Metscher und Werner Seppmann in Zusammenarbeit mit der Marx-Engels-Stiftung, Wuppertal Neue Impulse Verlag Der Druck dieses Buches wurde durch zahlreiche Spenden ermöglicht. Die größte ist den langjährigen Freunden Robert Steigerwalds und der Marxistischen Blätter, dem kommunistischen Wissenschaftler-Ehepaar Doris Grieser Marquit und Erwin Marquit aus Minneapolis (Minnesota/USA) zu verdanken, die zweitgrößte der Düsseldorfer Genossin und antifaschis- tischen Widerstandskämpferin Maria Wachter, die am 21. April 2005 in geistiger Frische ihren 95. Geburtstag und ihre 75-jährige Zugehörigkeit zur kommunistischen Bewegung feiert. © 2005 Neue Impulse Verlag GmbH, D-45127 Essen, Hoffnungstr. 18 Fon 0201-24 86 482 • Fax 0201-24 86 484 • [email protected] Alle Rechte vorbehalten Druck: DIP Digital Print, Witten Die Deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich. ISBN 3-910080-56-1 EUR 19.80 (D) INHALT Vorwort S. 9 Robert Steigerwald Fragen, nichts als Fragen S. 13 Renate Wahsner «… der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, …» Gibt es überhaupt Umbrüche in einer Wissenschaft? S. 20 Hermann Klenner «Die Natur hat gewollt…» – kontinuierlichen Krieg oder immerwährenden Frieden? S. 34 Werner Seppmann Abschied von der Dialektik? S. 48 András Gedö Dialektik der Negation oder Negation der Dialektik? Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus S. 64 Alessandro Mazzone Menschenrechte und Rechte der Menschheit S. 86 Manfred Buhr Spekulatives Denken? S. 107 Manuel Kellner Fortschritt zu Höherem? Vorsicht, Falle! Fehler vermeiden mit Hilfe von Stephen Jay Gould S. -

Duke University Dissertation Template
“Colonizers Are Born, Not Made”: Creating a Colonialist Identity in Nazi Germany, 1933-1945 by Willeke Hannah Sandler Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Claudia Koonz, Supervisor ___________________________ Dirk Bonker ___________________________ Tina Campt ___________________________ William Donahue ___________________________ Anna Krylova Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2012 i v ABSTRACT “Colonizers Are Born, Not Made”: Creating a Colonialist Identity in Nazi Germany, 1933-1945 by Willeke Hannah Sandler Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Claudia Koonz, Supervisor ___________________________ Dirk Bonker ___________________________ Tina Campt ___________________________ William Donahue ___________________________ Anna Krylova An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2012 Copyright by Willeke Hannah Sandler 2012 Abstract After the First World War, Germany lost its overseas territories, becoming Europe’s first post-colonial nation. After 1919, and especially between 1933 and 1945, however, German colonialists advocated for the return of these colonies and for their central importance to Germany. This dissertation tells the paradoxical story of these colonialists’ construction of a German national character driven by overseas imperialism despite the absence of a colonial reality to support this identity. In contrast to views of colonialism as marginal in Germany after the First World War or the colonialist organizations as completely subsumed under the Nazi regime, this dissertation uncovers both the colonialist organizations’ continuing public presence and their assertive promotion of their overseas goals in the Third Reich. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 50(2002) Heft 1
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER HANS-PETER SCHWARZ HORST MÖLLER in Verbindung mit Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Manfred Kittel, Udo Wengst, Jürgen Zarusky Chefredakteur: Hans Woller Stellvertreter: Christian Hartmann Assistenz: Renate Bihl Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46b, 80636 München, Tel. 1268 80, Fax 1231727, E-mail: [email protected] 50. Jahrgang Heft 1 Januar 2002 INHALTSVERZEICHNIS AUFSÄTZE Andreas Wirsching Jüdische Friedhöfe in Deutschland 1933-1957 Jan Erik Schulte Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. Die Entstehungsgeschichte von Auschwitz-Birkenau 1941/42 41 Christoph Nonn Das Godesberger Programm und die Krise des Ruhrbergbaus. Zum Wandel der deutschen Sozialdemokratie von Ollenhauer zu Brandt . 71 DISKUSSION Andreas Toppe Besatzungspolitik ohne Völkerrecht? Anmerkungen zum Aufsatz „Rechtspolitik im Reichskommissariat" von Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel 99 II Inhaltsverzeichnis DOKUMENTATION Wolfgang Dierker „Ich will keine Nullen, sondern Bullen". Hitlers Koalitionsverhandlungen mit der Bayerischen Volkspartei im März 1933 111 NOTIZ „Die DDR vor dem Mauerbau: Politik und Gesellschaft". Ein Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte München, Außenstelle Berlin, vom 24. bis zum 26. Oktober 2001 (Henrik Bispinck) 149 ABSTRACTS 157 MITARBEITER DIESES HEFTES 159 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte im Internet: http://www.vierteljahrshefte.de Redaktion: http://www.ifz-muenchen.de GESCHÄFTLICHE MITTEILUNGEN © 2002 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München Die Lieferung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Kostenlose Nachlieferung in Ver lust geratener Sendungen erfolgt nicht. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens zwei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird. Werbeanzeigen und Werbebeilagen besorgt der Verlag.