Landschaften Des Murtenseegebietes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
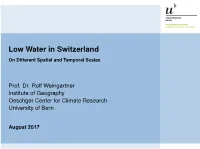
Low Water in Switzerland on Different Spatial and Temporal Scales
Low Water in Switzerland On Different Spatial and Temporal Scales Prof. Dr. Rolf Weingartner Institute of Geography Oeschger Center for Climate Research University of Bern August 2017 Basel – The best location to discuss Swiss hydrology Integral hydrological answer of Northern Switzerland 2 Rhine@Basel: Basics Snow-melt dominated regime. Winter is the low flow season. Data: BAFU Talk: Focus on lowest annual flow over 7 days (AM7). 3 Rhine@Basel: Time series 1870 - 2016 of lowest annual mean flow over 7 days (AM7) Low flows have increased over time. 3 distinct periods. Role of climate and human impact? Daten: BAFU 4 Role of climate AM7 and the correspondent climatic condition After 1950: Increase of warm and wet winters. Weingartner et al. (2006) 5 Human impact – Expansion of Hydro power In winter: Water from artifical storage lakes produces electricity and thus is running off. ! Substantial contribution to natural runoff with significant increase between 1950 and 1970 due to the expansion of storage volumes. (today: net volume 2 km3)! + 120 m3=s. 6 A statistical model puts the influences into perspective Adopted from Weingartner et al. (2007) 7 Rhine 2085: Low flow will occur in summer Drier summer, decreased influence of ice and snow melt. From Zappa et al. 2012, modified 8 The Basel low flow index Years with extreme summer low flows in Basel are years when society and economy are suffering. 1540: > Rhine: 10 % of mean (2003: 50 %) > very low harvest ! starvation > poor water quality ! diseases > limitations everywhere ! aggression in society Source: B. Meyer in Transhelvetica 42 9 Conclusion for Rhine@Basel 1. -

Subaquatic Slope Instabilities: the Aftermath of River Correction And
1 1 Subaquatic slope instabilities: The aftermath of river correction and 2 artificial dumps in Lake Biel (Switzerland) 3 4 Nathalie Dubois1,2, Love Råman Vinnå 3,5, Marvin Rabold1, Michael Hilbe4, Flavio S. 5 Anselmetti4, Alfred Wüest3,5, Laetitia Meuriot1, Alice Jeannet6,7, Stéphanie 6 Girardclos6,7 7 8 1 Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Department of 9 Surface Waters – Research and Management, Dübendorf, Switzerland 10 2 Department of Earth Sciences, ETHZ, Zürich, Switzerland 11 3 Physics of Aquatic Systems Laboratory, Margaretha Kamprad Chair, École 12 Polytechnique Fédérale de Lausanne, Institute of Environmental Engineering, 13 Lausanne, Switzerland 14 4 Institute of Geological Sciences and Oeschger Centre for Climate Change Research, 15 University of Bern, Bern, Switzerland 16 5 Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Department of 17 Surface Waters - Research and Management, Kastanienbaum, Switzerland 18 6 Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, Switzerland 19 7 Institute for Environmental Sciences, University of Geneva, Geneva, Switzerland 20 21 Corresponding author: Nathalie Dubois, [email protected] 22 23 Associate Editor – Fabrizio Felletti 24 Short Title – Mass transport events linked to river correction 25 This document is the accepted manuscript version of the following article: Dubois, N., Råman Vinnå, L., Rabold, M., Hilbe, M., Anselmetti, F. S., Wüest, A., … Girardclos, S. (2019). Subaquatic slope instabilities: the aftermath of river correction and artificial dumps in Lake Biel (Switzerland). Sedimentology. https://doi.org/10.1111/sed.12669 2 26 ABSTRACT 27 River engineering projects are developing rapidly across the globe, drastically 28 modifying water courses and sediment transfer. -

Diagnostic De La Plaine De La Broye Secteur Moudon – Lac De Morat
AQUAVISION ENGINEERING SARL RAYMOND DELARZE HINTERMANN & WEBER SA MANDATERRE 1024 ECUBLENS 1860 AIGLE 1820 MONTREUX 1400 YVERDON BUREAU NICOD+PERRIN 1530 PAYERNE 1510 MOUDON Diagnostic de la plaine de la Broye Secteur Moudon – Lac de Morat Préparé pour : Etat de Vaud - SESA Etat de Fribourg – SLCE Rue du Valentin 10 Rue des Chanoines 17 1014 LAUSANNE 17000 FRIBOURG Renaturation de la Broye – étude préparatoire Renaturation de la Broye – étude préparatoire Table des matières TABLE DES MATIERES Introduction 1 1 Hydrologie de la Broye 3 1.1 Introduction 3 1.2 Données existantes 3 1.3 Références bibliographiques 6 1.4 Annexes 6 2 Hydraulique de la Broye 7 2.1 Introduction 7 2.2 Données existantes 7 2.3 Modélisation 7 2.4 Remise en eau de l’ancienne Broye et stockage des eaux 11 2.5 Points à compléter et propositions de suppléments d’investigation 13 2.6 Références bibliographiques 13 2.7 Annexes 14 3 Transport solide dans la Broye 15 3.1 Introduction 15 3.2 Données existantes 15 3.3 Modélisations et calculs 15 3.4 Analyse des résultats 18 3.5 Points à compléter et propositions de suppléments d’investigation 20 3.6 Références bibliographiques 20 3.7 Annexes 20 4 Morphologie de la Broye 23 4.1 Introduction 23 4.2 Données existantes 23 4.3 Calculs morphologiques 23 4.4 Points à compléter et propositions de suppléments d’investigation 27 4.5 Références bibliographiques 27 4.6 Annexes 27 5 Etude morphologique et historique de la Broye et de sa plaine 29 5.1 Introduction 29 5.2 Méthode 29 5.3 Résultats 31 5.4 Points à compléter et suppléments d’étude -

Gestion Intégrée Des Eaux De La Broye Et Du Seeland Pour L'agriculture
Gestion intégrée des eaux de la Broye et du Seeland pour l'agriculture Frédéric Jordan Marc Diebold Pierre-Alain Sydler Frédéric Ménétrey Peter Thomet Hydrique Ingénieurs ch. du Rionzi 54 CH- 1052 Le Mont-sur Lausanne www.hydrique.ch Switzerland [email protected] 1 LE PROJET IWM SEELAND-BROYE GBGE 2018 - UNIL Gestion intégrée des eaux de la Broye et du Seeland pour l’agriculture 2 CADRE DU PROJET . Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014-2018 L'objectif de ce projet est de favoriser une gestion intégrée des ressources en eau de la région Broye-Seeland. Cela doit être atteint en considérant tous les acteurs et en favorisant le maintien d'une agriculture productive dans la région, malgré les changements climatiques à venir. Financement Pro Agricultura Seeland (porteur du projet) Cantons de Vaud, Fribourg, Berne (services : agriculture, eau) WWF Union des Paysans Fribourgeois, Prométerre, Berner Bauern Verband GBGE 2018 - UNIL Gestion intégrée des eaux de la Broye et du Seeland pour l’agriculture 3 PERIMETRE DU PROJET 3 cantons 167 communes 330'000 habitants 1'178 km2 GBGE 2018 - UNIL Gestion intégrée des eaux de la Broye et du Seeland pour l’agriculture 4 2 PROBLEMATIQUE EAU-AGRICULTURE SEELAND - BROYE GBGE 2018 - UNIL Gestion intégrée des eaux de la Broye et du Seeland pour l’agriculture 5 L’EAU 4 lacs (Neuchâtel, Bienne, Morat, Schiffenen) 2 cours d'eau de régime nivo- glaciaire (Aar et Sarine) Nombreux cours d'eau pluvio- nivaux (Broye, Bibera, Chandon, Arbogne, Petite Glâne,…) Nombreux canaux dans le Nord -

Le Grand Oeuvre De Hanni Schwab
Article Le grand oeuvre de Hanni Schwab KAENEL, Gilbert Abstract L'archéologue cantonale fribourgeoise, Hanni Schwab (1922-2004) est tout d'abord enseignante avant d'être nommée en 1962 responsable des recherches archéologiques lors de la deuxième correction des eaux du Jura. Elle découvre deux sites de notoriété internationale: l'habitat de Châtillon-sur-Glâne et l'oppidum du Mont Vully. Professeur d'archéologie à l'Université de Fribourg, elle est l'auteur de plus de 170 publications. Reference KAENEL, Gilbert. Le grand oeuvre de Hanni Schwab. Annales fribourgeoises, 2003, vol. 2002/2003, p. 262-265 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:116891 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 262 LE GRAND ŒUVRE DE HANNI SCHW AB Hanoi Schwab, Archéologie de la 2e Currectio11 des eaux du Jura, vol. 3 et 4. Les travaux archéologiques liés à la 2e Correction des eaux du Jura (CEJ), qui avait pour but de réguler les niveaux des lacs et ainsi d'empêcher de nouvelles inon dations, ont débuté au printemps 1962. Ils se sont succédé sur le terrain jusqu'en 1969. Le premier volume de la série Archéologie de la 2e Correction des eaux du Jura, de la collection «Archéologie fribourgeoise» publiée par le Service archéologique cantonal, a paru il y a treize ans (Les Celtes sur la Broye et la Thielle, AF 5, 1990); le deuxième, il y a quatre ans (Les premiers paysans sur le Broye et la Thielle, Al' 14, 1999). Le volume 5, consacré aux périodes médiévales, esl en prépa ration. -

Hydrological Yearbook of Switzerland 2015
2016 > State of the environment > Hydrological data > Hydrological Yearbook of Switzerland 2015 Discharge, water level and water quality of the Swiss water bodies > Hydrological Yearbook of Switzerland 2015 FOEN 2016 2 Contents Foreword 3 Abstracts 4 Summary 5 1 Notable phenomena in 2015 6 Impressum 2 Weather conditions 13 Issued by Federal Office for the Environment (FOEN) The FOEN is an office of the Federal Department of 3 Snow and glaciers 14 the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC). Authors FOEN Hydrology Department 4 Rivers and lakes 16 Weather: Federal Office for Climatology and Meteorology (MeteoSwiss) Snow: WSL Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) Glaciers: Department of Geosciences, University of Fribourg, 5 Groundwater 32 and Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW) Suggested form of citation FOEN (ed.) 2016: Hydrological Yearbook of Switzerland 2015. Annex 34 Federal Office for the Environment, Bern. Environmental Status no. UZ-1617-E: 36 p. Editing Jacqueline Dougoud, Zurich Translation James Morris Design Magma – die Markengestalter, Bern Cover picture A torrent pouring out of the Faverges glacial lake (Glacier de la Plaine Morte) at the beginning of August 2015. Photo: Matthias Huss, Department of Geosciences, University of Fribourg Photo credits Page 15: Matthias Huss, Department of Geosciences, University of Fribourg Data basis The hydrological analyses are based on provisional data for 2015. PDF-download www.bafu.admin.ch/uz-1617-e A printed version is not available. This publication is also available in French, German and Italian. Further information and data at www.foen.admin.ch/water © FOEN 2016 > Foreword 3 Foreword The hydrological year 2015 was marked by two significant but very different hydro logical events: a week of serious floods from late April to early May and then a long warm and very dry period lasting from the spring until the winter of 2015/16. -

ESPON ACTAREA Swiss Spatial Strategy and Action Areas
This targeted analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Erik Gløersen, Nathalie Wergles, Clément Corbineau and Sebastian Hans, Spatial Foresight (Luxembourg) Tobias Chilla and Franziska Sielker, Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg (Germany) Jacques Félix Michelet and Lauranne Jacob, University of Geneva, Hub of Environmental Governance and Territorial Development (GEDT) (Switzerland)) Advisory Group Project Support Team: ESPON EGTC: Sandra di Biaggio Acknowledgements The authors would like to thank to Steering group composed of the Swiss Federal Office for Spatial Development (ARE), the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure and the International Spatial Development Commission "Bodensee” (Lake Constance) for the stimulating dialogue throughout the duration of the project. Stakeholders of case study areas and survey respondents have also provided precious inputs, without which the present report could not have been produced. Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2017 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. -
Murten - Enjoy It the City by the Lake
ENGLISH VERSION Murten - Enjoy It The City by the Lake Attractions Citymap Events Old Town History Excursions www.murtentourismus.ch English Information TOURIST OFFICE Murten Tourismus Franz. Kirchgasse 6 PO Box 210 3280 Murten Tel. +41 (0)26 670 51 12 Fax +41 (0)26 670 49 83 [email protected] www.murtentourismus.ch Opening Hours: April until Sept. Mon-Fri: 9:00-12:00 and 13:00-18:00 Sat-Sun, Holidays: 10:00-12:00 and 13:00-17:00 Oct. until March: Mon-Fri: 09:00-12:00 and 14:00-17:00 Guided Tours The tourist information office offers a wide choice of guided tours. Contact us for more information. www.murtentourismus.ch/tours Signs and QR-Codes On the tour, you’ll see signs with QR codes which direct you to the Internet page, relating to the specific tourist attraction or monument you are viewing. The QR codes can be read with your smartphone. www.murtentourismus.ch/qr Welcome 1 Its relaxing atmosphere and mild climate lends a Mediterranean feeling to this historic medieval town, in the heart of Switzerland. Whether you stop off in one of the cafés or stroll along the lake, Murten shall certainly be a grand experience. Have a nice city tour! Morat in French or Murten in German Bilingualism is an important element of Morat’s/Murten’s identity. About 76% of the population is German speaking and 13% is French speaking. Throughout the ages, the region has been a bridge between languages and cultures. In the Heart of a Beautiful Region Murten is the Lake District’s main town, in the canton of Fribourg. -

Área Temática Del Congreso
Thematic Areas Evolution of a restored river course and alternative measures to correct unintended effects Evolución del curso de un río restaurado y medidas alternativas para corregir los efectos no deseados Giovanni De Cesare Dr es Sciences techn., President of the Swiss Association of Soil Bioengineering, EPFL ENAC LCH, Station 18, CH-1015 Lausanne, Switzerland, [email protected] Sebastian Schwindt PhD Student, EPFL ENAC LCH, Station 18, CH-1015 Lausanne, Switzerland, [email protected] Stéphane Giroud Senior Engineer, sd ingénierie fribourg sa, rte des Daillettes 21 / CP 139, CH-1705 Fribourg, Switzerland, [email protected] Alain Maibach Dr es Sciences UNIL, Bureau A. Maibach Sàrl - Etudes en environnement, ch. de la Poya 10 / CP 99, CH-1610 Oron-la-Ville, Switzerland, [email protected] Anne Litsios-Dubuis Dr es Sciences UNIL, Bureau A. Maibach Sàrl - Etudes en environnement, ch. de la Poya 10 / CP 99, CH-1610 Oron-la-Ville, Switzerland, [email protected] Key words: compensation measure, river restoration, bed load, suspended load, vegetation growth, restoration matrix Resumen En los años 1967 a 1970, se llevó a cabo una serie de importantes trabajos de canalización con una fuerte alineación y construcción de escolleras en el río Arbogne, ubicado en el cantón de Friburgo, Suiza. Esta intervención era objetivamente necesaria debido a las inestabilidades del lecho del río, así como a su capacidad hidráulica insuficiente, lo que lleva a frecuentes inundaciones en edificios y tierras de cultivo cercanas. Treinta años más tarde, una revisión 1 European Federation of Soil and Water Bioengineering Asociación Española de Ingeniería del Paisaje del perfil río del Arbogne mostró una cantidad significativa de depósitos de sedimentos que cubren parcialmente el perfil inicial, reduciendo considerablemente la capacidad hidráulica. -

Irrigation Seeland-Broye
Irrigation Seeland - Broye (ISB) Prévision online des besoins et ressources en eau pour l'irrigation Rapport final Juin 2016 e-dric.ch eau énergie environnement Agroscope Ch. du Rionzi 54 Groupe de recherche Climat/Hygiène de l’air CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Reckenholzstrasse 191 [email protected] CH - 8046 Zürich Tél : 021 784 33 13 e-dric.ch / Agroscope Rapport final ISB Projet mis en œuvre dans le cadre du programme pilote Adaptation aux changements climatiques, soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. Seuls les auteurs du rapport portent la responsabilité de son contenu. Version 1.003 Document M13_023_001_Rapport_ISB.docxs Date 12.04.2017 Auteurs M. Thomet, F. Jordan, J. Fuhrer Distribution Partenaires du projet M13_023_001_Rapport_ISB.docx/MT/FJ/JF 12.04.2017 1/42 e-dric.ch / Agroscope Rapport final ISB Contenu 1 PRÉAMBULE ................................................................................................................................................... 3 2 INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 3 2.1 OBJECTIF DU PROJET .................................................................................................................................. 3 2.2 MÉTHODOLOGIE ......................................................................................................................................... 4 3 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ................................................................................................................................ -

Contraintes Et Opportunités Pour L'irrigation En Général Et Dans La
Contraintes et opportunités pour l’irrigation en général et dans la région des 3 lacs EAU Philippe Hohl – DGE/DIRNA/EAU – SVAF 22 novembre 2019 - Prélèvements actuels – Restrictions - Région des 3 lacs Cas de la plaine de la Broye et de l’Orbe - Où prélever de l’eau dans le futur ? - Conclusions Philippe Hohl – DGE/DIRNA/EAU – SVAF 22 novembre 2019 Prélèvements d’eau autorisés dans le canton Pompages - Arrosages et autres prélèvements Pompage – arrosage Env. 390 Autres Env. 450 3 Prélèvements d’eau autorisés dans le canton Provenance de l’eau Lacs/Nappes/Rivières Aux Lacs Env. 150 Dans les Nappes Env. 140 En Rivières Env. 100 4 Prélèvements d’eau autorisés dans le canton Restrictions en rivières Département, Service Nom de la présentation 16 novembre 5 2019 Prélèvements d’eau autorisés dans le canton Périodes de restriction ANNEE INTERDICTION FIN D'INTERDICTION JOURS 1998 08.08.1998 18.09.1998 42 1999 - - 0 2000 - - 0 2001 - - 0 2002 - - 0 2003 05.07.2003 30.10.2003 118 Sur les 22 2004 04.08.2004 07.09.2004 35 2005 20.08.2005 30.09.2005 42 dernières 2006 29.07.2006 15.09.2006 49 années 13 2007 - - 0 2008 - - 0 années avec 2009 22.08.2009 21.11.2009 92 2010 18.07.2010 03.12.2010 139 restrictions…. 2011 04.05.2011 02.12.2011 213 2012 29.08.2012 19.10.2012 52 2013 - - 0 2014 - - 0 2015 17.07.2015 02.10.2015 78 2016 - - 0 2017 22.07.2017 24.11.2017 126 2018 17.07.2018 19.12.2018 156 2019 09.07.2019 05.11.2019 120 Département, Service Nom de la présentation 16 novembre 6 2019 Région des 3 lacs Correction des eaux du jura 1ère correction 2ème correction 1 : canal de la Thielle 2 : canal de la Broye 3 : canal de Hagneck 4 : canal de Nidau-Büren 7 Région des 3 lacs - Correction des eaux du jura Effet des 2 Corrections des eaux du jura sur le niveau des 3 lacs – Exemple lac de Neuchâtel 8 Région des 3 lacs - Correction des eaux du jura modification de la 2ème correction des eaux du Jura en vigueur. -

Bienvenue Dans Le Canton De Fribourg — Français/Langage Simplifié
Bienvenue dans le canton de Fribourg — Français/Langage simplifié Introduction Le livre « Bienvenue dans le canton de Fribourg » est utile aux personnes qui arrivent dans le canton. Il donne aux nouveaux habitants des informations et des adresses sur la vie à Fribourg. « Bienvenue dans le canton de Fribourg » existe déjà en 10 langues. Ce livre est une 11e version, en français facile à lire et à comprendre. On appelle cela le Langage simplifié. Pourquoi le Langage simplifié ? Le Langage simplifié est utile à tout le monde. Il peut aider : • les personnes qui ont des difficultés de lecture • les personnes qui viennent d’un autre pays et qui ne savent pas encore bien le français Les textes traduits par le bureau Langage simplifié portent un label. Le label « Langage simplifié » veut dire que : • le bureau Langage simplifié a respecté les règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre (falc) • les relecteurs qui ont des difficultés de lecture ou qui sont de langue étrangère comprennent le texte falc Ce livre a un niveau de français A2. Qui a participé à la traduction ? • Le Bureau Langage simplifié de Pro Infirmis : Catherine Charpié avec le groupe de relecture : Mokhtar Amiri, Azizullah Hosseini, Sébastien Jelk, Rigzin Yang Nyikhang, Christelle Roulin, Merkeb Tsige, Gaëlle Uruty, Bertrand Wieilly • Le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR : Samuel Jordan et Carine Maradan • Le bureau de graphisme So Graphic Studio : Sylviane Girod 3 Contenu page 1. Bienvenue à vous ............................................................... 6 2. Comment utiliser ce livre .................................................... 8 3. Vivre ensemble à Fribourg .................................................