Managementplan Rosengarten-Latemar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

F.I.S.I. - Landeswintersportverband Südtirol - Ergebnisse
F.I.S.I. - Landeswintersportverband Südtirol - Ergebnisse http://www.fisi.bz.it/de/ergebnisse/?sp=1&sa=11&cu=35&ra... Home / Ergebnisse ERGEBNISSE Hier finden Sie alle Ergebnisse und Punktestände auf einen Blick. Treffen Sie ganz einfach und schnell in den folgenden Suchfeldern Ihre Wunschauswahl. So können Sie gezielt nach Ihren Bedürfnissen Filtern und gelangen so zum gewünschten Ergebnis. SPORTART SKI ALPIN SAISON 2011/2012 MEISTERSCHAFT - Finale Starterliste Rennergebnisse RENNEN EA025 - 18.03.2012 - Solda/Sulden - ZONE I (Finale) KATEGORIE/GESCHLECHT KINDER 2 - weiblich Ergebnis anzeigen Punktestand nach Kategorien VSS - FINALE - Riesentorlauf Renn-Code EA025 Kategorie KINDER 2 Kontakt Interner Code P1 Geschlecht weiblich ASV PRAD Datum 18.03.2012 Zone ZONE I Kiefernhainweg 39 Ort/Piste SOLDA - MADRICCIO Kampfrichter 39026 Prad a. Stilfserjoch 1a (05/107/AA/A_1) Meisterschaft VSS KINDERMEISTERSCHAFT 3407387390 Disziplin GS Organisator ASV PRAD [email protected] Wetterbed. NEVOSO Schneekond. COMPATTA Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte 1. HA5CM AUER Laura 2001 ASV TZ GITSCHBERG-JOCHTAL 55.17 - 2. EAHAM PARIS Tamara 2001 AWSV ST. PANKRAZ 56.09 - 3. LA1KA GANNER Theresa 2001 SC MERAN - RAIKA MERAN 57.04 - 4. LA1XL KUPPELWIESER Lisa 2001 SC MERAN - RAIKA MERAN 57.50 - 5. FA01P PRANTL Nadine 2001 ATZV VINSCHGAU 57.93 - 6. FAA2E FEICHTER Sabine 2001 AWSV INNICHEN 57.98 - 7. HA49J NOGLER KOSTNER Nicole 2001 SKI CLUB GRÖDEN SASLONG 58.05 - 8. LA9T0 DELAGO Elena 2001 SKI CLUB GRÖDEN SASLONG 58.14 - 9. LA8Z4 KRITZINGER Jana 2001 ASV VÖLS 58.24 - 10. LA8L7 PELLIZZARI Jamie-lee 2001 SKI CLUB GRÖDEN SASLONG 58.44 - 11. HAH84 SANTER Nicol 2001 ASK SCHNALSTAL 58.97 - 12. -

Auditierte Bibliotheken 2004-2020
Auditierte Bibliotheken 2004-2020 2020 Öffentliche Bibliothek Villanders Öffentliche Bibliothek Barbian Öffentliche Bibliothek Prad am Stilfserjoch Öffentliche Bibliothek Deutschnofen Amt für Bibliotheken und Lesen Öffentliche Bibliothek Kurtatsch Bibliotheksverband Südtirol/BVS-BIB Öffentliche Bibliothek Sarnthein Öffentliche Bibliothek Kurtinig Öffentliche Bibliothek Welsberg Öffentliche Bibliothek Pfalzen Öffentliche Bibliothek Altrei Öffentliche Bibliothek Tiers Öffentliche Bibliothek Andrian Öffentliche Bibliothek Terenten Öffentliche Bibliothek Rodeneck Öffentliche Bibliothek Lajen Öffentliche Biblithek Aldein Öffentliche Bibliothek Welschnofen Öffentliche Bibliothek Ritten Öffentliche Bibliothek Marling Öffentliche Bibliothek Margreid Öffentliche Bibliothek Martell Öffentliche Bibliothek Jenesien mit der Zweigstelle Afing Öffentliche Bibliothek Sexten Bücherei am Dom Öffentliche Bibliothek Taufers im Münstertal Öffentliche Bibliothek Schluderns Stadtbibliothek Bruneck Öffentliche Bibliothek Vintl mit den Zweigstellen Obervintl, Weitental und Pfunders Öffentliche Bibliothek Mölten Öffentliche Bibliothek Villnöß mit der Zweigstelle Teis Öffentliche Bibliothek Vöran Öffentliche Bibliothek St. Georgen 2019 Öffentliche Bibliothek Schenna Öffentliche Bibliothek Mals Öffentliche Bibliothek Naturns Öffentliche Bibliothek Ulten mit der Zweigstelle St. Nikolaus Öffentliche Bibliothek Rasen-Antholz mit der Zweigstelle Mittertal Öffentliche Bibliothek Girlan Öffentliche Bibliothek Riffian Stadtbibliothek Brixen Öffentliche Bibliothek Klausen -
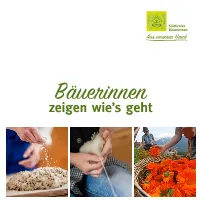
Zeigen Wie's Geht
Südtiroler Bäuerinnen Aus unserer Hand zeigenBäuerinnen wie’s geht Inhaltsverzeichnis Aus unserer Hand abS.4 DieMarkederSüdtirolerBäuerinnenorganisation Kulinarik abS.6 >Koch-undBackkurse >Buffetservice >Produktvorstellung Handarbeit und Dekoration abS.14 >Handarbeitskurse >Dekorationskurse Kultur und Natur abS.20 >Gartenführungen >Naturführungen Schule am Bauernhof abS.26 Sozialgenossenschaft „Mit Bäuerinnen lernen – wachsen – leben“ abS.28 Unsere Bäuerinnen abS.30 Anmeldeinformationen abS.48 Warum Kunden unsere Bäuerinnen empfehlen abS.50 IMPreSSuM Herausgegeben imOktober2013vonderSüdtirolerBäuerinnenorganisation K.-M.-Gamper-Straße5|39100Bozen 1.Auflage Konzept,TexteundAbwicklung:VerenaNiederkofler,Christineeisenstecken,MonikaPircher,ulrikeTonner,KathrinPsenner Fotos:FlorianAndergassen,roterHahn/FriederBlickle,OthmarSeehauser,JensMartinKlocke,Hiltrauderschbaumer,SüdtirolerBäuerinnenorganisation,Shutterstock Gesamtherstellung:effekt!GmbH DieseBroschüreisterhältlichbeider SüdtirolerBäuerinnenorganisation K.-M.-Gamper-Straße5|39100Bozen Tel.0471999460 [email protected] www.baeuerinnen.it Wirdankenfürdieunterstützung Wir Bäuerinnen zeigen wie’s geht! JederTrenderzeugteinenGegentrend:jestärkerder HierstehtdiegeschulteBäuerinalsAkteurinimMit- MenschdieGlobalisierungspürt,destomehrgewinnt telpunkt,dieBäuerinalsPersönlichkeit,mitihrem imGegenzugdie RegionalitätanBedeutung.Viele Wissen,ihremKönnenundihrenFertigkeiten. MenschensehnensichindieserschnelllebigenZeit WirBäuerinnensindvielfältig,innovativundtraditi- zurückzuihrenWurzeln,nach Entschleunigungoder -

Jahresstatistik 2016
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung Azienda provinciale foreste e demanio Jahresbericht 2016 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Seite / Pag. 2 Die Gesamtfläche beträgt 75.164,2184 ha. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 0,1706 ha verkauft. Davon betroffen sind 4 Gemeinden: Moos i. P., Schnals, Stilfs und Wolkenstein. Gemeinde Comune ha Gemeinde Comune ha ABTEI BADIA 762,8542 RASEN ANTHOLZ RASUN ANTERSELVA 1.251,3573 AHRNTAL VALLE AURINA 3.334,8489 RATSCHINGS RACINES 2.843,9205 ALDEIN ALDINO 33,2712 RITTEN RENON 8,2436 BOZEN BOLZANO 4,3299 RODENECK RODENGO 30,2189 BRENNER BRENNERO 819,2330 SAND IN TAUFERS CAMPO DI TURES 4.044,5379 BRIXEN BRESSANONE 159,5872 SARNTAL SARENTINO 376,5100 CORVARA (KURFAR) 982,0411 SCHENNA SCENA 247,9791 DEUTSCHNOFEN NOVA PONENTE 310,7757 SCHLANDERS SILANDRO 1.349,4886 DORF TIROL TIROL 64,3653 SCHLUDERNS SLUDERNO 17,6725 ENNEBERG S. VIGILIO DI MAREBBE 4.236,8756 SCHNALS SENALES 3.082,5571 FRANZENSFESTE FORTEZZA 353,4382 SEXTEN SESTO 1.787,0609 FREIENFELD CAMPO DI TRENS 381,0655 ST. CHRISTINA S.CRISTINA 835,0750 GRAUN I. VINSCHGAU CURON VENOSTA 1.446,4953 ST. LEONHARD I.P .S. LEONARDO I.P. 484,5585 GSIES VALLE DI CASIES 31,8638 ST. MARTIN I.P. S. MARTINO I.P. 23,8746 INNICHEN SAN CANDIDO 1.200,4843 ST. MARTIN IN THURN S.MARTINO IN BADIA 635,5737 KASTELBELL CASTELBELLO 0,2106 ST. PANKRAZ S. PANCRAZIO 104,0931 KASTELRUTH CASTELROTTO 434,5718 STERZING VIPITENO 75,8055 KLAUSEN CHIUSA 12,8338 STILFS STELVIO 6.784,3510 LAAS LASA 1.861,6736 TAUFERS IM MÜNSTERTAL TUBRE 605,2607 LAJEN LAION 294,2693 TERLAN TERLANO 7,4104 LATSCH LACES 578,3619 TIERS TIRES 519,5271 MALS MALLES 5.832,4649 TOBLACH DOBBIACO 2.124,3237 MERAN MERANO 3,4750 TRAMIN TERMENO 31,5682 MOOS I. -

Reisemagazin Südtirol
Nr. 164 .ADAC B 2149 F SÜDTIROL SÜDTIROL REISEMAGAZIN € 8,95 (D); € 9,95 (A) CHF 15,80 Mai / Juni 2018 Südtirolist doppelt schön Naturpark Drei Zinnen: Autotour Stadtgespräche Hochgenuss Mit Lamas Vom Reschenpass bis zur Meran und Bozen Das Beste aus zwei Welten: über Sella Ronda: Eine Fahrt über zeigen sich Alpine Küche trifft auf den Berg die schönsten Bergstraßen urban und modern italienische Leichtigkeit REISEMAGAZIN € 9,95 (BeNeLux, I, E, F) 00164 å∂åç 4 198001 308952 Info Kulinarik Hochgenuss. Vom Bauernhof bis zum Deutschnonsberg, dem Hoch- Die Weinkarte umfasst 400 Kral Hofmanufaktur Gourmetlokal lässt sich in Südtirol ausgezeichnet plateau zwischen Meran und verschiedene Etiketten, die Nach dem Motto „Hier bin Bozen. Auf dem hauseigenen urigen Zirbelstuben in dem ich Schwein, hier darf ich’s speisen. Und das gilt für alle Höhenlagen Bauernhof wird das Laugen- Bauernhof von 1581 bilden sein“ hat der Autodidakt rind, eine Grauviehrasse, art- den passenden Rahmen. Mario Kral auf dem Unter- gerecht gehalten. Gut speisen 39020 Schnalstal, Raindl 49 kranzerhof eine artgerechte lässt sich auch in Bistro, Tel. +39 / 04 73 67 91 31 Schweinehaltung aufgebaut. ESSEN AUF DEM BERG Gerichte vom Villnösser Weinbar und Gastgarten. Menü mit 5 Gängen: 55 € Sein Sohn Benjamin hat sich Brillenschaf auf. Die älteste 39010 St. Felix, Malgasottstr. 2 Geöffnet Do.–Di. 12–14 und überdies die Herstellung von 1524 Schafrasse Südtirols hat ih- Tel. +39 / 04 63 88 61 05 18–21 Uhr (C 3) Coppa, Würsten sowie bes- Aus dem schicken, verglasten, ren Namen von den schwar- Geöffnet April–Oktober und www.oberraindlhof.com tem Speck beigebracht, der 2017 eröffneten Restaurant zen Augenringen (s. -

Autonome Provinz Bozen
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Landesrätin für Raumentwicklung, Landschaft Assessora allo Sviluppo del territorio, al paesaggio und Denkmalpflege ed ai beni culturali An die Landtagsabgeordneten Sven Knoll Bozen/Bolzano, 27.02.2020 Myriam Atz Tammerle Landtagsklub Süd-Tiroler Freiheit Bearbeitet von/redatto da: Silvius-Magnago-Platz 6 Alexandra Strickner 39100 Bozen BZ [email protected] Ulrike Lanthaler [email protected] [email protected] Zur Kenntnis: An den Präsidenten des Südtiroler Landtags Josef Noggler Silvius-Magnago-Platz 6 39100 Bozen BZ [email protected] Beantwortung der Landtagsanfrage Nr. 653/2020 – Ensembleschutz – Wie ist der Stand? Sehr geehrter Herr Knoll, sehr geehrte Frau Atz Tammerle, in Beantwortung Ihrer im Betreff angeführten Anfrage teile ich wie folgt mit: 1. In welchen Gemeinden konnte bislang die Erstellung des Ensembleschutzplanes abgeschlossen werden? Insgesamt 60 Gemeinden haben zum 25. Februar 2020 die Ensembleschutzliste erstellt und die Bereiche im Bauleitplan eingetragen: Aldein, Andrian, Auer, Bozen, Branzoll, Brixen, Bruneck, Corvara, Eppan, Feldthurns, Gargazon, Graun im Vinschgau, Innichen, Kaltern, Kastelruth, Kiens, Klausen, Kurtatsch, Kurtinig, Lana, Latsch, Leifers, Lüsen, Mals, Margreid, Marling, Meran, Montan, Mölten, Mühlbach, Neumarkt, Niederdorf, Olang, Partschins, Percha, Pfalzen, Prad am Stilfserjoch, Rasen – Antholz, Ratschings, Riffian, Ritten, Salurn, Schenna, Schlanders, Schluderns, Sexten, Sterzing, St. Lorenzen, St. Christina Gröden, St. Ulrich, Taufers in Münster, Terlan, Tirol, Toblach, Tramin, Truden, Tscherms, Vahrn, Vintl, Völs am Schlern und Wolkenstein. Darunter scheinen auch Gemeinden auf, die lediglich einen Teil der ausgearbeiteten Ensembles im Gemeinderat beschlossen haben; ebenso dürfen Gemeinden, die Ensembles bereits ausgewiesen haben, jederzeit neue Vorschläge bringen. 2. -

Autonome Provinz Bozen
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im ACPAD IGE - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Lieferaufträge EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture Lieferungen Kode der Ausschreibung Codice gara AOV/SUA-SF 042/2016 AOV/SUA-SF 042/2016 Erkennungskode CIG: 679176234E Codice CIG: 679176234E OFFENES VERFAHREN PROCEDURA APERTA ÜBER EU- SCHWELLE SOPRA SOGLIA EUROPEA FÜR DIE DIENSTLEISTUNG PER IL SERVIZIO FÜR DIE SAMMLUNG VON REST- UND PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI BIOMÜLL IN 13 GEMEINDEN DER URBANI E DI RIFIUTI ORGANICI IN 13 BEZIRKSGEMEINSCHAFT SALTEN – COMUNI DELLA COMUNITÀ SCHLERN SOWIE DIE ENTLEERUNG DER COMPRENSORIALE DI SALTO – SCILIAR E WERTSTOFFCONTAINER (GLAS UND LO SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI PAPIER) IN DEN GRÖDNER GEMEINDEN UND PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DIE TECHNISCHE UND (VETRO E CARTA) NEI COMUNI DELLA VERWALTUNGSMÄSSIGE FÜHRUNG SOWIE VAL GARDENA NONCHÉ LA GESTIONE DIE WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DER TECNICA E AMMINISTRATIVA E LO RECYCLINGHÖFE PONTIVES UND LA POZA SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI CENTRI DI RACCOLTA PONTIVES E LA POZA Klarstellung Nr. 3 Chiarimento n. 3 Wir haben die Notwendigkeit einen Abbiamo la necessità di effettua re un Lokalaugenschein durchzuführen, um die sopralluogo per analizzare sul posto la specifica spezifische Situation zu analysieren. Wir möchten situazione. Vorremmo sapere quando è wissen, wann es möglich ist ein Treffen mit eurem possibile organizzare l'incontro con un Vs. Verantwortlichen zu organisieren, um unsere responsabile, al fine di poter programmare la Abfahrt einzuplanen. -

Liegenschaften
Autonome Provinz Bozen-Südtirol - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung – Azienda Provinciale Foreste e Demanio LIEGENSCHAFTEN DES LANDESBETRIEBES FÜR FORST- UND DOMÄNENVERWALTUNG alfabetisch geordnet nach Gemeinden und Katastralgemeinden Stand: 31.12.2015 Erklärungen zum Parzellenverzeichnis: a) Verzeichnis der Grundparzellen Nutzung (5 Kategorien) : Wald (überwiegende Bestockung mit forstlichen Gehölzen) Forstgarten Wiese (überwiegend mähbares Grünland) Weide (überwiegend Grünland mit guter Weideeignung) unproduktiv (Gletscher, Felsen, wenig weidegeeignetes hochalpines Grün, versiegelte Flächen wie Plätze und Straßen) Bewertung der Liegenschaften: Wert/m² [€] – Klassifizierung nach qualitativen Merkmalen (Nutzung und Nutzungsintensität): 1,50 €/m² für sehr ertragreiche Wälder (1. Klasse) und Forstgärten 1,00 €/m² für mittlere Wälder (2. Klasse) und Wiesen 0,50 €/m² für mäßig ertragreiche Wälder (3. Klasse) und Weiden 0,30 €/m² für nicht oder kaum nutzbare Wälder (4. Klasse) 0,20 €/m² für unproduktive Flächen, welche sich als extensive Weiden für Schafe oder Ziegen eignen bzw. gute Lebensräume für Schalenwild darstellen; Gewässer, andere unproduktive Flächen in der Talsohle 0,01 €/m² für unproduktive Flächen wie Gletscher, Felsen, kaum bewachsene Hochgebirgsflächen Hinweis: für unproduktive Flächen, welche als Plätze oder Straßen genutzt werden, wird der m²-Wert der angrenzenden Grundstücke herangezogen Wert tot. [€] – ergibt sich aus dem m²-Wert multipliziert mit der Fläche der Grundparzelle Erschließung (3 Kategorien für die Nutzungstypen Wald, Wiese und Weide): 1 gut 2 mäßig 3 unerschlossen b) Verzeichnis der Bauparzellen Bezeichnung: Name, Beschreibung der Bauparzelle und deren Nutzung Wert tot. [€]: Grundstückswert (in der Regel 50 €/m² ) und Gebäudeschätzwert (wenn die Infrastruktur in Konzession gegeben ist, wird kein Wert berechnet) Aktualisierung: Änderungen durch Erwerb oder Veräußerung erfolgen im Parzellenverzeichnis erst nach entsprechendem Beschluss der Landesregierung. -

„Von Bleibendem Wert“ – Dorfbücher in Südtirol
2 Teil Buch (169–272).qxd 06.09.2004 16:36 Uhr Seite 227 „Von bleibendem Wert“ – Dorfbücher in Südtirol Leo Hillebrand Obwohl Dorfbücher eine unübersehbare Realität auf dem Südtiroler Büchermarkt darstellen und jährlich ein erheblicher Teil der Kulturförde- rung zu ihrer Publikation aufgewendet wird, fand bisher kaum eine brei- tere Diskussion zum Thema statt. In Fachkreisen fristet es ein stiefmütter- liches Dasein, in den Medien taucht es zwar regelmäßig auf, jedoch kaum unter dem Aspekt einer kritischen Sichtung des Bestandes bzw. Prüfung einschlägiger Tendenzen. Neben Gefälligkeitsberichten zu Neuerschei- nungen fanden bevorzugt personalpolitische Querelen zwischen Heraus- gebern und Autoren Raum. Das Thema wurde bislang auch von Dissertanten und Diplomanden gemieden, zumal im höchsten Maße arbeitsaufwändig. Die schlüssige Beantwortung von Fragen wie: Unter welchen wirtschaftlichen und sozia- len Rahmenbedingungen entstehen Dorfbücher in Südtirol? Wie gestaltet sich das Verhältnis der Redaktionen zu den Gemeindeverwaltern? Welche Rolle spielen die Bildungsausschüsse, wie bedeutsam ist die Einzelinitiative? oder auch die Frage nach der effektiven Akzeptanz dieser Publikationen in der Bevölkerung setzten aufwändige Untersuchungen voraus. Folgende Ausführungen bewegen sich in Ermangelung entsprechen- der Forschungsergebnisse notgedrungen auf prekärer, weil im Wesentli- chen auf einzelnen Beobachtungen basierender Grundlage. Der Beitrag kann also allenfalls ein Impuls für vertiefende Auseinandersetzungen mit dem Thema sein. 1. Die Jahrzehnte der Dorfbücher Die 80er und 90er Jahre könnten als die Jahrzehnte der Dorfbücher in die lokale Kulturgeschichte eingehen. Das Label „Dorfbuch“ entfaltete eine unübersehbare Attraktivität. Auch Publikationen, die im Grunde andere Schwerpunkte setzten, schmückten sich gerne damit: das Buch über sakrale Objekte in Laurein von Edmund Ungerer etwa, oder, noch markanter, die um einige Aspekte erweiterte Neuauflage der Biographie Franz Xaver Mitterers von Walter Marzari. -

Highlights and Accommodations 2019
Highlights and accommodations 2019 Ski & holiday area Gitschberg Jochtal Rio di Pusteria, Maranza/Gitschberg, Valles/Jochtal, Spinga, Vandoies/Vallarga/Val di Fundres, Rodengo The high apple plateau Naz-Sciaves Naz, Sciaves, Rasa, Fiumes, Aica Index Summer Highlights page 4 AlmencardPlus page 5 Gitschberg page 6 Jochtal page 6 Fane Alm page 6 Altfass Valley page 6 Naz-Sciaves apple plateau page 7 Mountains of Fundres page 7 Rodenecker Lüsner Alm page 7 Trail map page 8–9 Hiking and the Big Five page 10–11 Naz-Sciaves page 12 Rodengo page 13 Rio di Pusteria, Fundres, Spinga page 13 Wet Weather Attractions page 14–15 Winter Highlights page 16–17 Map of the slopes page 18–19 The Cavaliere page 20 Winter Walking page 21 Cross-country skiing page 21 Tobogganing page 21 Accommodations Rio di Pusteria Maranza, Valles, Spinga, Vandoies, Fundres, Vallarga page 22–39 Map Rio di Pusteria-Maranza-Valles-Spinga page 40–41 Map Vandoies-Fundres page 42–43 Accommodations Rodengo page 44–47 Map Rodengo page 48–49 Accommodations Naz-Sciaves page 50–59 Map Naz-Sciaves page 60–61 Map Gitschberg-Jochtal / Naz-Sciaves page 62–63 2 GriaßtGriast enk!enk! Innsbruck (A) München (D) Vipiteno Valles Maranza Jochtal Gitschberg Fundres Spinga Vallarga Lienz (A) Vandoies Vandoies Aica di Sopra Uscita autostrada Bressanone Sciaves Val Pusteria Rio di Brunico Fiumes Pusteria Rasa Naz Rodengo Bressanone Bolzano Verona 3 Summer Highlights Rustic mountain huts, lush green alpine pastures, the cool water of mountain streams and lakes – all surrounded by nature’s unsurpassed beauty. These are the features that make the ski & holiday area Rio Pusteria and the Naz-Sciaves apple plateau so unforgettable. -

2013 Italy: Dolomites & Venice, Croatia
Priorities: Itinerary with overnight refuges (green). 1. July 12 Fri: Fly Seattle late afternoon overnight to Amsterdam. 2013 Italy: Dolomites & Venice, Croatia, 2. July 13 Sat: Arrive in Venice late afternoon. Venice night 1 of 4. Slovenia by [email protected] 3. July 14 Sun: Venice night 2 of 4, Antica Raffineria in Cannaregio *** Shorter Walks in the Dolomites by Gillian Price 2012, 2nd 4. July 15 Mon: Venice night 3 of 4, Antica Raffineria Ed: is referenced throughout as “SWD” with Hike#. 5. July 16 Tues: Venice night 4 of 4, Antica Raffineria *** Rick Steves’ Venice 2013. Croatia & Slovenia 2012. 6. July 17 Wed: Venice car rental > 3.5hrs > ***Brenta Dolomites Lonely Planet: Hiking Italy 2010 describes longer routes Rifugio Tucket or Rifugio Brentei overnight. “GPS” in this document marks Tom’s Waypoints for this device: Garmin 2595LMT GPS (at Costco) speaks turn-by-turn routes! 7. July 18 Thu: Hike out. > Drive 1.7 hrs > Bolzano: **Iceman; Add Europe module; lists lodging & phone #’s. Garmin Basecamp **Castelo Roncolo/Runkelstein Castel. Flexible/rain day. for PC pre-plans hundreds of Waypoints and records Routes (each 8. July 19 Fri: 45min > ***Karersee/L.Carezza, **hike 5mi/450m. Route must break into <600 miles and <30 waypoints). [Google Maps are much better, but they require a smart phone/tablet.] Rosengarten/Catinaccio Group: **Rif. Paolina lift +night+hike. US$1.33 per € euro = 0.75 € per US$ on 6/12/13 9. July 20 Sat: Hike ***Inner Catinacchio, Passo Principe, Vaiolet Italy jet lag is Seattle + 9 hours (GMT+1 hour) Towers: ***Rifugio Vaiolet 3 hrs RT + Lake Antermoia 6.5 hrs. -

1St World Congress on Agritourism
1st World Congress on Agritourism Eurac Research Bozen/Bolzano, 7-9 November 2018 In collaboration with AUTONOME PROVINCIA PROVINZ AUTONOMA BOZEN DI BOLZANO SÜDTIROL ALTO ADIGE With the support of PROGRAMME 1st World Congress on Agritourism 7-9 November, 2018 Eurac Research Bolzano/Bozen Italy 05.11.2018 Advisory Board Thomas Streifeneder, (Chair), Eurac Research - Institute for Regional Development, Italy Thomas Dax, Federal Institute for Less-Favoured and Mountainous Areas (BABF), Germany Christian Fischer, Free University of Bozen, Italy Tor Arnesen, Eastern Norway Research Institute (ENRI), Norway Carla Barbieri, North Carolina State University, USA Hans Embacher, Urlaub am Bauernhof Österreich, Austria Daniela Tommasini, University of Lapland, Finland Claudia Gil Arroyo, University of Missouri, USA Ciervo Margherita, University of Foggia, Italy Hans J. Kienzl, Südtiroler Bauernbund - Farm Holidays in South Tyrol, Italy Andrea Omizzolo, Eurac Research - Institute for Regional Development, Italy Organising Committee Andrea Omizzolo, Eurac Research - Institute for Regional Development (Chair) Thomas Streifeneder, Eurac Research - Institute for Regional Development (Co-Chair) Eleonora Psenner, Eurac Research - Institute for Regional Development Karin Helga Amor, Eurac Research - Communication Department Alexa De Marchi, Eurac Research - Meeting Management Pier Paolo Mariotti, Eurac Research - Meeting Management Hans J. Kienzl, Südtiroler Bauernbund - Farm Holidays in South Tyrol Helmuth Zanotti, IDM Südtirol - Alto Adige 2 PROGRAMME OVERVIEW Updated congress programme: http://agritourism.eurac.edu/editions/2018-edition/programme/ 3 Our Commitment to sustainability We are glade to inform you that the congress has been certified as a Green Event by the Autonomous Province of Bolzano/Bozen. Our congress’ commitment is to reach a high sustainability level. Wherever possible, we have incorporated green meeting planning standards that reduce waste, used recycled materials and lessen energy usage.