(Lepidoptera, Sesiidae).- Acta Ent
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.New Records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Lastuvka, A.; Lastuvka, Z. New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 43, núm. 172, diciembre, 2015, pp. 633-644 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45543699008 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 43 (172), diciembre 2015: 633-644 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015 (Insecta: Lepidoptera) A. Lastuvka & Z. Lastuvka Abstract New records of Nepticulidae, Heliozelidae, Adelidae, Tischeriidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Lyonetiidae and Sesiidae for Portugal and Spain are presented. Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855), S. tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860), Parafomoria helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860), Antispila metallella ([Denis & Schiffermüller], 1775), Nematopogon metaxella (Hübner, [1813]), Tischeria dodonaea Stainton, 1858, Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843), Caloptilia fidella (Reutti, 1853), Phyllonorycter monspessulanella (Fuchs, 1897), P. spinicolella (Zeller, 1846), Lyonetia prunifoliella -
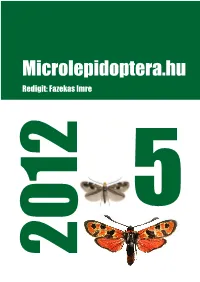
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Pie Pino 2.Pdf
Risultati e discussione Sono di seguito presentati i risultati dell’analisi dei cambiamenti di uso del suolo nel comprensorio di Toceno –Val Vigezzo (2aree di studio permanenti).Quest’areadi studio è statasceltaper l’analisi pilotaamotivo dellagrande estensione dei popolamenti di pino silvestre che la interessano; la stessa metodologia sarà applicata anche ai comprensori restanti. Le zone boscate occupavano a Toceno 1.936 ha nel 1954, cioè circa il 50% del territorio analizzato;negli ultimi 50anni lacoperturaforestale si è accresciutadel 45% circa(2.817 ha nel 2000). L’area di dettaglio scelta per l’analisi localizzata rappresenta un’interfaccia trail bosco continuo e le zone alloraamaggiore influenzaantropica;le pinete occupavano il 64% della “finestra” di paesaggio analizzata, mentre nel periodo di studio la componente boscata è cresciuta fino ad occupare il 90% della finestra. Sono state analizzate tre categorie di indici di paesaggio, riguardanti rispettivamente la frammentazione, la distribuzione spaziale e la complessità di forma degli elementi paesaggistici. Lavariazione degli indici relativamente al periodo analizzato è riportataalla tabella1. Si assiste ad un cospicuo aumento della superficie forestale (bosco: +50%; non-bosco: - 73%). L’aumento della superficie forestale si esercita secondo un pattern specifico: l’aumento della dimensione media delle patch (+200% patch forestali, +40% complessivamente) è accompagnato daunasignificativariduzione delle dimensioni delle patch non boscate (da 0.6a0.2hain media), che cedono il ruolo di matrice del paesaggio alla componente forestale. Gli elementi preesistenti si espandono mantenendo quasi invariata la maglia delle tessere boscate; al contrario, scompaiono quelle sfruttate o mantenutedall’uomo. L’espansione forestale è qui frutto dell’ingrandimento e dell’aggregazione di elementi preesistenti (a “macchia d’olio”). -

Bibliographia Sesiidarum Orbis Terrarum (Lepidoptera, Sesiidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut Jahr/Year: 2000 Band/Volume: 2000 Autor(en)/Author(s): Pühringer Franz Artikel/Article: Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) 73-146 ©Salzkammergut Entomologenrunde; download unter www.biologiezentrum.at Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut 3 73-146 31.12.2000 Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) Franz PÜHRINGER Abstract: A list of 3750 literature references covering the Sesiidae of the world is presented, based on the Record of Zoological Literature, the Zoological Record and Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925) as well as cross references found in the cited literature. Key words: Lepidoptera, Sesiidae, world literature. Einleitung: Die Literatur über die Schmetterlingsfamilie der Glasflügler (Sesiidae) ist weit verstreut und mittlerweile auch bereits recht umfangreich. In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Weltliteratur der Sesiiden zusammenzutragen und aufzulisten. Grundlage dafür waren alle erschienenen Bände des Record of Zoological Literature, Vol. 1-6 (1864-1869), fortgesetzt als Zoological Record, Vol. 7-135 (1870-1998/99) sowie der Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925). Darauf aufbauend wurden alle Querverweise in den Literaturverzeichnissen der zitierten Arbeiten geprüft. Aufgenommen wurden nicht nur Originalarbeiten über Sesiidae, sondern auch faunistische Arbeiten, die Angaben über Sesiidae enthalten, da gerade in solchen Arbeiten oft sehr wertvolle Freilandbeobachtungen und Hinweise zur Biologie der entsprechenden Arten zu finden sind. Auf diese Weise sind bisher 3750 Literaturzitate zusammengekommen. Von diesen konnten jedoch erst 1461 (39 %) überprüft werden. Das sind jene Arbeiten, die sich als Original oder Kopie in meiner Bibliothek befinden. -

Microlepidoptera: Sesiidae)
FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 289–309 Az Északi-középhegység üvegszárnyú lepkefaunája (Microlepidoptera: Sesiidae) FAZEKAS IMRE ABSTRACT: [The clearwing moth’s fauna of the North-Hungarian Mountains (Microlepidoptera, Sesiidae)] – The author plans to describe the Sesiidae fauna of great geographical units in Hungary. Present study is the second part of general revision of the Sesiidae of Hungarians. It revises the earlier literature and collections. It the present study I provide a checklist of the synonyms of valid names of the North-Hungarian Mountain species. The faunistic and phenological data of 30 species are reviewed with an analysis of the habitat distri- bution according to the ecological landscape types. The conservation status of each is indicated. The UTM Grid code of each locality is given. Figures of the genitalia and wing pattern of several species which are dif- ficult to determine are given. Bevezetés A közelmúltban megkezdtem a magyarországi természetföldrajzi régiók Sesiidae faunájának feldolgozását. Eddig a Dél-Dunántúl üvegszárnyú lepkéinek összefoglalója készült el (FAZE- KAS 2003), s folyamatban van a Dunántúli-középhegység fajainak feldolgozása. Jelen mun- kámban az Északi-középhegységbõl kimutatott fajok adatait összesítem a területre vonatko- zó irodalmak és saját kutatásaim alapján. A középhegységi Sesiidaek gyűjtésének kezdetei a 19. század végéig nyúlnak vissza. A te- rületen szinte minden lepidopterológus gyűjtött üvegszárnyú lepkéket, de a vizsgálati ered- mények kiértékelése – a névjegyzékbe való felvételen kívül – ez idáig nem történt meg (ÁCS & SZABÓKY 1993; BALOGH 1967; ISSEKUTZ 1955b; ISSEKUTZ 1956; JABLONKAY 1972; KOVÁCS 1953; KOVÁCS 1956; LAŠTŮVKA 1990; LIPTHAY 1961; RONKAY & SZABÓKY 1981; SZABÓKY 1999). LIPTHAY Béla, Nógrád megye első természettudományos muzeológusa (HÍR & MÉ- SZÁROS 1994) is foglalkozott a Sesiidae fajokkal. -

MINISTÈRE DE L'enseignement SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences De La Vie Et De La Terr
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences de la Vie et de la Terre MÉMOIRE présenté par Alexandre CRÉGU pour l’obtention du Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae soutenu le 15 mars 2019 devant le jury suivant : Aurélie GOUTTE, Maître de conférences, EPHE, PSL – Présidente Pascal DUPONT, Chargé projet insectes, MNHN – Tuteur scientifique Stefano MONA, Maître de conférences, EPHE, PSL – Tuteur pédagogique Benoît FONTAINE, Chargé de recherches, CESCO – Rapporteur Philippe BACHELARD, Expert naturaliste, SHNAO – Examinateur Mémoire préparé sous la direction de : Pascal DUPONT Laboratoire de : MNHN-SPN – UMS 2006 PatriNat – Muséum National d'Histoire Naturelle – Maison Buffon - CP 41–36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75231 Paris Cedex 05 – Directeur : Jean-Philippe SIBLET et de Stefano MONA Laboratoire de : BIOLOGIE INTÉGRATIVE DES POPULATIONS – UMR 7205 – Institut Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB) Muséum National d’Histoire Naturelle – 16 rue Buffon – 75005 Paris – Directrice : Claudie DOUMS EPHE (Sciences de la Vie et de la Terre) M2 DEPHE – Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae. Les Patios Saint-Jacques / 4-14 rue Ferrus / 75014 Paris Auteur : Alexandre Crégu Relecture : Pascal Dupont et Stefano Mona Responsable du diplôme : Sophie Thenet ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae Alexandre CRÉGU 15 mars 2019 RÉSUMÉ L’entomologie telle qu’on la connait aujourd’hui se limite bien souvent aux espèces protégées où disposant d’un statut de réglementation. -

Molecular Identification and Characterization of Synanthedon Tipuliformis Clerck from Black Currant Fields
Acta Biol. Univ. Daugavp. 15 (1) 2015 ISSN 1407 - 8953 MOLECULAR IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF SYNANTHEDON TIPULIFORMIS CLERCK FROM BLACK CURRANT FIELDS Laura Ozoliņa-Pole, Jūlija Vilcāne Ozoliņa-Pole L., Vilcāne J. 2015. Molecular identification and characterization ofSynanthedon tipuliformis Clerck from black currant fields.Acta Biol. Univ. Daugavp., 15 (1): 157 – 163. Currant clearwing moth Synanthedon tipuliformis Clerck belongs to order Lepidoptera, family Sesiidae, and is one of the most important pests of plants belonging to genus Ribes and, particularly, black and red currants. Species within genus are not always easily distinguishable by morphological features from closely related species, and some similar species cold be found in Latvia. Since currant clearwing moth inhabits perennial plantings of currants, which are located along the country, distinct populations may occur. To observe possible variability between populations of Synanthedon tipuliformis, larvae and imago were collected in three black currant plantations in geographically distinct parts of Latvia, in municipalities of Tukums (Western part), Saldus (South-Western part), and Pārgauja (Northern part). A 710-bp fragment of highly conserved regions of the mitochnodrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene were amplified using primers LCO1490 and HCO2198, sequenced from 33 samples, at least ten insects from each location. All sequences after processing and search in NCBI BLASTn database and phylogenetic analysis resulted in the same species, Synanthedon tipuliformis. Samples from all three populations were relatively homogenous, but some polymorphisms were observed. Hypothetically these differences could be related to planting material used, as very often it came from different plant nurseries. All sequences were deposited at NCBI GeneBank, and this is first time when molecular data ofSynanthedon tipuliformis is available from Baltics. -

Synanthedon Spuleri (FUCHS, 1908) (Lepidoptera, Sesiidae) Nowy Dla Polski Gatunek Przeziernika
Wiad. entomol. 33 (1) 33–37 Poznań 2014 Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908) (Lepidoptera, Sesiidae) nowy dla Polski gatunek przeziernika Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908) (Lepidoptera, Sesiidae) – a clearwing moth species new to the fauna of Poland 1 2 Marek BĄKOWSKI , Marek HOŁOWIŃSKI 1 Zakład Zoologii Systematycznej UAM, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań; e-mail: [email protected] 2 Hańsk I, ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, e-mail: [email protected] ABSTRACT: Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908) was found in the south–eastern part of Poland. The species is new to the Polish fauna. This is the northernmost locality in the whole distribution area in Europe. KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, Synanthedon spuleri, new records, E Poland Wstęp W trakcie badań Sesiidae południowo-wschodniej części Polesia Lubel- skiego stwierdzono po raz pierwszy z Polski gatunek Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908). Jest to już 24 gatunek przeziernika podawany z tego obszaru (BĄKOWSKI i HOŁOWIŃSKI 2011, 2013) oraz 31 gatunek z naszego kraju (BĄKOWSKI 2013a). S. spuleri jest podawany z zachodniej i południowej Europy jak również z północnej Turcji oraz Gruzji i wszędzie jest stwierdzany pojedynczo. Z analizy zasięgów Sesiidae w Europie Środkowej można było przypusz- czać, że jego występowanie w naszym kraju jest wielce prawdopodobne (LAŠTŮVKA i LAŠTŮVKA 2001). Odnotowany był najbliżej granicy naszego kraju w Czechach na Morawach w Nedasov oraz na Słowacji w Remetske Hamre i Dobra Voda (Z. LAŠTŮVKA inf. ustna). W ostatnim czasie został również wykazany z Krymu na Ukrainie (EFETOV i in. 2012). 34 M. BĄKOWSKI, M. HOŁOWIŃSKI S. spuleri wśród europejskich przezierników jest jednym z niewielu gatunków polifagicznych. -

Oznámení Záměru
geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: [email protected] OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLE § 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 NÁZEV Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko na ložisku vápence Hvozdečko – Holý Vrch a povolení hornické činnosti OZNAMOVATEL Agir spol. s. r. o. Lom Skoupý 262 55 Petrovice Řešitel: Schválil: Datum: Datum: Výtisk číslo: Počet výtisků: OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Hvozdečko AUTORSKÝ TÝM AUTORSKÝ TÝM ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDR. T. PECHAR SPOLUPRACOVALI: Ing. M. Zemancová Ing. B. Vlachová – biologické hodnocení Mgr. T. Bartonička – biologické hodnocení Ing. I. Dušková – hluk Rndr. V. Štefek - geologie DATUM ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ: SRPEN 2004 GET s. r. o. Strana 2 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Hvozdečko OBSAH OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ................................................................................................................. 6 1. OBCHODNÍ FIRMA ..................................................................................................................................... 6 2. IČO .......................................................................................................................................................... 6 3. SÍDLO ....................................................................................................................................................... 6 4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE............................... 6 B. -

With a Revised Checklist of Species Occurring in Poland
P O L I S H JOU R NAL OF ENTOM O LOG Y POL SKIE PISMO ENTOMOL OGICZ N E VOL. 80: 411-421 Gdynia 30 June 2011 DOI: 10.2478/v10200-011-0028-x Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Małopolska Province MAREK BĄKOWSKI1, RAFAŁ CELADYN2, MAREK HOŁOWIŃSKI3, WITOLD ZAJDA4 1 Department of Systematic Zoology, Institute of Environmental Biology, A. Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland, e-mail: [email protected]; 2 Pierwsza 34, 32-546 Młoszowa, Poland, e-mail: [email protected]; 3 Macoszyn Mały 46, 22-235 Hańsk, Poland, e-mail: [email protected]; 4 Institute of Systematics and Evolution of Animals, Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Poland, e-mail: [email protected] ABSTRACT. Twenty-four species of the family Sesiidae have been recorded from the Province of Małopolska. This constitutes ca 78% of all the species of this family present in Poland. The species Paranthrene insolita, Synanthedon mesiaeformis, S. flaviventris, S. conopiformis, Chamaesphecia tenthrediniformis have been recorded for the first time in this region. Sesia bembeciformis and Synanthedon cephiformis have been recorded as new for the Pieniny Mts. The majority of adults were attracted with the use of synthetic sex pheromones. KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, new records, pheromones, Małopolska Province, S Poland. INTRODUCTION Research into the Lepidoptera of the Kraków area was summarized by RAZOWSKI & PALIK (1969), and investigations of the Lepidoptera of the Tatra Mountains (BATKOWSKI et al.1972, BUSZKO et al. 2000) and the Pieniny Mountains (BŁESZYŃSKI et al. 1965) have also been carried out. Despite the many years of studies of Lepidoptera in these regions by numerous lepidopterologists, there are still few data on clearwing moths. -

Pdf-Dokument
Naturkundliche Band 18 Herausgeber: Forschung Regierung des Fürstentums im Fürstentum Liechtenstein Liechtenstein Die Spinner und Schwärmer des Fürstentums Liechtenstein (Lepidoptera: Bombyces et Sphinges sensu classico) In der Schriftenreihe der Regierung 2001 Die Spinner und Schwärmer des Fürstentums Liechtenstein (Lepidoptera: Bombyces et Sphinges sensu classico) Ulrich Aistleitner unter Mitarbeit von Eyjolf Aistleitner Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein Band 18 Vaduz 2001 Herausgeber: Regierung des Fürstentums Liechtenstein Redaktion: Rudolf Staub, Renat AG, Schaan Titelblatt-Gestaltung: Atelier Silvia Ruppen, Vaduz Fotos: Eyjolf Aistleitner, Ulrich Aistleitner, Mario F. Broggi, Rudolf Bryner, Bernhard Jost, Werner Klien, Franz Pühringer Druck: BVD Druck + Verlag AG, Schaan Bezugsquelle: Amt für Wald, Natur und Landschaft, FL-9490 Vaduz (Preis Fr. 15.–) Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz 2001 ISBN 3-9521855-2-3 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Aistleitner, Ulrich: Die Spinner und Schwärmer des Fürstentums Liechtenstein : (Lepidoptera: Bombyces et Sphinges sensu classico) / Ulrich Aistleitner. - Vaduz : Amtlicher Lehrmittelverl., 2001 (Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein ; Bd. 18) ISBN 3-9521855-2-3 Zum Geleit Mehr als drei Viertel aller Tierarten sind Insekten. Dazu zählen Hunderte von Schmetterlingsarten, wobei vor allem die Tagfalter gerngesehene Farbtupfer in unserer Landschaft darstellen. Im 1996 erschienenen Band Nr. 16 aus der Naturkundlichen Forschungsreihe wurde deren Vorkommen -
Fazekas Ok.Qxd
Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 353–368 Kaposvár, 2004 Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, V. A Dél–Dunántúl üvegszárnyú lepkefaunája (Microlepidoptera: Sesiidae) FAZEKAS IMRE Komlói Természettudományi Gyûjtemény, Natural History Collection of Komló H-7300 Komló, Városház tér 1. HUNGARY , e-mail: [email protected] FAZEKAS I. : Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, N° 5. dai-hegyekben valamint a Duna menti ártéri ligeterdõk- Clearwing moth’s fauna in the South Transdanubian, Region ben végzett fontos biológiai megfigyeléseket. Hungary (Microlepidoptera: Sesiidae) KOVÁCS (1953) faunisztikai alapmunkája mérföldkõ Abstract: No review has been published on the clearwing volt a hazai Sesiidaek földrajzi elterjedésének megis- moth fauna of Hungary so far. The author plans to describe the Sesiidae fauna of great geographical units in Hungary. In this merésében, hiszen a 20. század közepén elõször kap- paper species from the entomological collection of Somogy tunk képet a fajok hiteles lelõhelymintázatáról. Ugyan- County Museum and from the Natural History Collections of akkor Kovács elõbbi munkájában kritikusan megje- Komló are described. Besides the museum data, an overview gyezte: „A Psychidae és az Aegeridae családokba tar- of the special literature is also given for each species. tozó fajok meghatározása sok esetben nehéz feladat Taxonomical, biological, zoogeographical and faunistical és még mai is van több tisztázásra szoruló problémánk. analysis of species are presented. Figures of the genitalia and Ezekbõl a családokból aránylag kevés példány találha- wing pattern of several species which are difficult to determine tó a gyûjteményekben, ami megnehezíti a problémák are given. The Paranthrene insolita polonica Schneider, 1939 and Bembecia albanensis (Rebel, 1918) species are new to tisztázását”. A Kovács által fél évszázaddal ezelõtt fel- the fauna of South Transdanubia.