Regionalentwicklung Im Bezirk Leibnitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Teilraumkarte
REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM TEILRÄUME §3 Legende REGION SÜDWESTSTEIERMARK Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland Landschaftsräumliche Einheiten gemäß Empersdorf Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 7. Juli 2016 Grünlandgeprägtes Bergland Empersdorf Außeralpines Hügelland Liebensdorf Außeralpine Wälder und Auwälder Ackerbaugeprägte Talböden und Becken Siedlungs- und Industrielandschaften Hötschdorf Weisses Kreuz Wutschdorf Planungsinformation Sankt Gewässer Ulrich am Heiligenkreuz Gundersdorf Waasen am Waasen Lannach Lannach Fliessgewässer Sankt Pirkhof Stefan ob Heuholz Eisenbahn Stainz Sankt Stefan ob Teipl Autobahnen, Schnellstraßen Stainz Blumegg Landesstraßen [B] Greisdorf Landesstraßen [L] Lemsitz Allerheiligen Allerheiligen sonstige Straßen bei Wildon Trog Marhof Oisnitz bei Wildon Sankt Josef Tobisegg Bezirksgrenzen (Weststeiermark) Gemeindegrenzen Pichling bei Stainz Sankt Josef Neudorf Sukdull (Weststeiermark) ob Wildon Weitendorf Stainz Stallhof Stainz Mitterlabill Stallhof Ettendorf Wildon Fabrik bei Stainz Wildon Kothvogel Sankt Georgen an Schwarzau im Graschuh der Stiefing Schwarzautal Bad Gams Hengsberg Sankt Tobis Margarethen Wieselsdorf Hengsberg bei Lebring Osterwitz Rassach Preding Schwarzautal Deutschlandsberg Kraubath in der Lebring-Sankt Weststeiermark Margarethen Breitenfeld am Niedergams Tannenriegel Freiland bei Deutschlandsberg Sankt Ragnitz Schamberg Lang Nikolai im Bachsdorf Sausal Lang Ragnitz Hainsdorf im Wettmannstätten Schwarzautal Petzelsdorf Gralla Laßnitz -

Stadtgemeinde Leibnitz 5/2015 EINLADUNG
Stadtgemeinde Leibnitz 5/2015 E I N L A D U N G zu der am Mittwoch, dem 16. September 2015 um 18.00 Uhr stattfindenden ÖFFENTLICHEN Sitzung des GEMEINDERATES Ort : Rathaus Leibnitz, Hauptplatz 24, I. Stock, Sitzungssaal Leibnitz, am 07.09.2015 Der Bürgermeister : Helmut Leitenberger e.h. * Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit * Fragestunde * Dringlichkeitsanträge T A G E S O R D N U N G : 1.) Genehmigung der Verhandlungsschrift der „öffentlichen“ Gemeinderatssitzung a) vom 28.04.2015 – 2/2015 – TOP DA 18.) b) vom 15.06.2015 – 3/2015 c) vom 06.07.2015 – 4/2015 2.) Bericht Bürgermeister 3.) Seniorenwohnhaus Lastenstraße 8 – Aufzugsanlage – Sanierung – Änderung Vorbeschluss – Genehmigung 4.) Gemeindebetreuungsbauten Dr.-Seak-Weg 2 – Umfassende energetische Sanierung – Änderung Vorbeschluss – Genehmigung 5.) Gemeindebetreuungsbauten Dr.-Seak-Weg 4 – Umfassende energetische Sanierung – Änderung Vorbeschluss – Genehmigung 6.) Wirtschaftsförderungsrichtlinien der Stadtgemeinde Leibnitz – Genehmigung 7.) Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leibnitz – Beladung TLF A-4000 – Kapitaltransfer- zahlung – Genehmigung 8.) Subvention 2015 – Auszahlung Teilsubvention – Aktionsgemeinschaft „Leibnitz lädt ein!“ – Genehmigung Stadtgemeinde Leibnitz – Einladung Gemeinderatssitzung 16.09.2015 – 5/2015 Seite 1 von 4 9.) Nachmittagsbetreuung 2014/2015 – Förderungsverträge mit dem Land Steiermark – Genehmigung a) Volksschule Leibnitz I b) Volksschule Leibnitz-Linden c) NMS Eduard-Staudinger Sport & Kreativ – Hauptschule Leibnitz d) NMS Hauptschule Leibnitz -

2Nd Report by the Republic of Austria
Strasbourg, 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 [English only] SECOND REPORT SUBMITTED BY AUSTRIA PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Received on 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 TABLE OF CONTENTS PART I...................................................................................................................................5 I.1. General Remarks..............................................................................................................5 I.2. Comments on the Questions and the Resolution of the Council of Europe ........................7 PART II ...............................................................................................................................17 II.1. The Situation of the National Minorities in Austria .......................................................17 II.1.1. The History of the National Minorities .......................................................................18 The Croat minority in Burgenland ........................................................................................18 The Slovene minority ...........................................................................................................19 The Hungarian minority .......................................................................................................21 The Czech minority..............................................................................................................21 The Slovak minority.............................................................................................................22 -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Rotaract News Spring 2016
ROTARACT NEWS SPRING 2016 what‘s going on in the World of Rotaract A NEW YEAR IN ROTARACT Dear Rotaractors! Dear Friends! A lot of clubs also sent us great inputs to their latest social projects. Have a look at their reports and the Spring is a very busy season in Rotaract. The board pictures! and the organizers from Rotaract Club Tuzla’99 are We also got a new so called „district project“ named working very hard to make the upcoming MDPC (Multi „Intarconnect“. The initiators are very busy to present it District Presidential Conference) the best ever. So if to clubs all over Austria or abroad and will present it for you did not book your ticket yet, you should do so asap the first time at the MDPC to our bosnian Rotaractors. at www.mdpc2016.com. But not only the MDPC is In addition to Intarconnect we will have on the 29th keeping us up all night. Next week will be the Rotaract of May the 6th (!!!) „Ich Helfe Laufend“ Charity Run Pets/Sets (President & Secretary Elect Training in Vienna. The coproduction of several viennese Seminar) in Seggau/Stmk for all austrian Rotaracters, Rotaractors from different clubs will be even better, right after Tuzla a lot of us are coming together at bigger, more culinary than before. the Rotaract European Convention in Milan and also And do you know already the concept of the Rotaract clubs in the districts KidsCamp? To be honest…it was not us who invented have major news the idea of this great project…it were our german to tell. -

Unser Leibnitz DAS STADTMAGAZIN DER STADTGEMEINDE LEIBNITZ | AUSGABE JUNI 2016
AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADTGEMEINDE LEIBNITZ | ZUGESTELLT DURCH POST.AT | AN EINEN HAUSHALT unser Leibnitz DAS STADTMAGAZIN DER STADTGEMEINDE LEIBNITZ | AUSGABE JUNI 2016 FEST DER BEGEGNUNG BERICHT AUF SEITE 6 11 12 15 30 Das neue Wappen der Wir stellen vor: Der große steirische Junior European Stadt Leibnitz Technik & Verkehr Frühjahrsputz Judo Cup 2016 IMPRESSUM INHALT MEDIENINHABER & Liebe Leibnitzerinnen! unser Leibnitz HERAUSGEBER Stadtgemeinde Leibnitz Hauptplatz 24 Unsere 8430 Leibnitz Liebe Leibnitzer! extra bestellen THEMEN ERSCHEINUNGSORT & VERLAGSPOSTAMT Wer in die Südsteiermark reist, verbindet diesen Sollten Sie unser Leibnitz nicht automatisch in 8430 Leibnitz Namen meist mit den Sonnenseiten des Lebens, Ihrem Briefkasten finden, so können Sie sich das 4 FÜR DEN INHALT Kurz notiert VERANTWORTLICH mit gutem Wein und Essen. Das neue Leibnitzer Leibnitzer Stadtmagazin auch gerne extra bestellen. BGM Helmut Leitenberger Gerade noch in diese Tourismusteam rund um Dino Kada hat nun Einfach in der Stadtgemeinde Leibnitz melden und Ausgabe geschafft... LAYOUT & SATZ Ing. Kevin Walter darauf reagiert. schon bekommen Sie es gratis zugesandt! FOTOS 8 Sofern nicht anders angegeben sind Im Herbst vergangenen Jahres Aus dem Bürger- alle Bilder honorarfrei beigestellt. wurden innerhalb unseres meisterbüro Tourismusverbandes, der die Stadt TITELBILD Städtisches Bad & Camping Matura - was nun?, Ganz im Zeichen des Miteinander Leibnitz mit seinen Ortsteilen Kaindorf 5 Frühlingsempfang,... stand das Fest der Begegnung am an der Sulm und -

Bezirkswahlbehörde Leibnitz KUNDMACHUNG
Bezirkswahlbehörde Leibnitz KUNDMACHUNG Die Bezirkswahlbehörde Leibnitz für die Landwirtschaftskammerwahlen 2021 ver- öffentlicht gemäß § 33 der Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005, LGBl. Nr. 90, idgF., nachstehend die Namen der von den Wählergruppen vorgeschlagenen Kan didatInnen für die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Leibnitz Liste 1 Steirischer Bauernbund STBB 1 Zirngast Christoph, Dipl.-Ing., 1981, Angestellter, Landwirt, 8452 Großklein 2 Kaiser Josef Gregor, 1987, Landwirt, 8410 Wildon 3 Posch Daniela, 1980, Drogistin, Landwirtin, 8451 Heimschuh 4 Kowald Josef Johannes, Ing., 1987, Landwirt, 8412 Allerheiligen b. W. 5 Schmid Friederike Maria, 1963, Kaufm. Angstellte, Landwirtin, 8443 Gleinstätten 6 Fischer Josef, 1983, Landwirt, 8442 Kitzeck i. S. 7 Holler Gerald, Ing. BA, 1973, Landwirt, 8410 Wildon 8 Huss Josef, 1963, Landwirt, 8423 St.Veit i. d. Südstmk. 9 Huss Manfred, 1970, Landwirt, 8435 Wagna 10 Wratschko Karl Alexander, 1972, Weinbauer, 8462 Gamlitz 11 Pirker Sebastian, 1988, Landwirt, 8505 St. Nikolai i. S. 12 Neuhold Klaus, Ing., 1970, Angestellter, Landwirt, 8081 Empersdorf 13 Vehovec-Huhs Romana, 1975, Landwirtin, 8472 Straß in Steiermark, Vogau 14 Seiner Andreas, 1989, Landwirt, 8504 Hengsberg 15 Poscharnig Viktoria, 1997, Winzerin, 8463 Leutschach a. d. W. 16 Weinzerl Thomas, Ing., 1988, Agraringenieur, 8081 Heiligenkreuz a. W. 17 Labugger Franz, ÖRat. Ing., 1962, Ölmüller, Landwirt, 8403 Lebring-St.Margarethen 18 Bernhard Thomas, 1972, Landwirt, 8472 Straß in Steiermark, Gersdorf an der Mur 19 Huss -

Vineyard Interfaces in the Heart of Europe Northbound Journey
VINEYARD INTERFACES IN THE HEART OF EUROPE NORTHBOUND JOURNEY NAME: #austrianwine | #winesummit | 23–26 May 2019 Download Catalogue, Tasting Lists & Photos: www.austrianwine.com/wine-summit Social Media & Press AUSTRIAN WINE SOCIAL MEDIA CHANNELS Follow us, if you love Austrian Wine as much as we do ♥ Share your favourite moments with #austrianwine and #winesummit Instagram @austrianwine | @austrianwineuk | @austrianwineusa Facebook @oesterreichwein | @austrianwine YouTube www.youtube.com/oesterreichwein EVENT PRESS KITS with specially selected information about the winegrowing country Austria. www.austrianwine.com/press-kit Preface WELCOME TO AUSTRIA! © AWMB/Anna Stöcher We are so very glad to welcome you to this lersee, Mittelburgenland and Eisenberg year’s Austrian Wine Summit, Vineyard – all adjacent to Hungary – to Vulkanland Interfaces in the Heart of Europe! Although Steiermark, bordering on Slovenia. Accre- each Wine Summit is unique, this one feels dited specialists will elucidate the historical very special to me, as it fulfils a longtime development of each border region, while dream of mine: to pay a dedicated visit to wines from our Czech, Slovakian, Hunga- some of Austria’s best vineyards – speci- rian and Slovenian friends will accompany fically, those that lie at the borders of our you throughout your visit. country; these borders that never were bor- ders until after 1918. New lines of demar- Finally, you will assemble in Vienna with cation were drawn then, which abruptly di- your colleagues from the other Wine Sum- vided excellent terroirs, leaving the parts in mit groups for a day’s conference dedica- separate countries and leading to a century ted to the history of Austrian wine. -

Together We Are Thinking Ahead. Together
The year 2014 Together we are thinking ahead. Together Alexander Parkside Germany, Berlin We are shaping the future. Florido Tower Austria, Vienna Pro-forma figures* UBM Development IN € MILLION 2014 Total annual output 482.6 of which: international in % 59 % Operating profit 53.5 Earnings before taxes (EBT) 31.4 Profit after tax 28.2 Return on capital employed in % 5.8 % Return on equity in % 10.7 % Two partners come together: Total assets 1,077.4 Equity ratio as % of total assets as at 31 Dec 24.6 % PIAG and UBM are merging into a Net debt 571.3 developer on a European scale. Together we are embarking upon new territory and we want to continue growing on a solid basis. * UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft together with PIAG Immobilien AG (PIAG) based on the pro-forma assumption that the merger between PIAG and UBM took place as of 1 January 2014. Alexander Parkside Retained profit, equity ratio, profitability and Germany, Berlin dividends are future prospects expressed in fig- ures. We do not consider the results of the cur- rent financial year to be merely a description of our current success, but rather the basis for our future operations and growth – our future success. We are shaping the future. Florido Tower Austria, Vienna Being able to present our projects and our success fills us with pride – every year, anew, with each report. TABLE OF CONTENTS Foreword from the Executive Board 06 Our company 06 Statutory bodies of the company 08 The merger 10 Success factors and strategy 12 Focus on Europe 14 Residential 18 Our lines -

Murstausee Gralla", Im Jahre 1981 (Aves)
©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum Heft 29 S. 41—56 Graz 1983 Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, mit dem Schwerpunkt Vogelschutzgebiet „Murstausee Gralla", im Jahre 1981 (Aves). Von Willibald STANI Mit 2 Abbildungen Eingelangt am 25. Jänner 1982 Inhalt: Aus der Südsteiermark werden Beobachtungsdaten und Verbreitungsangaben über 147 Vogelarten mitgeteilt. Interessante Arten wie Zwergscharbe, Phalacrocorax pygmeus (PALLAS), Kolbenente, Netta ruf ina (PALLAS), Seeadler, Haliaeetus albicilla (L.), Wanderfalke, Falco peregrinus TUNSTALL, und Merlin, Falco columbarius L., wurden wiederum bzw. der Rallenreiher, Atdeola ralloides (SCOPOLI), erstmals für den Stausee Gralla nachgewiesen. Winterdaten liegen von Waldwasserläufer, Flußuferläufer, Feldlerche, Hausrotschwanz und Singdrossel vor. Abstract: Observation and spreading data of 147 species of birds are reported from Southern Styria (Districts of Leibnitz and Radkersburg). Interesting species, so the Pygmy Cormorant, Phalacrocorax pygmeus, the Red crested Pochard, Netta rufina, the White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla, the Peregrine Falcon, Falco peregrinus, and the Merlin, Falco columbarius, was proved again. The Squacco Heron, Ardeola ralloides, were proved for the first time of the storage lake Gralla. Furthermore it was proved, that Green Sandpiper, the Common Sandpiper, the Sky Lark, the Black Redstart and the Song Thrush hibernates in this region. In Weiterführung der bis jetzt in den „Mitteilungen der Abt. für Zoologie am Landesmuseum Joanneum" (Jg. 3 -10, Heft 2 bzw. 1) erschienenen Berichte über die Südsteiermark werden hier aus dem oben erwähnten Zeitraum weitere Beobachtun- gen mitgeteilt. Nomenklatur und Reihung der Arten erfolgten nach PETERSON et. al. 1970; die Autorennamen wurden MAKATSCH 1966 entnommen. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so sind die Gewährsmänner angeführt. -

Leibnitz KUNDMACHUNG
Bezirkswahlbehörde Leibnitz KUNDMACHUNG Die Bezirkswahlbehörde Leibnitz für die Landwirtschaftskammerwahlen 2011 veröffentlicht gemäß § 33 der Landwirtschaftskammer- Wahlordnung 2005, LGBl. Nr. 90, idgF., nachstehend die Namen der von den Wählergruppen vorgeschlagenen Kandidaten für die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Leibnitz Liste Steirischer Bauernbund STBB 1 1 Kowald Josef ÖKR 1948 Bauer 8412 Allerheiligen Allerheiligen 73 2 Holler Gerald Ing. 1973 Bauer 8410 Stocking Stocking 12 3 Stiendl Rudolf 1960 Bauer 8444 St.Andrä-Höch Brünngraben 37 4 Gamser Franz 1960 Bauer 8463 Glanz a.d.W. Glanz 61 5 Reiter-Haas Josef 1965 Bauer 8410 Weitendorf Am Dorfplatz 6 6 Schmid Maria-Friederike 1963 Bäuerin 8443 Gleinstätten Prarath 19 7 Vollmann Walter 1954 Bauer 8430 Leitring/Wagna Hofweg 5 8 Pail Werner Ing. 1970 Bauer 8423 Wagendorf Buchenstraße 57 9 Hackl Wolfgang Ing. 1966 Bauer 8413 St.Georgen a.d.Stfg. Baldau 18 10 Primus Franz 1968 Bauer 8451 Heimschuh Heimschuh 25 11 Skringer Johann 1970 Bauer 8453 St. Johann i.S. Eichberg 28 12 Klösch Rosa 1964 Bäuerin 8505 St.Nikolai i.S. Mitteregg 62 13 Huss Manfred 1970 Bauer 8435 Wagna Wagnastraße 122 14 Reiterer Josef 1957 Bauer 8461 Berghausen Wielitsch 4 15 Tertinjek Gregor 1983 Bauer 8463 Leutschach Remschnigg 57 16 Matzer Alois 1964 Bauer 8081 Hlg.Kreuz a.W. Kleinfelgitsch 115 17 Grebenz Bernadette 1985 Bäuerin 8452 Großklein Kleinklein 10 18 Treichler Michael 1964 Bauer 8421 Breitenfeld/T. Breitenfeld 4 19 Rohrer Alois 1934 Bauer 8422 St.Nikolai ob Dr. Kirchberg 58 20 Stoisser Matthias 1980 Bauer 8403 Lang Dexenberg 27 21 Posch Johann 1956 Bauer 8081 Hlg.Kreuz a.W. -
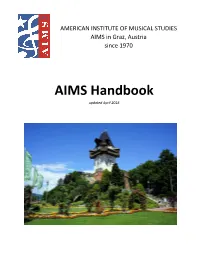
AIMS Handbook Updated April 2018
AMERICAN INSTITUTE OF MUSICAL STUDIES AIMS in Graz, Austria since 1970 AIMS Handbook updated April 2018 TABLE OF CONTENTS Section 1 Preparing for the AIMS in GRAZ Experience 1.1 German 1.2 Health Matters 1.3 Health Care 1.4 Medical Insurance 1.5 Prescription Drugs 1.6 Special Diets 1.7 Passports 1.8 Visas 1.9 Transportation to Graz 1.9.1 Arrival in Graz 1.9.2 General Flight Info 1.10 Travel Insurance 1.10.1 Baggage Insurance 1.10.2 Flight Cancellation and Travel Insurance 1.10.3 Medical Insurance While Abroad 1.11 U.S. Customs 1.11.1 Contraband 1.11.2 Declarations 1.12 What to Bring to Graz 1.12.1 Electricity, Adapter Plugs & 220 volt Appliances 1.12.2 Clothing and the Weather in Graz 1.12.3 Necessities and Helpful Items 1.13 Helpful Reminders 1.14 Instrument Travel 1.15 Labeling your Luggage 1.16 Money for Food and incidental Expenses 1.17 Changing Money (also see section 4.1) Debit cards, Credit cards, Cash advances, Personal checks, Traveler’s checks, Cash 1.18 Music and Repertoire 1.19 Photos 1.20 Your AIMS Address 1.21 Telephones 1.22 Setting Realistic Goals for a Profitable Summer Section 2 Arriving and Getting Settled at the Studentenheim and in Graz 2.1 Room/Key Deposit 2.2 Changing Money 2.3 Streetcar/Bus Tickets 2.4 Photocopy of Passport 2.5 Late Arrivals 2.6 Jet Lag 2.7 Time Difference between Graz and the U.S. Section 3 Living in the Studentenheim 3.1 Studentenheim Layout 3.2 Practice Rooms 3.3 Sleeping Rooms 3.3.1 Contents 3.3.2 Electricity 3.3.3 Security 3.3.4 Your Responsibilities 3.4 Breakfast 3.5 Overnight Guests 3.6