Prähistorie Im Nationalsozialismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Externsteine – Ähnliche Zuschreibungen in Der Öffent- Ein Denkmal Als Objekt Lichen Wahrnehmung Der Externsteine
„Kraftort“, „Kultplatz“, „Gestirnsheilig- tum“ – oftmals finden sich solche und Die Externsteine – ähnliche Zuschreibungen in der öffent- Ein Denkmal als Objekt lichen Wahrnehmung der Externsteine. wissenschaftlicher Forschung Vorstellungen von einem „vorchristli- und Projektionsfläche chen Kultort“ im Teutoburger Wald wur- den von Vertreterinnen und Vertretern völkischer Vorstellungen der völkischen Bewegung seit Beginn des 20. Jahrhunderts popularisiert und Fachtagung im sind bis heute wirkmächtig. Ein Ziel der Lippischen Landesmuseum Detmold Fachtagung ist es, die Ursprünge, Funk- 6. und 7. März 2015 tionen und Rezeption der völkischen Mythenbildung an den Externsteinen zu beleuchten. In einem zweiten Tagungsschwerpunkt stellen Wissenschaftlerinnen und Wis- Teilnahmegebühr 10,00 Euro, senschaftler verschiedener Fachdiszipli- ermäßigt 8,00 Euro nen den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Externsteine-Anlagen Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um den Mythen gegenüber. Damit wird Anmeldung bis zum 20.2.2015 wird eines der bedeutendsten Denkmäler gebeten. Westfalens erstmals interdisziplinär ge- Kontakt: würdigt. Lippisches Landesmuseum Detmold Im Rahmen der Tagung zeigt das Lip- Ameide 4 32756 Detmold pische Landesmuseum Karen Russos [email protected] Film „Externsteine“ (2012) und lädt zur anschließenden Diskussion mit der Tel. 05231/9925-19 Londoner Regisseurin ein. Die Tagung wird veranstaltet von: Mit freundlicher Unterstützung durch: Lippisches Landesmuseum Detmold Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe Schutzgemeinschaft -

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

The Significance of Dehumanization: Nazi Ideology and Its Psychological Consequences
Politics, Religion & Ideology ISSN: 2156-7689 (Print) 2156-7697 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ftmp21 The Significance of Dehumanization: Nazi Ideology and Its Psychological Consequences Johannes Steizinger To cite this article: Johannes Steizinger (2018): The Significance of Dehumanization: Nazi Ideology and Its Psychological Consequences, Politics, Religion & Ideology To link to this article: https://doi.org/10.1080/21567689.2018.1425144 © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group Published online: 24 Jan 2018. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ftmp21 POLITICS, RELIGION & IDEOLOGY, 2018 https://doi.org/10.1080/21567689.2018.1425144 The Significance of Dehumanization: Nazi Ideology and Its Psychological Consequences Johannes Steizinger Department of Philosophy, University of Vienna, Vienna, Austria ABSTRACT Several authors have recently questioned whether dehumanization is a psychological prerequisite of mass violence. This paper argues that the significance of dehumanization in the context of National Socialism can be understood only if its ideological dimension is taken into account. The author concentrates on Alfred Rosenberg’s racist doctrine and shows that Nazi ideology can be read as a political anthropology that grounds both the belief in the German privilege and the dehumanization of the Jews. This anthropological framework combines biological, cultural and metaphysical aspects. Therefore, it cannot be reduced to biologism. This new reading of Nazi ideology supports three general conclusions: First, the author reveals a complex strategy of dehumanization which is not considered in the current psychological debate. -

Instrumentalising the Past: the Germanic Myth in National Socialist Context
RJHI 1 (1) 2014 Instrumentalising the Past: The Germanic Myth in National Socialist Context Irina-Maria Manea * Abstract : In the search for an explanatory model for the present or even more, for a fundament for national identity, many old traditions were rediscovered and reutilized according to contemporary desires. In the case of Germany, a forever politically fragmented space, justifying unity was all the more important, especially beginning with the 19 th century when it had a real chance to establish itself as a state. Then, beyond nationalism and romanticism, at the dawn of the Third Reich, the myth of a unified, powerful, pure people with a tradition dating since time immemorial became almost a rule in an ideology that attempted to go back to the past and select those elements which could have ensured a historical basis for the regime. In this study, we will attempt to focus on two important aspects of this type of instrumentalisation. The focus of the discussion is mainly Tacitus’ Germania, a work which has been forever invoked in all sorts of contexts as a means to discover the ancient Germans and create a link to the modern ones, but in the same time the main beliefs in the realm of history and archaeology are underlined, so as to catch a better glimpse of how the regime has been instrumentalising and overinterpreting highly controversial facts. Keywords : Tacitus, Germania, myth, National Socialism, Germany, Kossinna, cultural-historical archaeology, ideology, totalitarianism, falsifying history During the twentieth century, Tacitus’ famous work Germania was massively instrumentalised by the Nazi regime, in order to strengthen nationalism and help Germany gain an aura of eternal glory. -

Leben Und Arbeiten in Lippe
wir in lippe leben und arbeiten in lippe www.forum-lippe.de 02 INHALTSANGABE VORWORT 03 WIRTSCHAFTSSTANDORT LIPPE 04 VERKEHRSVERBINDUNGEN 05 SCHÖNER WOHNEN IN LIPPE 06 KINDER, SCHULE, BILDUNG UND GESUNDHEIT 08 SPORT 10 FREIZEIT FÜR DIE GANZE FAMILIE 12 EINKAUFEN UND GASTRONOMIE 14 KULTUR 15 EVENTS IN DER REGION 16 FORUM LIP.PE – WER WIR SIND 17 FORUM LIP.PE – WAS WIR MACHEN 18 Impressum Gestaltung MEN AT WORK Werbeagentur GmbH Druck Merkur Druck GmbH & Co. KG Auflage 1.600 Exemplare Redaktion FORUM LIP.PE Wir bedanken uns für die zur Verfügung gestellten Abbildungen unter anderem bei Franz Paus (S. 2 Bild 3 v. l.), Frank Beyer (S. 8 Bild 3 v. l.) und Jan Braun/HNF (S. 15 Bild 1 v. l.). Das Copyright für diese Abbildungen liegt bei dem jeweiligen Eigentümer. berühmte lipper Gerhard Schröder | *7.4.1944 in Mossenberg (heute Ortsteil von Blomberg) | Okt. 1998 – Nov. 2005 deutscher Bundeskanzler VORWORT 03 Liebe Leserin, lieber Leser, wenn man das erste Mal vom Lipperland hört, dann stellt man sich die Frage, wie es wohl um die Vielfältigkeit und Lebensqualität der Region bestellt ist. Wir möchten Sie mit dieser Broschüre auf eine erste Erkundungstour durch Lippe schicken, bei der Sie das Land des Hermanns und den wunderschönen Teutoburger Wald entdecken können. Aber Lippe ist viel mehr als das! Es bietet Ihnen eine moderne Arbeitswelt in zukunftsweisenden und welt- weit agierenden Unternehmen. Das vielfältige kulturelle Angebot und die Nähe zur Natur machen die Freizeit zu einem Vergnügen. Für Ihre ersten Schritte in Lippe haben wir Ihnen zahlreiche Internet-Links zur Verfügung gestellt. -

Foundations of Nazi Cultural Policy and Institutions Responsible for Its
Kultura i Edukacja 2014 No 6 (106), s. 173–192 DOI: 10.15804/kie.2014.06.10 www.kultura-i-edukacja.pl Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka1 Foundations of Nazi Cultural Policy and Institutions Responsible for its Implementation in the Period 1933 – 1939 Abstract The purpose of this article is to present and analyze the foundations and premises of Nazi cultural policy, and the bodies responsible for its imple- mentation, the two most important ones being: National Socialist Society for German Culture and the Ministry of National Enlightenment and Propa- ganda of the Reich. Policy in this case is interpreted as intentional activity of the authorities in the field of culture, aimed at influencing the attitudes and identity of the population of the Third Reich. The analysis covers the most important documents, statements and declarations of politicians and their actual activity in this domain. Adopting such a broad perspective al- lowed to comprehensively show both the language and the specific features of the messages communicated by the Nazi authorities, and its impact on cultural practices. Key words Third Reich, Nazi, cultural policy, National Socialist Society for German Culture, Ministry of National Enlightenment and Propaganda of the Reich 1 Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polnad 174 Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka 1. INTRODUCTION The phenomenon of culture is one of the most important distinctive features of individual societies and nations. In a democratic social order, creators of culture can take full advantage of creative freedom, while the public can choose what suits them best from a wide range of possibilities. Culture is also a highly variable phenomenon, subject to various influences. -

Historiographical Approaches to Past Archaeological Research
Historiographical Approaches to Past Archaeological Research Gisela Eberhardt Fabian Link (eds.) BERLIN STUDIES OF THE ANCIENT WORLD has become increasingly diverse in recent years due to developments in the historiography of the sciences and the human- ities. A move away from hagiography and presentations of scientifi c processes as an inevitable progression has been requested in this context. Historians of archae- olo gy have begun to utilize approved and new histo- rio graphical concepts to trace how archaeological knowledge has been acquired as well as to refl ect on the historical conditions and contexts in which knowledge has been generated. This volume seeks to contribute to this trend. By linking theories and models with case studies from the nineteenth and twentieth century, the authors illuminate implications of communication on archaeological knowledge and scrutinize routines of early archaeological practices. The usefulness of di erent approaches such as narratological concepts or the concepts of habitus is thus considered. berlin studies of 32 the ancient world berlin studies of the ancient world · 32 edited by topoi excellence cluster Historiographical Approaches to Past Archaeological Research edited by Gisela Eberhardt Fabian Link Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. © 2015 Edition Topoi / Exzellenzcluster Topoi der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Typographic concept and cover design: Stephan Fiedler Printed and distributed by PRO BUSINESS digital printing Deutschland GmbH, Berlin ISBN 978-3-9816384-1-7 URN urn:nbn:de:kobv:11-100233492 First published 2015 The text of this publication is licensed under Creative Commons BY-NC 3.0 DE. -

Sacred Places Europe: 108 Destinations
Reviews from Sacred Places Around the World “… the ruins, mountains, sanctuaries, lost cities, and pilgrimage routes held sacred around the world.” (Book Passage 1/2000) “For each site, Brad Olsen provides historical background, a description of the site and its special features, and directions for getting there.” (Theology Digest Summer, 2000) “(Readers) will thrill to the wonderful history and the vibrations of the world’s sacred healing places.” (East & West 2/2000) “Sites that emanate the energy of sacred spots.” (The Sunday Times 1/2000) “Sacred sites (to) the ruins, sanctuaries, mountains, lost cities, temples, and pilgrimage routes of ancient civilizations.” (San Francisco Chronicle 1/2000) “Many sacred places are now bustling tourist and pilgrimage desti- nations. But no crowd or souvenir shop can stand in the way of a traveler with great intentions and zero expectations.” (Spirituality & Health Summer, 2000) “Unleash your imagination by going on a mystical journey. Brad Olsen gives his take on some of the most amazing and unexplained spots on the globe — including the underwater ruins of Bimini, which seems to point the way to the Lost City of Atlantis. You can choose to take an armchair pilgrimage (the book is a fascinating read) or follow his tips on how to travel to these powerful sites yourself.” (Mode 7/2000) “Should you be inspired to make a pilgrimage of your own, you might want to pick up a copy of Brad Olsen’s guide to the world’s sacred places. Olsen’s marvelous drawings and mysterious maps enhance a package that is as bizarre as it is wonderfully acces- sible. -
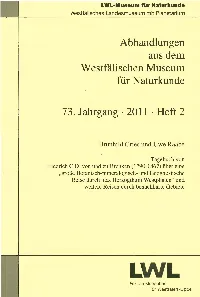
2011 ·Heft 2
LWL-Museum für Naturkunde Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 73. Jahrgang· 2011 ·Heft 2 Brunhild Gries und Uwe Raabe Tagebuch von Friedrich C.D. von und zu Brenken (1790-1867) über eine „große Botanisch-mineralogisch- und Geognostische Reise durch das Herzogthum Westphalen" und weitere Reisen durch benachbarte Gebiete LWL Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe. Hinweise für Autoren In der Zeitschrift Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde werden naturwissen schaftliche Beiträge veröffentlicht, die den Raum Westfalen betreffen. Druckfertige Manuskripte sind an die Schriftleitung zu senden. Aufbau und Form des Manuskriptes: 1. Das Manuskript soll folgenden Aufbau haben: Überschrift, darunter Name (ausgeschrieben) und Wohn ort des Autors, Inhaltsverzeichnis, kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache, klar gegliederter Haupt teil, Literaturverzeichnis (Autoren alphabetisch geordnet), Anschrift des Verfassers. 2. Manuskript auf Diskette oder CD (gängiges Programm, etwa WORD) und einseitig ausgedruckt. 3. Die Literaturzitate sollen enthalten: Autor, Erscheinungsjahr, Titel der Arbeit, Name der Zeitschrift in den. üblichen Kürzeln, Band, Seiten; bei Büchern sind Verlag und Erscheinungsort anzugeben. Beispiele: KRAMER, H. (1962): Zum Vorkommen des Fischreihers in der Bundesrepublik Deutschland. - J. Orn. 103.: 401 - 417. RUNGE, F. (1992): Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirks Osnabrück. 4. Aufl. - Aschendorff, Münster. Bei mehreren Autoren sind die Namen wie folgt zu nennen: MEYER, H„ HUBER, A. & F. BAUER (1984):„. 4. Besondere Schrifttypen im Text: fett, gesperrt, kursiv (wissenschaftliche Art- und Gattungsnamen sowie Namen von Pflanzengesellschaften), Kapitälchen (Autorennamen). Abschnitte, die in Kleindruck gebracht werden können, am linken Rand mit „petit" kennzeiclmen. 5. Die Abbildungsvorlagen (Fotos, Zeichnungen, grafische Darstellungen) müssen bei Verk!leinerung auf Satzspiegelgröße ( 12,6 x 19 ,8 cm) gut lesbar sein. -

Asatru – a Religion of Nature?
chapter 6 Asatru – A Religion of Nature? Critiques of monotheism, the promotion of polytheism, and the related dis- course on Nordic myth frequently work on the assumption that polytheism, and thus Paganism, is closer to nature and more conducive to ecological ideals than monotheisms. In comparison, monotheism and/or Christianity are seen as inimical to both natural human drives and to the natural environment. Such ideas can be traced back to theories of Germanic or Indo-European religion as fertility cults with a more intimate relation to nature than ‘desert religions,’ which allegedly originate in arid, infertile climates. These theories intersected with Romanticism’s revaluation of nature as a metaphor for the primordial, unspoiled, and pure.1 They were taken up positively in the primitivist neo- Romantic currents around 1900, which in turn inspired new, alternative reli- gions. Since then, ideas about a Pagan and Nordic nature spirituality have developed a remarkable productivity. They have influenced Western percep- tions of nature and the natural within ecological and new spiritual movements and beyond. This is evident in the fact that many people today experience nature as a realm for spiritual, or at least uplifting, experiences. Equally widespread is the idea that Christianity or monotheism, with its mandate to ‘subdue the earth,’ is responsible for the destruction of the natural environment, whereas Paganism sees nature as animated, and thus supposedly treats it with more respect. Over the last few decades, environmentalism and environmental spiritual- ity have enjoyed a reputation as being progressive. Therefore, the widespread self-understanding of Asatru as a ‘religion of nature’ is much less controversial than the issues of ethnicity and concepts of religion with which it intersects. -

Hyperion. ISBN 0-7868-6886-4
great deal remains to provide much of the texture of this excellent introduction to the collection. But Greis has also opened a window on the practice of archaeology at the beginning of the last century that adds to our understanding of the ways in which archaeology was practiced by the emerging class of ‘professionals’ and the heirs to a long tradition of amateur activity. Heather Pringle 2006. The Master Plan: Himmler’s Scholars and the Holocaust. New York: Hyperion. ISBN 0-7868-6886-4. Reviewed by Bruce G. Trigger, McGill University National Socialism provides a chilling example of what can happen when a modern nation state falls under the control of an organization that resembles a criminal syndicate more than it does a political party. Unfortunately, only a few papers are available in English that deal with how archaeology fared under this totalitarian regime. Now Heather Pringle has published a book which provides a narrative history of the Ahnenerbe, or Ancestral Heritage Foundation, a research institute founded in 1935 by Heinrich Himmler, Hitler’s minister of security who was also responsible for the implementation of Nazi racial and resettlement policies. In addition to being, like other Nazis, nationalistic and anti- Semitic, Himmler was an extreme romantic who planned to use the tall, blond-haired men of his security service (Schutzstaffel, SS) and selected women to re-breed a pure ‘Aryan’ stock, and to use knowledge collected by Ahnenerbe researchers to tutor these men in ancient German beliefs and farming practices so they might live as their noble ancestors had done. -

A Case-Study of the German Archaeologist Herbert Jankuhn (1905-1990)
Science and Service in the National Socialist State: A Case-Study of the German Archaeologist Herbert Jankuhn (1905-1990) by Monika Elisabeth Steinel UCL This thesis is submitted for examination for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) January 2009 DECLARATION I, Monika Elisabeth Steinel, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. January 2009 2 ABSTRACT The thesis investigates the relationship between archaeology, politics and ideology through a case-study of the prominent German archaeologist Herbert Jankuhn (1905- 1990). It addresses the following questions: what role do archaeological scholars assume in a totalitarian state’s organisational structures, and what may motivate them to do so? To what extent and how are archaeologists and their scientific work influenced by the political and ideological context in which they perform, and do they play a role in generating and/or perpetuating ideologies? The thesis investigates the nature and extent of Jankuhn's practical involvement in National Socialist hierarchical structures, and offers a thematically structured analysis of Jankuhn's archaeological writings that juxtaposes the work produced during and after the National Socialist period. It investigates selected components of Herbert Jankuhn's research interests and methodological approaches, examines his representations of Germanic/German pre- and protohistory and explores his adapting interpretations of the early medieval site of Haithabu in northern Germany. The dissertation demonstrates that a scholar’s adaptation to political and ideological circumstances is not necessarily straightforward or absolute. As a member of the Schutzstaffel, Jankuhn actively advanced National Socialist ideological preconceptions and military aims.