Im Duell Mit Beethoven
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
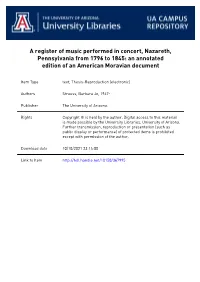
A Register of Music Performed in Concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an Annotated Edition of an American Moravian Document
A register of music performed in concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an annotated edition of an American Moravian document Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Strauss, Barbara Jo, 1947- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 23:14:00 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/347995 A REGISTER OF MUSIC PERFORMED IN CONCERT, NAZARETH., PENNSYLVANIA FROM 1796 TO 181+52 AN ANNOTATED EDITION OF AN AMERICAN.MORAVIAN DOCUMENT by Barbara Jo Strauss A Thesis Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC WITH A MAJOR IN MUSIC HISTORY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 1 9 7 6 Copyright 1976 Barbara Jo Strauss STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial fulfill ment of requirements for an advanced degree at The Univer sity of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate ac knowledgment of source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manu script in whole or in part may -

The Magic Flute
WOLFGANG AMADEUS MOZART the magic flute conductor Libretto by Emanuel Schikaneder Harry Bicket Saturday, December 29, 2018 production 1:00–2:45 PM Julie Taymor set designer George Tsypin costume designer Julie Taymor lighting designer The abridged production of Donald Holder The Magic Flute was made possible by a puppet designers Julie Taymor gift from The Andrew W. Mellon Foundation Michael Curry and Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick choreographer Mark Dendy The original production of Die Zauberflöte was made possible by a revival stage director David Kneuss gift from Mr. and Mrs. Henry R. Kravis english adaptation J. D. McClatchy Additional funding was received from John Van Meter, The Annenberg Foundation, Karen and Kevin Kennedy, Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick, Mr. and Mrs. William R. general manager Miller, Agnes Varis and Karl Leichtman, and Peter Gelb Mr. and Mrs. Ezra K. Zilkha jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON The Magic Flute is The 447th Metropolitan Opera performance of performed without intermission. WOLFGANG AMADEUS MOZART’S This performance is being broadcast the magic flute live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera conductor International Radio Harry Bicket Network, sponsored by Toll Brothers, in order of vocal appearance America’s luxury ® tamino second spirit homebuilder , with Ben Bliss* Eliot Flowers generous long- first l ady third spirit term support from Gabriella Reyes** N. Casey Schopflocher the Annenberg Foundation and second l ady spe aker GRoW @ Annenberg, Emily D’Angelo** Alfred Walker* The Neubauer Family third l ady sar astro Foundation, the Maria Zifchak Morris Robinson* Vincent A. -
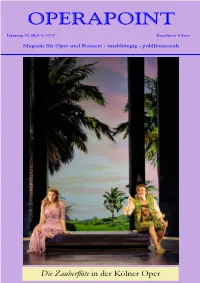
Opeapoint 4 Jg20.Indd
OPERAPOINT Jahrgang 20, Heft 4, 2020 Einzelpreis 6 Euro Magazin für Oper und Konzert - unabhängig - publikumsnah Die Zauberfl öte in der Kölner Oper Hier lege ich Ihnen, liebe Lesergemeinde, das 4. Heft 2020 vor. Diesmal wird es durch die verschiedenen Festivals ermöglicht, zwölf Opernrezen- Editorial sionen vorzustellen. Die meisten Kritiken verdanken wir unserem uner- müdlichen Redakteur Oliver Hohlbach. Er durchfährt mit viel Courage die deutschen und ausländischen Länder und erläutert mit Sachverstand die vorgeschriebenen Verordnungen der Regierungen, die dem Volk die Ansteckungen des Virus ersparen wollen. Den Sommerurlaub verbrachte unser Boardmitglied Dr. Martin Knust auf einem Segeltörn in Schweden. Es läßt seine Bürger trotz Virusge- fahr – trotz erheblicher Kritik vieler Länder – frei handeln. In der Nähe Stockholms gibt es eine ausgedehnte Schärenlandschaft. Dr. Knust schil- dert neben der Landschaft mit vielen eindrucksvollen Seebildern auch den schwedischen Komponisten Hugo Alfvén, der kaum jemand der Leser- schaft bekannt seine dürfte, dessen Werke aber großen Hörgenuß berei- ten. Auch in Köln gab es die Oper Die Zauberfl öte ohne Kürzungen in der bewährten Regie von Michael Hampe, dessen unvergeßlicher Zeiten als Kölner Opernintendant von zwei Jahrzehnten 1975-1995 man sich in der jetzigen Theaterinstanz entsann und ihn zu dieser Inszenierung eingela- den hat. Die reduzierten Opernbesucher quittierten seine intelligente und gekonnte Leistung mit starkem Applaus. Die Sängerschar der Premiere, die ich am 3. Oktober 2020 besuchte, ist über die Maßen zu loben. Einer davon, der französische Tenor Julien Behr, war bereit, mir ein Interview zu gewähren, das Sie auf Seite 15 lesen können. Eine der Erscheinungen, die diese Zeiten hervorgebracht haben, ist die Entdeckung der Sächsischen Landschaft in Deutschland. -

Der Stein Der Weisen and Die Zauberflöte
Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology Volume 12 | Issue 1 Article 3 Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte Mercer Greenwald Bard College Conservatory of Music Recommended Citation Greenwald, Mercer. “Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zaouberflöte.” Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology Vol. 12, no. 1 (2019): 30-45. https://doi.org/10.5206/notabene.v12i1.8145 Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte Abstract This paper probes how the rational and the irrational interact in Enlightenment operatic plots, and explores the effect of this interaction on the Viennese public. To do this, I will investigate the fantastic worlds of two operas premiered by the same opera company, both with libretti written by Emanuel Schikaneder: Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel (1790) and Die Zauberflöte (1791). David J. Buch’s seminal book Magic Flutes and Enchanted Forests (2008) explores the intertextual threads of magical ideas in Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte, that is, how librettists and composers translated and reprocessed magical themes. I will draw on Buch’s comparison to show how these intertextual connections can be read for their broad cultural resonances. In this paper, I will first establish the connections between Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte in plot and in music. Then I will show how the later opera diverges from its predecessor and discuss how it manages to diminish the polarity of rationality and irrationality considered central to Enlightenment thinking. Ultimately, I argue, Die Zauberflöte facilitates its audience’s access to Enlightenment values by magical means. -

Joseph Woelfl Streichquartette Op. 4 Und Op. 10
Joseph Woelfl Streichquartette Op. 4 und Op. 10 Quatuor Mosaïques Erich Höbarth und Andrea Bischof, Violine Anita Mitterer, Viola Christophe Coin, Violoncello paladino music Quatuor Mosaïques Erich Höbarth und/and Andrea Bischof Violinen, Franz Geissenhof, Wien 1806, Inv.-Nrr. SAM 683 und 684 Violins, Franz Geissenhof, Vienna 1806, Inv.-No. SAM 683 and 684 Anita Mitterer Abb. auf S. 1: Viola, Franz Geissenhof, Violine, Franz Geissenhof, Wien 1806, Wien 1797, Inv.-Nr. SAM 683 Inv.-Nr. SAM 685 Ill. on p. 1: Viola, Franz Geissenhof, Violin, Franz Geissenhof, Vienna 1806, Vienna 1797, Inv.-No. SAM 683 Inv.-No. SAM 685 Christophe Coin Violoncello, Franz Geissenhof, Wien 1794, Inv.-Nr. SAM 686 Violoncello, Franz Geissenhof, Vienna 1794, Inv.-No. SAM 686 Deutsch: Seite Franz Geissenhofs Instrumente 4 Joseph Woelfl 7 English: page Franz Geissenhof‘s instruments 12 Joseph Woelfl 15 2 FRANZ GEISSENHOFS INSTRUMENTE Joseph Woelfl (1773 –1812) Streichquartett Op. 4 Nr. 3, c-Moll 01 Allegro 7'46 02 Menuetto (Allegretto) 4'37 03 Adagio ma non troppo 7'35 04 Finale (Presto) 5'57 Streichquartett Op. 10 Nr. 4, G-Dur 05 Allegro 7'24 06 Menuetto (Allegro) 3'41 07 Andante 5'10 08 Prestissimo 4'16 Streichquartett Op. 10 Nr. 1, C-Dur 09 Allegro moderato 7'35 10 Andante 8'11 11 Menuetto (Allegro) 4'05 12 Allegro 5'26 Gesamtspielzeit / total duration: 74'00 3 FRANZ GEISSENHOFS INSTRUMENTE Druckzettel von Franz Geissenhofs Violine von 1806 Inv.-Nr. SAM 683 Franz Geissenhof war der einflussreichste Geigenbauer zur Zeit der Wiener Klassik. Völlig zu Recht wurde er bereits kurz nach seinem Tod mit dem Beinamen eines „Wiener Stradivari“ Printed label of Franz Geissenhof’s violin bedacht, was nicht nur als eine schmeichelhafte Anspielung auf seine handwerklichen Fähig- from 1806 Inv.-No. -
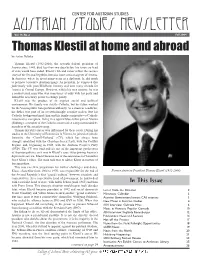
Fall 04 9-16.Idd
CENTER FOR AUSTRIAN STUDIES AUSTRIAN STUDIES NEWSLETTER Vol. 16, No. 2 Fall 2004 Thomas Klestil at home and abroad by Anton Pelinka Thomas Klestil (1932-2004), the seventh federal president of Austria since 1945, died less than two days before his tenure as head of state would have ended. Klestil’s life and career reflect the success story of the Second Republic, but also some critical aspects of Austria. In America, where he spent many years as a diplomat, he did much to promote a positive Austrian image. As president, he tempered that judiciously with post-Waldheim honesty and won many friends for Austria in Central Europe. However, within his own country, he was a controversial man who was sometimes at odds with his party and lacked the necessary power to change policy. Klestil was the product of an atypical social and political environment: His family was strictly Catholic, but his father worked for the Vienna public transportation authority. As a streetcar conductor, his father was part of an overwhelmingly socialist milieu. But his Catholic background made him and his family a minority—a Catholic conservative exception, living in a typical blue-collar part of Vienna (Erdberg); a member of the Catholic conservative camp surrounded by members of the socialist camp. Thomas Klestil’s career was influenced by these roots. During his studies at the University of Economics in Vienna, he joined a Catholic fraternity—the “Cartell-Verband” (CV), which has always been strongly identified with the Christian Social Party, with the Dollfuß Regime and, beginning in 1945, with the Austrian People’s Party (ÖVP). -

Mozart's Operas, Musical Plays & Dramatic Cantatas
Mozart’s Operas, Musical Plays & Dramatic Cantatas Die Schuldigkeit des ersten Gebotes (The Obligation of the First and Foremost Commandment) Premiere: March 12, 1767, Archbishop’s Palace, Salzburg Apollo et Hyacinthus (Apollo and Hyacinth) Premiere: May 13, 1767, Great Hall, University of Salzburg Bastien und Bastienne (Bastien and Bastienne) Unconfirmed premiere: Oct. 1768, Vienna (in garden of Dr Franz Mesmer) First confirmed performance: Oct. 2, 1890, Architektenhaus, Berlin La finta semplice (The Feigned Simpleton) Premiere: May 1, 1769, Archbishop’s Palace, Salzburg Mitridate, rè di Ponto (Mithridates, King of Pontus) Premiere: Dec. 26, 1770, Teatro Regio Ducal, Milan Ascanio in Alba (Ascanius in Alba) Premiere: Oct. 17, 1771, Teatro Regio Ducal, Milan Il sogno di Scipione (Scipio's Dream) Premiere: May 1, 1772, Archbishop’s Residence, Salzburg Lucio Silla (Lucius Sillus) Premiere: Dec. 26, 1772, Teatro Regio Ducal, Milan La finta giardiniera (The Pretend Garden-Maid) Premiere: Jan. 13, 1775, Redoutensaal, Munich Il rè pastore (The Shepherd King) Premiere: April 23, 1775, Archbishop’s Palace, Salzburg Thamos, König in Ägypten (Thamos, King of Egypt) Premiere (with 2 choruses): Apr. 4, 1774, Kärntnertor Theatre, Vienna First complete performance: 1779-1780, Salzburg Idomeneo, rè di Creta (Idomeneo, King of Crete) Premiere: Jan. 29, 1781, Court Theatre (now Cuvilliés Theatre), Munich Die Entführung aus dem Serail (The Abduction from the Seraglio) Premiere: July 16, 1782, Burgtheater, Vienna Lo sposo deluso (The Deluded Bridegroom) Composed: 1784, but the opera was never completed *Not performed during Mozart’s lifetime Der Schauspieldirektor (The Impresario) Premiere: Feb. 7, 1786, Palace of Schönbrunn, Vienna Le nozze di Figaro (The Marriage of Figaro) Premiere: May 1, 1786, Burgtheater, Vienna Don Giovanni (Don Juan) Premiere: Oct. -

The Magic Flute
The Magic Flute PRODUCTION INFORMATION Music: Wolfgang Amadeus Mozart Text (English): Emanuel Schikaneder English Translation: J.D. McClatchy World Premiere: Vienna, Theater auf der Wieden Austria, September 30, 1791 Final Dress Rehearsal Date: Friday, December 13, 2013 Note: the following times are approximate 10:30am – 12:30pm Cast: Pamina Heidi Stober Queen of the Night Albina Shagimuratova Tamino Alek Shrader Papageno Nathan Gunn Speaker Shenyang Sarastro Eric Owens Production Team: Conductor Jane Glover Production Julie Taymor Set Designer George Tsypin Costume Designer Julie Taymor Lighting Designer Donald Holder Puppet Designers Julie Taymor and Michael Curry Choreographer Mark Dendy 2 Table of Contents Production Information 2 An Introduction to Pathways for Understanding Study Materials 4 Meet the Characters 5 The Story of The Magic Flute Synopsis 6 Guiding Questions 8 The History of Mozart’s The Magic Flute 10 Guided Listening Overture 12 I’m sure that there could never be 13 Such loveliness beyond compare 14 Don’t be afraid, now hear my song 15 The wrath of hell is burning in my bosom 16 Now I know that love can vanish 17 If only I could meet her 18 Pa-pa-ge-na! – Pa-pa-ge-no! 19 The Magic Flute Resources About the Composer 20 The Enlightenment & Singspiel 22 Online Resources 25 Additional Resources The Emergence of Opera 26 Metropolitan Opera Facts 30 Reflections after the Opera 32 A Guide to Voice Parts and Families of the Orchestra 33 Glossary 34 References Works Consulted 38 3 An Introduction to Pathways for Understanding Study Materials The goal of Pathways for Understanding materials is to provide multiple “pathways” for learning about a specific opera as well as the operatic art form, and to allow teachers to create lessons that work best for their particular teaching style, subject area, and class of students. -
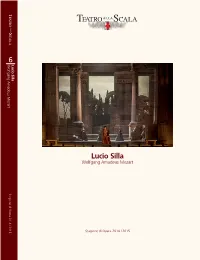
Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S T a G I O N E D I O P E R a 2 0 1 4 / 2 0 1
6 W L u o c l i f o g a S n i l g l a A m a d e u s M o z a r t Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S t a g i o n e d i O p e r a 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Stagione di Opera 2014 / 2015 Lucio Silla Dramma in musica in tre atti Libretto di Giovanni De Gamerra Musica di Wolfgang Amadeus Mozart Nuova produzione In coproduzione con Mozartwoche Salzburg/Fondazione Mozarteum e Festival di Salisburgo EDIZIONI DEL TEATRO ALLA SCALA TEATRO ALLA SCALA PRIMA RAPPRESENTAZIONE Giovedì 26 febbraio 2015, ore 20 - Turno E REPLICHE febbraio Sabato 28 Ore 20 – Turno D marzo Martedì 3 Ore 20 – ScalAperta Giovedì 12 Ore 20 – Turno B Sabato 14 Ore 20 – Turno A Martedì 17 Ore 20 – Turno C SOMMARIO 4 Lucio Silla . Il libretto 28 Il soggetto Argument – Synopsis – Die Handlung – ࠶ࡽࡍࡌ – Сюжет Cesare Fertonani 40 L’opera in breve Cesare Fertonani 42 La musica Giancarlo Landini 45 Luci del crepuscolo Il Lucio Silla di Mozart per Milano Raffaele Mellace 79 Modernità in veste storica Marc Minkowski parla di Mozart e di Lucio Silla 85 Wolfgang A. Mozart - Lucio Silla Ronny Dietrich 104 Lucio Silla alla Scala Luca Chierici 113 Marc Minkowski 115 Marshall Pynkoski 116 Antoine Fontaine 117 Jeannette Lajeunesse Zingg 118 Hervé Gary 119 Lucio Silla . I personaggi e gli interpreti 121 Wolfgang Amadeus Mozart. Cesare Fertonani Cronologia della vita e delle opere 128 Letture Cesare Fertonani 130 Ascolti Luigi Bellingardi 133 Coro del Teatro alla Scala 134 Orchestra del Teatro alla Scala 135 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 136 Teatro alla Scala Wolfgang Amadeus Mozart . -

Neuerwerbungen Bibliothek Januar Bis Juli 2018
1 BEETHOVEN-HAUS BONN Neuerwerbungen Bibliothek Januar bis Juli 2018 Auswahlliste 2018,1 1. Musikdrucke 1.1. Frühdrucke bis 1850 S. 2 1.2. Neuausgaben S. 5 2. Literatur 2.1. Frühdrucke S. 6 2.2. Neuere Bücher und Aufsätze S. 7 2.3. Rezensionen S. 22 3. Tonträger S. 24 2 1. Musikdrucke 1.1. Frühdrucke C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 18 – Knight] Air and variations : from the 5th quartet, op. 18 / Beethoven. – 1834 Stereotypie. – Anmerkung am Ende des Notentextes: The Menuetto, p. 46, to / follow at pleasure (es handelt sich um das Menuett aus op. 10,3). – S.a. die spätere Auflage von 1844 (C 252 / 175). In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 44-45 C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 20 – Knight] A selection from Beethoven's grand septet, arranged for the piano-forte and flute. – [Klavierpartitur]. – 1834 Stereotypie. In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 25-33 C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 43 – Knight] Introduction and air, from the same / [Beethoven]. – [Klavierauszug]. – 1834 Stereotypie. – Bearbeitung der Nr. 5 (Adagio und Andante quasi Allegretto) aus "Die Geschöpfe des Prometheus" (op. 43,8), "The same" bezieht sich auf die vorangehenden Stücke (Ouvertüre und Nr. 8) ab S. 102. – S.a. die spätere Auflage von 1844 (C 252 / 175). In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 109-112 C 49 / 45 Beethoven, Ludwig van: [Op. 49 – Walker] Two sonatas, for the piano forte : op. 49 / composed by L. -
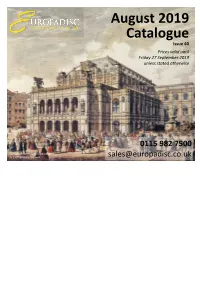
August 2019 List
August 2019 Catalogue Issue 40 Prices valid until Friday 27 September 2019 unless stated otherwise 0115 982 7500 The Wiener Staatsoper, celebrating its 150th birthday this year [email protected] Your Account Number: {MM:Account Number} {MM:Postcode} {MM:Address5} {MM:Address4} {MM:Address3} {MM:Address2} {MM:Address1} {MM:Name} 1 Welcome! Dear Customer, DG and Decca have pulled out all the operatic stops this month, with three very special releases featuring some of their best soloists. Mexican tenor Javier Camarena’s ‘Contrabandista’ recital marks the first issue in the ‘Mentored by Bartoli’ series on Decca - a partnership between Decca and the Cecilia Bartoli Music Foundation. Arias by Verdi are the focus of DG’s new recording from Russian bass, Ildar Abdrazakov, conducted by Yannick Nezet-Seguin, who also happens to take the lead in a brand new recording of Die Zauberflote, the sixth in DG’s current series of Mozart operas. It is the latter that we have been particularly taken by, so you will find it as our ‘Disc of the Month’ for August, as well as being at a very special price as part of our new DG & Decca Opera Sale (found on pp.13-18). Another recording which was a strong contender for the ‘Disc of the Month’ position, was Mahan Esfahani’s performance of Bach’s Toccatas on a rather fabulous harpsichord - Hyperion have done a sterling job in capturing Esfahani’s consummate skill in interpreting these works. Other highlights for August include the second instalment in The Illyria Consort’s recordings of sonatas by Carbonelli; hi-fi Holst and Elgar from the Bergen Philharmonic and Andrew Litton on BIS; lesser-known Beethoven from the Helsinki Baroque Orchestra, who provide us with a gripping performance of Beethoven’s complete incidental music to Egmont (Ondine); plus we have Messiaen from Tom Winpenny (Naxos), Handel from the Akademie fur Alte Musik Berlin (Pentatone), and Brahms/Dvorak from Jakub Hrusa and the Bamberger Symphoniker (Tudor), to name but a few. -

The House Composers of the Theater Auf Der Wieden in the Time of Mozart (1789-91)1
The House Composers of the Theater auf der Wieden in the Time of Mozart (1789-91)1 DAVID J. BUCH Some of the most important theatrical music in Europe was produced at the Theater auf der Wieden in suburban Vienna in the years 1789 to 1801. Beginning with the immensely popular Die zween Anton oder der dumme Gärtner aus dem Gebirge in July 1789, Emanuel Schikaneder produced one successful singspiel after another. The most successful of these were quickly staged in other European venues, both in the original German and in translation.2 Yet, until recently, we have known only a single opera from that period, Mozart’s Die Zauberflöte. Because scholars have not studied this repertory,3 a myth of singularity for Mozart’s singspiel has dominated the secondary literature. But Mozart’s opera was in fact the fourth in a series of fairy-tale singspiels based on texts associated with Christoph Martin Wieland. And the music of Mozart’s singspiel is firmly rooted in a unique style developed at the theater by a group of talented composers who interacted with Mozart, both learning from the master and influencing him in turn. Another myth about this theater has also persisted in modern literature, namely, that the music was of an inferior quality and that the performances were rather crude. While there is one derisive review of a performance at the Theater auf der Wieden by a north German commentator in 1793,4 most contemporary reviews were positive, noting a high standard of musical performance. In his unpublished autobiography, Ignaz von Seyfried recalled performances of operas in the early 1790s by Mozart, Süßmayr, Hoffmeister etc., writing that they were performed with rare skill (ungemein artig).