Joseph Woelfl Streichquartette Op. 4 Und Op. 10
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
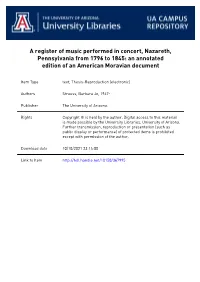
A Register of Music Performed in Concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an Annotated Edition of an American Moravian Document
A register of music performed in concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an annotated edition of an American Moravian document Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Strauss, Barbara Jo, 1947- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 23:14:00 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/347995 A REGISTER OF MUSIC PERFORMED IN CONCERT, NAZARETH., PENNSYLVANIA FROM 1796 TO 181+52 AN ANNOTATED EDITION OF AN AMERICAN.MORAVIAN DOCUMENT by Barbara Jo Strauss A Thesis Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC WITH A MAJOR IN MUSIC HISTORY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 1 9 7 6 Copyright 1976 Barbara Jo Strauss STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial fulfill ment of requirements for an advanced degree at The Univer sity of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate ac knowledgment of source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manu script in whole or in part may -

Neuerwerbungen Bibliothek Januar Bis Juli 2018
1 BEETHOVEN-HAUS BONN Neuerwerbungen Bibliothek Januar bis Juli 2018 Auswahlliste 2018,1 1. Musikdrucke 1.1. Frühdrucke bis 1850 S. 2 1.2. Neuausgaben S. 5 2. Literatur 2.1. Frühdrucke S. 6 2.2. Neuere Bücher und Aufsätze S. 7 2.3. Rezensionen S. 22 3. Tonträger S. 24 2 1. Musikdrucke 1.1. Frühdrucke C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 18 – Knight] Air and variations : from the 5th quartet, op. 18 / Beethoven. – 1834 Stereotypie. – Anmerkung am Ende des Notentextes: The Menuetto, p. 46, to / follow at pleasure (es handelt sich um das Menuett aus op. 10,3). – S.a. die spätere Auflage von 1844 (C 252 / 175). In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 44-45 C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 20 – Knight] A selection from Beethoven's grand septet, arranged for the piano-forte and flute. – [Klavierpartitur]. – 1834 Stereotypie. In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 25-33 C 252 / 190 Beethoven, Ludwig van: [Op. 43 – Knight] Introduction and air, from the same / [Beethoven]. – [Klavierauszug]. – 1834 Stereotypie. – Bearbeitung der Nr. 5 (Adagio und Andante quasi Allegretto) aus "Die Geschöpfe des Prometheus" (op. 43,8), "The same" bezieht sich auf die vorangehenden Stücke (Ouvertüre und Nr. 8) ab S. 102. – S.a. die spätere Auflage von 1844 (C 252 / 175). In: The musical library : instrumental. – London : Charles Knight. – Vol. I. – 1834. – S. 109-112 C 49 / 45 Beethoven, Ludwig van: [Op. 49 – Walker] Two sonatas, for the piano forte : op. 49 / composed by L. -

DA PONTE DAY ‐ Tuesday, October 7, 2014
DA PONTE DAY http://vocedimeche.net/ ‐ Tuesday, October 7, 2014 Teresa Tièschky and Matthias Winckhler On occasion of the celebration of "Da Ponte Day", the Austrian Cultural Forum presented a fine recital in their acoustically perfect small hall last night. With impeccable scholarship, pianist Wolfgang Brunner assembled a varied program of piano music alternating with arias and duets by Mozart for which Da Ponte wrote the libretti. Two excellent young singers from the Universität Mozarteum Salzburg were brought over to perform and we are delighted to report that they did justice to Mozart's music and Da Ponte's texts. We have written several times about the challenges of singing lieder in a large hall‐‐especially the challenge of creating intimacy. In this case we had the opposite situation, one of scaling back large operatic arias and duets to suit a small hall. This, the two talented young German singers accomplished without sacrificing the grandeur. Mozart must be "in the blood" so to speak. Selections from Nozze di Figaro, Don Giovanni and Così Fan Tutte were presented‐‐all the highlights we have come to know and love. Soprano Teresa Tièschky has the lovely light coloratura that we enjoy hearing and just the right personality for Susanna. She introduced us to an aria we had never before heard which had been specially written for Adriana del Bene detta la Ferrarese for the 1789 revival of the opera. The recitativo proceeded as expected but then...big surprise...no "Deh, vieni non tardar" but "Al desio di chi t'adora". We'd love to hear it again! Miss T. -
Joseph Woelfl
Institut für Österreichische Musikdokumentation Österreichische für Institut Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Österreichischen der Musiksammlung Im Duell mit Beethoven – Joseph Woelfl Mittwoch, 20. November 2013, 19:30 Uhr Palais Mollard, Salon Hoboken 1010 Wien, Herrengasse 9 Eintritt frei Programm Werke von Joseph Woelfl Sonate über „Die Schöpfung“ A-Dur op.14, Nr. 1 Allegro moderato – Adagio – Allegro Elena Denisova / Violine Alexei KornienKo / Klavier Die Geister des Sees Eine Ballade von Fräulein Amalie von Imhof WoO 20,1 Christa ratzenböcK / Sopran Margit HaiDer-DecHant / Klavier Sonate über „Die Schöpfung“ D-Dur op.14, Nr. 2 Allegro maestoso – Moderato – Allegro Elena Denisova / Violine Alexei KornienKo / Klavier Thomas Leibnitz im Gespräch mit Margit HaiDer- DecHant 2 Zu Leben und Werk Joseph Woelfls Jugend in Salzburg, Warschau und Wien Joseph Woelfl, am 24. Dezember 1773 als Sohn des fürstbischöflichen Verwaltungsjuristen Johann Paul Woelfl in Salzburg geboren, wuchs in dem Haus auf, in dem auch der Salzburger Hoforganist Michael Haydn wohnte. Die Familie gehörte dem einfachen Adel an. Es ist unklar, ob Woelfl seine frühe musikalische Ausbildung beim jüngeren Haydn erhielt oder bei Leopold Mozart, dem Vizekapellmeister der Hofkapelle, der nachweislich mit Woelfls Vater bekannt war. Neue Forschungen legen nahe, dass er mit der Ausbildung auf Violine und Klavier bei Leopold Mozart begann. Bereits als siebenjähriger Knabe trat er öffentlich als Violinvirtuose auf. Seine offensichtliche musikalische Begabung führte zu seiner Aufnahme ins „Kapellhaus“, ein eigens für die Unterrichtung der Domsängerknaben errichtetes Internatsgebäude. Nun waren Michael Haydn und Leopold Mozart auch offiziell seine Lehrer. Die religiös streng reglementierte Ausbildung umfas- ste neben dem Musikunterricht auch die Aneignung von naturwissenschaftlichem und sprachlichem Allgemeinwissen. -

Im Duell Mit Beethoven
Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien November 2019 Im Duell mit Beethoven Zur Wiederentdeckung Joseph Woelfls Konnten sie wirklich Kontrahenten auf Augenhöhe sein? Ludwig van Beethoven und Joseph Woelfl? Tatsächlich traten sie gegeneinander an. Luisa Imorde spürt pianistisch dem historischen „Klavierduell“ nach. Und Thomas Leibnitz stellt den heute kaum mehr bekannten Beethoven-Herausforderer vor. Ziemlich unnachsichtig geht die Musikgeschichte – hier im Gleichschritt mit der allgemeinen Geschichtsschreibung – mit jenen Komponisten um, die es trotz aller Verdienste nicht schafften, sich im exklusiven Zirkel der „Überzeitlichen“, der gleichsam der Geschichte enthobenen Klassiker, zu etablieren. Sie ist nicht ungerecht, die Musikgeschichte, wenn sie uns bei der Frage nach dem musikalischen Wien des frühen 19. Jahrhunderts Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Franz Schubert als Repräsentanten einer ganzen Epoche in den Sinn kommen lässt. Ein geheimnisvolles, noch nicht ausreichend untersuchtes Zusammenspiel zwischen der Vox populi und dem Urteil von Experten hat zur Fokussierung auf die „großen Namen“ geführt, die sich – wer wollte es bestreiten – ihrer glanzvollen Sonderstellung als durchaus würdig erweisen. Und doch ein wenig den Blick auf die Wirklichkeit des Musiklebens dieser Zeit verstellen, in dem sie „vorkommen“, aber keineswegs die Szene in einer Weise beherrschen, die ihrer heutigen Alleinvertretung entspricht. Abseits der öffentlichen Wahrnehmung Eine imaginäre Reise in das Wien des frühen 19. Jahrhunderts -

Waack C Karl Waack C KARL VAHAHK Waart C Edo De Waart C
Waack C Karl Waack C KARL VAHAHK Waart C Edo de Waart C AY-doh duh WAHAHRT Waart C Hendrikus Aloysius Petrus de Waart C henn-DREE-küss ah-LO-sihüss PEH-trüss duh WAHAHRT Wach auf C VAHK AHÔÔF (Awaken) C (anonymous poem set to music by Ludwig Spohr [LOOT-vihh SHPOHR] — also known as Louis Spohr [lôôee spawr]) Wach auf wach auf du deutsches land C Wach auf, wach auf, du deutsches Land C VAHK AHÔÔF, VAHK AHÔÔF, doo DOYT-shuss LAHNT C (excerpt from the Sacred Songbook of Wittenberg [VITT-tunn-pehrk] by Johann Walter [YO-hahn VAHL-tur]) Wachet auf ruft uns die stimme C Wachet auf, ruft uns die Stimme C VAH-kett AHÔÔF, RÔÔFT ôôns dee SHTIMM-muh C (Awake cries the voice of the watchman in the tower) C (title of a chorale and also the title given to a cantata [kunn-TAH-tuh] containing the chorale by Johann Sebastian Bach [YO-hahn {suh-BASS-tihunn BAHK} zay-BAH-stihahn BAHK]) Wachs C Judith Wachs C JOO-duth WAHKSS Wachs C Paul Étienne Victor Wachs C pohl ay-teeenn veek-tawr vahkss Wachsmann C Klaus P. Wachsmann C KLAHÔÔSS (P.) VAHKSS-mahn C (known also as Klaus Philipp [FEE-lipp] Wachsmann) Wachtel C Theodor Wachtel C TAY-o-dohohr VAHK-tull Wachter C Eberhard Wächter C AY-bur-hart VEHH-tur Wachtmeister C Count Axel Raoul Wachtmeister C (Count) ACK-sell rahAHÔÔL VAHKT- mayss-tur Wackernagel C Philipp Wackernagel C FEE-lipp VAH-kur-nah-gull Wadsworth C Charles Wadsworth C CHAH-rullz WAHDZ-wurth Waechter C Eberhard Waechter C AY-bur-hart VEHH-tur Waefelghem C Louis van Waefelghem C lôôEE vunn WAH-fell-kemm Waelput C Hendrik Waelput C HENN-drick WAHL-püt -

TOC 0383 CD Booklet
JOSEPH WOELFL: A BIOGRAPHICAL OUTLINE by Margit Haider-Dechant Joseph Johann Baptist Woelf1 was born on 24 December 1773 in Salzburg, where his aristocratic father, Johann Paul Wölf (1737–95), worked as a lawyer in the fnancial administration of the Prince-Archbishop.2 From early childhood Woelf beneftted from piano and violin lessons from Leopold Mozart and, afer his mother’s untimely death, was even received into the Mozart household as a family member – although it was a service for which they were reimbursed, as a letter by Leopold Mozart of 28 October 1785 makes clear. Woelf gave his frst public concert at the age of seven, as a solo violinist. In 1783, as a chorister of Salzburg Cathedral, he entered the Kapellhaus, its music-school, where his teachers once more included Leopold Mozart, as well as Michael Haydn and other notable German and Italian musicians, among them Domenico Fischietti, who taught him composition, and the castrato Francesco Cecarelli. At the same time, his piano-lessons continued, now with Nannerl Mozart, Wolfgang’s elder sister. Between 1786 and 1788 Woelf was a student at the Benediktiner-Universität in Salzburg. Te following two years of his life are poorly documented, although it seems reasonable to assume that during this time, under the guidance of Michael Haydn (the only teacher in Salzburg whose teaching methods were thorough enough for the standard Woelf had now reached), he developed into an accomplished musician, since by the time he visited Wolfgang Mozart in Vienna in 1790, he had become a refned pianist. Te church and chamber-music works that survive from his time in Salzburg show that he was already active as a composer – the earliest of them date from c. -

Die Litaneien Von Wolfgang Amadeus Mozart Und Die Salzburger Tradition Einleitung 1
Karina Zybina DIE LITANEIEN VON WOLFGANG AMADEUS MOZART UND DIE SALZBURGER TRADITION Einleitung 1 Karina Zybina Die Litaneien von Wolfgang Amadeus Mozart und die Salzburger Tradition 2 Karina Zybina Meiner Familie Einleitung 3 Karina Zybina Die Litaneien von Wolfgang Amadeus Mozart und die Salzburger Tradition 4 Karina Zybina Eine Veröffentlichung des Arbeitsschwerpunktes Salzburger Musikgeschichte am Department für Musikwissenschaft der Universität Mozarteum Salzburg. Gedruckt aus Budgetmitteln des Arbeitsschwerpunktes Salzburger Musikgeschichte am Department für Musikwissenschaft der Universität Mozarteum Salzburg. Redaktionelle Betreuung: Stefanie Hiesel und Thomas Hochradner Abbildung auf dem Umschlag: Erklerung Der Lauretanischen LETANEY (1637), Titelkupfer; © Bayerische Staatsbibliothek München, Asc. 4718, fol. 1r, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10268089-3. Für den Inhalt des Buches ist die Autorin verantwortlich. Die Abbildungsrechte sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden. Im Falle noch offener, berechtigter Ansprüche wird um Mitteilung ersucht. Satz und Umschlaggestaltung: Nikola Stevanović Hergestellt in der EU CC BY-NC-ND 4.0 Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode) Jene Stellen die als Zitate gekennzeichnet sind sowie die verwendeten Bilder unterliegen weiterhin dem Urheberrecht. Die Open Access Veröffentlichung wurde gefördert von der Universität Mozarteum Salzburg. Alle Rechte vorbehalten. © Hollitzer Wissenschaftsverlag, Wien 2020 https://doi.org/10.2307/j.ctv1cdx6nj ISBN 978-3-99012-605-9 www.hollitzer.at https://doi.org/10.2307/j.ctv1cdx6nj.2 Einleitung 5 Inhalt Textteil Vorwort 13 Einleitung 15 Die textlichen Vorlagen und ihre Vertonungen von Wolfgang Amadeus Mozart und seinen Zeitgenossen 29 Sakramentslitaneien: Im Zeichen der Pietas austriaca Lauretanische Litaneien: Königin im pastoralen Gewand Drei Salzburger Sakramentslitaneien aus dem Jahr 1776 100 Eine Audienz bei Gott. -

The Piano Music of George Frederick Pinto
Edith Cowan University Research Online Theses : Honours Theses 2011 The piano music of George Frederick Pinto Aidan Boase Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/theses_hons Part of the Music Commons Recommended Citation Boase, A. (2011). The piano music of George Frederick Pinto. https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/38 This Thesis is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/38 Edith Cowan University Copyright Warning You may print or download ONE copy of this document for the purpose of your own research or study. The University does not authorize you to copy, communicate or otherwise make available electronically to any other person any copyright material contained on this site. You are reminded of the following: Copyright owners are entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. A reproduction of material that is protected by copyright may be a copyright infringement. A court may impose penalties and award damages in relation to offences and infringements relating to copyright material. Higher penalties may apply, and higher damages may be awarded, for offences and infringements involving the conversion of material into digital or electronic form. The Piano Music of George Frederick Pinto Aidan Boase Western Australian Academy of Performing Arts Edith Cowan University This dissertation is submitted for the degree of Bachelor of Music Honours 2011 ii Declaration I certify that this thesis does not, to the best of my knowledge and belief: (i) incorporate without acknowledgment any material previously submitted for a degree or diploma in any institution of higher education; (ii) contain any material previously published or written by another person except where due reference is made in the text of this thesis; (iii) contain any defamatory material; (iv) contain any data that has not been collected in a manner consistent with ethics approval. -

Internationale Joseph-Woelfl-Gesellschaft Tschechisches Museum Für Dankt Folgenden Institutionen Für Die Förderung Musik, Prag, (Cz) Dieses Symposiums
INTERNATIONALE ZUR EINFÜHRUNG ÜBERSICHT Nach dem I. Internationalen Joseph-Woelfl-Sympo- JOSEPH-WOELFL-GESELLSCHAFT sium im 200. Todesjahr Woelfls 2012 an Ort: Paris Lodron-Universität seinem Hörsaal E.004 „Anna Bahr-Mildenburg“ IJWG Sterbeort London findet das II. Symposium in Freitag, 23. Mai 2014 diesem Jahre an Woelfls Geburtsort Salzburg statt. Damit sind gleichsam die äußeren Koordinaten 13.00 Uhr Margit Haider-Dechant: seines Lebens abgesteckt. Die nächsten Symposien Begrüßung. werden 2016 in Prag und 2018 in Paris stattfinden – 13.15 Uhr Eva Neumayr: Maria Anna Städte, in welchen der Komponist und Pianist größte Mozart als Klavierlehrerin von Erfolge verbuchen konnte. Joseph Woelfl. Joseph Woelfl, am 24. Dezember 1773 als Sohn des geadelten Direktors der Fürstbischöflichen 14.00 Uhr Petrus Eder: Geistliche Steuerbehörde Johannes Paul Wölfl in Salzburg Kompositionen von Woelfl. geboren, erhielt Unterricht bei dem Hofkomponisten Michael Haydn, bei den Hofmusikern Leopold und 14.45 Uhr Kaffeepause Wolfgang Amadeus Mozart sowie bei Nannerl Mozart. Er studierte am Kapellhaus des Doms, wo 15.15 Uhr Peter Heckl: Woelfls ihn weitere Musiker des Fürstbischöflichen Hofes Harmoniemusik im Vergleich zu unterrichteten und an der Benediktiner-Universität. W. A. Mozart und Michael Haydn. Seine gesamte Ausbildung, die ihn befähigen sollte, einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Musiker 16.00 Uhr Hermann Dechant: Joseph seiner Zeit zu werden, erfolgte somit an kirchlichen Woelfls Klarinetten-Konzert. Institutionen. Wir erlauben uns, an dieser Stelle S. E. Erzbischof Franz Lackner unseren herzlichen Dank 16.45 Uhr Joseph Woelfel: Joseph Woelfls II. Internationales zu sagen, dass er sich in historischer Kontinuität dazu Nachkommen in den USA. Joseph-Woelfl-Symposium bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft über unser diesjähriges Symposium zu übernehmen. -

Adam Bosze Music Antiquarian Short List - 2017 Autumn
Adam Bosze Music Antiquarian Short List - 2017 Autumn No 37. Adam Bosze Budapest, 2017 1 © 2017 Ars Trade Kft. Shop: Bősze Ádám Zenei Antikvárium Adress: 1077 Budapest, Király u. 77. (Entrance Csengery Street) Opening hours: by appointment Phone: + 36 30 222 7650 Company: Ars Trade Kft. Address: H-1077 Budapest, Király u. 77. VAT registration number: HU 14149586 EUR-Account Informations: CIB Bank Rt. H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. IBAN: HU47 1070 0691 4881 6205 5000 0005 BIC (SWIFT Code): CIBHHUHB Informations about our other accounts (USD, GBP, HUF) are available upon request. Terms of Sale All items are guaranteed as described. All items are returnable within 7 days if returned in the same condition as sent. All items remain the property of Bősze Ádám Zenei Antikvárium / Ars Trade Kft. until fully paid for. Items may be reserved by telephone, fax, or email. All items subject to prior sale. Payment should accompany order if you are unknown to us. Customers known to us will be invoiced with payment due in 14 days. Payment schedule may be adjusted for larger purchases. Institutions will be billed to meet their requirements. Collegaues receive 10% discount. We accept bank transfer, credit card and PayPal. Orders from this catalog will be shipped at cost. 2 Autographs, photos 1. Bacewicz, Grażyna: Handwritten copy of Suite pour 2 Violons inscribed and signed by the composer – Budapest, 1950. I. 8. 16 p. Black (score) and grey (inscription) ink. 360 mm – Brown, soiled, some minor tears. € 250,- Bacewicz, Grażyna (1909-1969), Polish composer, violinist and pianist. After early instrumental and theory studies in Łódź, she attended the Warsaw Conservatory, where she studied composition with Kazimierz Sikorski, the violin with Józef Jarzębski and the piano with Józef Turczyński (she also studied philosophy at Warsaw University). -

Paladino Music – Catalogue 2017
jean françaix works for clarinet paladino music dimitri ashkenazy 2017 ada meinich bernd glemser yvonne lang cincinnati philharmonia orchestra christoph-mathias mueller harald genzmer works for mixtur trautonium. from post war sounds to early krautrock catalogue paladino music peter pichler paladino music RZ-Korr_BOOKLET_pmr0075_Antheil_32-stg.qxp_Layout 1 26.07.16 16:21 Seite 1 RZ-Korr_BOOKLET_pmr0075_Antheil_32-stg.qxp_Layout 1 26.07.16 16:21 Seite 1 george antheil bad boy of music (en/de) george antheil bad boy of music (en/de) gottlieb wallisch cghortisttloiepbh ewr arolltihsch kcahrrli smtoarpkhoevirc sroth karl markovics composers / a–b Antheil: Bad Boy of Music Bach: Goldberg Variations Works by George Antheil Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, BWV 988 Gottlieb Wallisch, piano | Christopher Roth, narrator english Michael Tsalka, clavichord Karl Markovics, narrator german This is the first recording of the Goldberg Variations on two clavichords Antheil’s approach to piano playing is extremely physical: He compares standing side by side. Acclaimed Early Music specialist Michael Tsalka his work with that of a boxer, describes how he cools his swollen hands regularly performs this work on a variety of keyboard instrument, but in goldfish bowls and eloquently talks about sweat running down his has chosen the clavichord for his first recording of Bach’s masterwork. body in broad and greasy streams. On this recording you can hear some of his most interesting compositions played by Viennese pianist Gottlieb ”My interpretation is a bow to the spirit of improvisation, freedom and pmr 0075 (2 CDs) Wallisch. Between the piano pieces Karl Markovics and Christopher Roth unbound imagination, which shines through the music of JS Bach and his pmr 0032 antheil: are reading excerpts from Antheil’s biography „Bad Boy of Music“.