Zum Pdf-Dokument
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pub/Is/Ied Wit/It/Ie Appro/Iation of T/Ie Board of Trustees
OH S S Pub/is/ied wit/i t/ie appro/iation of t/ie Board of Trustees VOL. 11.—No. 20. I BALTIMORE, DECEMBER, 1882. [PRICE 10 CENTS. CALENDAR, 1882-83. Tuesday, September 19. Current Academic Year Began. Friday, December 22—Tuesday, Jan. 2. Christmas Recess. Tuesday, January 2. Mr. F. Seymour Haden’s Lectures on Etching Begin. (See p. 36). Wednesday, January 3. Meeting of Scientific Association, 8 P. M. Friday, January 5. Meeting of Philological Association, 12 M. Monday, January 8. Professor G. S. Morris’s Course on Philosophy and Christianity Begins. (See p. 36). Tuesday, January 9. Meeting of Metaphysical Club, 8 P. M. Wednesday, January 10. Professor Corson’s Course on Poetry Begins. (See p. 36). Saturday, January 13. M. Rabillon’s Course in French Literature Begins. (See p. 36). Wednesday, January 17. Meeting of Historical and Political Science Association, 8 P. M. Friday, January 19. Meeting of Mathematical Society, 8 P. M. Friday, June 8. Term of Instruction Closes. CONTENTS. PAGE. PAGE. Scientific Notes : — University Studies in Historical and Political Science. Mcdhemalics. Mr. Freeman’s Visit to Baltimore, by H. B. ADAMS, • - . 80—82 On the Fundamental Theorem in the New Method of Partitions, Prospectus of the Series 82 by J. J. SYLVESTER; The Maximum Value ofa Certain Deter- minant, by E. W. DAVIS; Notes on Symmetric Functions, by Synopsis of Recent Scientific Journals: W. P. DURFEE; On the Number of Self-Opposite Partitions, American Journal of Philology. by W. P. DURFEE; Note on the last-named paper, by J. J. On the Culex of Vergil, by R. -

An Analysis of Richard Flatter's German Translation of Romeo and Juliet
RICE UNIVERSITY An Analysis of Richard Flatter's German Translation of Romeo and Juliet t>y Sidney E. Disher, Jr. A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF Master of Arts Thesis Director's Signature: Houston, Texas May, 1968 Abstract An Analysis of Richard Flatter’s German Translation of Romeo and Juliet by Sidney E. Disher, Jr. Since its publication in the early nineteenth cen¬ tury, the Schlegel-Tieck translation of Shakespeare has gradually attained the status of a literary master-piece. Even today, it continues to dominate both on the stage and among the reading public as the "definitive" German Shake¬ speare translation. Despite its artistic merits, however, scholars and critics have become increasingly aware that the Schlegel- Tieck version contains serious deficiencies in literal and stylistic fidelity to the original. Numerous efforts to "correct" and "emend" the translation, however, proved largely unsuccessful, resulting, in most cases, in a mere bowdlerization of Schlegel's work. In light of the find¬ ings of contemporary research on Shakespeare and his art, and the weaknesses of the original and emended editions of the Schlegel-Tieck version, the case for a completely new translation has become ever stronger. Of the numerous recent attempts to meet this challenge, Richard Flatter's work is one of the most outstanding. A noted Shakespeare scholar in his own right, Flatter has pro¬ duced a translation which features dynamic, modern speech, and close attention to theatrical detail. In Flatter's view, Shakespeare was first of all a mar. of the theater, an able producer and director who used his great poetic talent to complement his theatrical aims. -

Links Between Attitudes Towards Climate and Welfare Policies
sustainability Article Public Support for Sustainable Welfare Compared: Links between Attitudes towards Climate and Welfare Policies Martin Fritz 1,* and Max Koch 2 1 Junior Research Group “Mentalities in Flux” (flumen), Institute of Sociology, Friedrich Schiller University Jena, Humboldtstraße 34, 07743 Jena, Germany 2 Socialhögskolan, Lund University, Box 23, 22100 Lund, Sweden * Correspondence: [email protected] Received: 27 June 2019; Accepted: 30 July 2019; Published: 1 August 2019 Abstract: The emerging concept of sustainable welfare attempts to integrate environmental sustainability and social welfare research. Oriented at a mid-term re-embedding of Western production and consumption norms into planetary limits, it suggests the development of “eco-social” policies in the rich countries. In this theoretical context, this article empirically investigates the relationships between attitudes towards welfare and climate policy in 23 countries. Using 2016 data from the European Social Survey, we explored patterns of synergy between both kinds of policies as well as effects of crowding-out, where support for one kind of policy involves refusing the other. Since previous research addressed the role of welfare states and their institutional foundations in establishing environmentally sustainable societies, we studied how attitudes towards welfare and climate policies differ according to welfare regime affiliation. Additionally, we examined how a range of socio-demographic and political factors such as class, education, income, and political position shape people’s views on welfare and climate policy goals. The results of a multiple correspondence analysis indicate that the simultaneous support of welfare and climate policies follows welfare regime lines in that this support is the highest among social-democratic countries. -

D:\A Arnim Gesellschaft\Neue Zeitung Für Einsiedler\2002
Neue Zeitung für Einsiedler Mitteilungen der Internationalen Arnim-Gesellschaft Jahrgang 2 (2002) Heft 1/2 Herausgegeben von Walter Pape Köln 2002 Heft 1/2, August 2002 Nachruf auf Prof. Dr. Francesco Moiso (1944–2001) ...................... 4 Aufsätze UWE JAPP, Karlsruhe Virtuelle Inszenierung: Achim von Arnims Schattenspiel „Das Loch“ multimedial ..................................................... 7 JEROEN THOEN, Destelbergen (Belgien) Die Figurenkonstellation in Achim von Arnims Erstling Hollin’s Liebeleben ............................. 22 PETER-ANTON VON ARNIM, Zernikow Anschrift der IAG: Zur Geschichte des Nachlasses von Achim und Bettina von Arnim .......... 40 Internationale Arnim-Gesellschaft e. V. MOUHAMADOU MOUSTAPHA SOW, Dakar Prof. Dr. Walter Pape Arnims Bedeutung für den Gedankenaustausch mit Afrika .................. 48 Institut für deutsche Sprache und Literatur Universität zu Köln Miszellen D–50923 Köln ROSWITHA BURWICK, Claremont Tel. (0221) 470–2444/2460 A Fax: 470–5107 Ein Nachtrag zu Goethes Beziehungen zu Christian Samuel Weiß ........... 55 email: [email protected] Arnim-Handschriften-Ankauf des Freien Deutschen Hochstifts ................ 57 HEINZ HÄRTL, Weimar Neue Bettina-Briefausgaben ................................................ 58 Mitteilungen 4. Kolloquium der IAG im Juli 2002 in Glasgow ............................... 61 Abstracts der Beiträge ...................................................... 64 Die Weimarer Arnim-Ausgabe ................................................. 80 Schriften der Internationalen -

Die Meistersinger Von Nürnberg on Stage in the Weimar Republic
This is a repository copy of Displacement, repetition and repression : Die Meistersinger von Nürnberg on stage in the Weimar Republic. White Rose Research Online URL for this paper: https://eprints.whiterose.ac.uk/122212/ Version: Accepted Version Article: Sheil, Aine Catherine orcid.org/0000-0001-6890-3204 (2018) Displacement, repetition and repression : Die Meistersinger von Nürnberg on stage in the Weimar Republic. Cambridge Opera Journal. pp. 117-151. ISSN 0954-5867 https://doi.org/10.1017/S095458671700012X Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ Displacement, repetition and repression: Die Meistersinger von Nürnberg on stage in the Weimar Republic Áine Sheil Abstract Relatively little scholarly attention has been paid to the performance and reception history of Die Meistersinger von Nürnberg during the Weimar Republic (1919-33), but as this article will demonstrate, the opera played an indispensable role in the repertories of Weimar opera houses. Despite an evident desire on the part of some Weimar directors and designers of Die Meistersinger to draw on staging innovations of the time, productions of the work from this period are characterised by scenic conservatism and repetition of familiar naturalistic imagery. -

Diplomarbeit
! Diplomarbeit Titel der Arbeit Austria’s „Who’s Who?“ Exploring representations of famous faces in an Austrian student sample – a quantitative approach Autorin Johanna Palcu Angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, im November 2011 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer:" " " " Univ.-Prof. Dr. Helmut Leder ! ! ! 2! ! ! ! 3 Not!only!in!the!course!of!this!work,!but!also!throughout!the!whole!length!of!my! study,!I!have!been!accompanied!and!supported!by!my!parents,!my!partner!in!life!and! my!friends,!who!always!gave!me!guidance,!strength!and!good!advice.!! ! They!were!my!critics!when!it!was!necessary!and!my!pillar!of!strength!when!I!needed! it!the!most.!For!this!I!would!like!to!thank!them!sincerely.! ! Last!but!not!least,!I!would!also!like!to!acknowledge!my!supervisor,!Professor!Dr.! Helmut!Leder!for!his!support,!patience!and!advice!and!for!always!leaving!me!the! freedom!to!express!my!own!ideas.!! ! Thank!you!! ! ! ! 3! ! ! 4! ! ! ! 5 Table&of&content! 1! Introduction+.....................................................................................................................+7! 2! Theoretical+Background+............................................................................................+11! 2.1!A!developmental!approach!to!face!recognition!–!from!early!childhood!to! adult!expertise!..........................................................................................................................!11! 2.1.1! Developmental!studies!in!newborns!........................................................................!11! -
Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Open Access Dissertations 2-2011 Justifying the Margins: Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest Zorana Gluscevic University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations Part of the German Language and Literature Commons Recommended Citation Gluscevic, Zorana, "Justifying the Margins: Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest" (2011). Open Access Dissertations. 335. https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/335 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. JUSTIFYING THE MARGINS: MARGINAL CULTURE, HYBRIDITY, AND THE POLISH CHALLENGE IN FONTANE’S EFFI BRIEST A Dissertation Presented by ZORANA GLUSCEVIC Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY February 2011 German and Scandinavian Studies © Copyright by Zorana Gluscevic 2011 All Rights Reserved JUSTIFYING THE MARGINS: MARGINAL CULTURE, HYBRIDITY, AND THE POLISH CHALLENGE IN FONTANE’S EFFI BRIEST A Dissertation Presented By ZORANA GLUSCEVIC Approved as to style and content by: _________________________________________________ -
Vampiromania in the Eighteenth Century: the Other Side of Enlightenment Milan V
Document generated on 10/01/2021 4:05 p.m. Man and Nature L'homme et la nature Vampiromania in the Eighteenth Century: The Other Side of Enlightenment Milan V. Dimić Volume 3, 1984 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1011822ar DOI: https://doi.org/10.7202/1011822ar See table of contents Publisher(s) Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle ISSN 0824-3298 (print) 1927-8810 (digital) Explore this journal Cite this article Dimić, M. V. (1984). Vampiromania in the Eighteenth Century: The Other Side of Enlightenment. Man and Nature / L'homme et la nature, 3, 1–22. https://doi.org/10.7202/1011822ar Copyright © Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Société This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit canadienne d'étude du dix-huitième siècle, 1984 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ 1. Vampiromania in the Eighteenth Century: The Other Side of Enlightenment Strange shadows persisted in the period which is commonly called the Enlightenment, le Siècle des Lumières, Aufklârung, illuminismo, siglo de las Luces, seculo dos Luzes, prosveèëenie, or prosvecenost. The Age of Reason was not only the time of the philosophers, neoclassical rules and certified traditions. -

Studia Theodisca II
Studia theodisca II Achim von Arnim • Clemens Brentano • J. W. Goethe Wilhelm Hauff • J. Ch. F. Hölderlin • E. T. A. Hoffmann Heinrich von Kleist • Novalis C. F. von Rumohr • Dorothea Schlegel Ludwig Tieck • W. H. Wackenroder Edidit Fausto Cercignani Studia theodisca An international journal devoted to the study of German culture and literature Published annually in the autumn ISSN 1593-2478 Editor: Fausto Cercignani Electronic Edition (2011) of Vol. II (1995) Studia theodisca Founded in 1994 Published in print between 1994 and 2010 (vols. I-XVII) On line since 2011 under http://riviste.unimi.it Online volumes are licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. The background image of the cover is elaborated from the original of Georg Büchner’s “Woyzeck” (F4-2v). _| |_ Studia theodisca II Achim von Arnim • Clemens Brentano • J. W. Goethe Wilhelm Hauff • J. Ch. F. Hölderlin • E. T. A. Hoffmann Heinrich von Kleist • Novalis C. F. von Rumohr • Dorothea Schlegel Ludwig Tieck • W. H. Wackenroder edidit Fausto Cercignani _ _ | | _| |_ Proprietà letteraria originaria dell’Università degli Studi di Milano Istituto di Germanistica _ _ | | _| |_ Premessa Raccolgo in questo volume alcuni saggi sul Romanticismo tedesco offerti da studiosi italiani e stranieri che hanno partecipato in vario modo agli scambi e alle iniziative culturali dell'Istituto di Germanistica dell'Università degli Studi di Milano. I compiti redazionali sono stati svolti con l'aiuto di Enrica Yvonne Dilk, che desidero qui ringraziare per la fattiva e paziente collaborazione. F. C. _ _ | | _| |_ Indice Stefan Nienhaus - Aufklärerische Emanzipation und romantischer Antisemitismus in Preußen im frühen neunzehnten Jahr- hundert p. -

Eberlin Von Gunzburg and the German Reformation
This dissertation has been 64—7003 microfilmed exactly as received COLE, Richard Glenn, 1934- EBERLIN VON GUNZBURG AND THE GERMAN REFORMATION. The Ohio State University, Ph.D., 1963 History, modern University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan EBERLIN VON GUNZBURG AND THE GERMAN REFORMATION DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Richard Glenn Cole, B.A., M.A. ******* The Ohio State University 1963 Approved by Department of History ACKNOWLEDGMENT Without the guidance of my adviser, Harold J. Grimm, and the forbearance of my wife, Joie, this dissertation would not have been possible. ii CONTENTS Page INTRODUCTION......... 1 Chapter I. GERMANY ON THE EVE OP THE REFORMATION....... 8 II. A SHORT BIOGRAPHICAL SKETCH .................. 28 III. THE POLEMICAL FLUGSCHRIFTEN.................. 47 IV. EBERLIN AS AN EVANGELICAL.................... 68 V. ZEIT BRINGT RflSSLIN.......................... 91 VI. THE NEW SOCIETY................. 125 VII. CONCLUSIONS................ 146 BIBLIOGRAPHY ......................................... 154 AUTOBIOGRAPHY.................................... 166 ill INTRODUCTION Much has been written about the causes of the German Reformation and the effects of it upon later developments such as the rise of capitalism and nationalism. Comparatively few studies have been made concerning the interaction of Lutheran doctrine with German society. While it is difficult to generalize accurately on whether there was a "Lutheran ethic" or whether there were discernible changes in the mores and patterns of life in Lutheran areas, there is reason to believe that a study of the reaction of individuals as well as social groups to Luther’s Reformation may shed new light upon the interaction between the reform movement and social issues. -
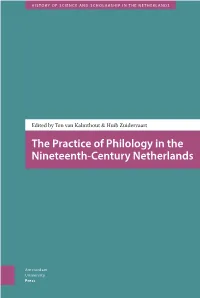
The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands
HISTORY OF SCIENCE AND SCHOLARSHIP IN THE NETHERLANDS HISTORY OF SCIENCE AND SCHOLARSHIP IN THE NETHERLANDS Edited by Van Kalmthout & Zuidervaart Van by Edited This volume offers a new perspective on the development of philology in Dutch scholarly culture of the nineteenth century. Until that period, this field of the humanities had far reaching implications on disciplines such as theology, chronology, astronomy, history, law and other domains of knowledge. Several fundamental changes occurred during the nineteenth century. Texts in the vernacular and national perspectives attracted attention; comparative approaches were introduced and several subfields grew into more-or-less independent (sub)disciplines in the humanities. This complex, but fascinating process of differentiation, specialization and professionalization redesigned the landscape of philology radically. Ton van Kalmthout and Huib Zuidervaart are senior researchers at the Huygens Institute of the Royal Dutch Academy of Arts and Science in The Hague. Nineteenth-Century Netherlands in the of Philology Practice The Edited by Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands ISBN: 978-90-8964-591-3 AUP.nl 9 789089 645913 The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands History of Science and Scholarship in the Netherlands, volume 14 The series History of Science and Scholarship in the Netherlands presents studies on a variety of subjects in the history of science, scholarship and academic institutions in the Netherlands. Titles in this series 1. Rienk Vermij, The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750, 2002, isbn 90-6984-340-4 2. Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas Haus. -

Karl Lebrecht Immermann
COLUMBLA UNIVERSITY GERMANIC STUDIES KARL LEBRECHT IMMERMANN SALES AGENTS NEWYORK : LEMCKE& BUECHNER 30-32 West 27th St. LONDON: HENRYFROWDE Amen Comer, E. C. KARL LEBRECHT IMMERMANN A STUDY IN GERMANROMANTICISM BY ALLEN WILSON PORTERFIELD NEW YORK 1911 Copyright, 191 I BY THECOLUMBIA Umvmsln PRESS Printed born type Febrtl.r)-, 1911 PRESS or TYS HIW ERA PnIMT1110 COUCIII). LAMCASTTI. PA. TO THE MEMORY OF MY MOTHER NOTE Considering the extent and variety of his literary production and the peculiar interest of the ' epigonic ' period in which his best work was done, Immermann has been too little studied. I do not mean that he is a neglected genius, for he was not a man of genius. But the many-sidedness of his talent, his sen- sitiveness to every breeze that blew, his eager experimentation, make him especially interesting as a mirror of the Romantic epoch. Mr. Portefield has undertaken to study him in his total relation to the Romanticists and to all that they were driving at. I regard the work as a substantial contribution to our knowledge of Immermann and his contemporaries. CWMBIA UNIVERSITY, December, 1910. vii I p I""" : .; ,.a -..,:. ..: > *&d PREFACE In its most remote origin, this study grew out of a desire to familiarize myself with an important and suggestive epoch in German literature while solving a somewhat broad yet definite problem taken from this epoch. Immermann's lifelong though irregular and varying interest in German Romanticism appealed to me as abundantly satisfying this requirement. To Professor Calvin Thomas I owe indeed much by way of general suggestion, substantial assistance and personal encour- agement.