Items-In-Heads of States - Austria
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From the History of Polish-Austrian Diplomacy in the 1970S
PRZEGLĄD ZACHODNI I, 2017 AGNIESZKA KISZTELIŃSKA-WĘGRZYŃSKA Łódź FROM THE HISTORY OF POLISH-AUSTRIAN DIPLOMACY IN THE 1970S. AUSTRIAN CHANCELLOR BRUNO KREISKY’S VISITS TO POLAND Polish-Austrian relations after World War II developed in an atmosphere of mutu- al interest and restrained political support. During the Cold War, the Polish People’s Republic and the Republic of Austria were on the opposite sides of the Iron Curtain; however, after 1945 both countries sought mutual recognition and trade cooperation. For more than 10 years following the establishment of diplomatic relations between Austria and Poland, there had been no meetings at the highest level.1 The first con- tact took place when the then Minister of Foreign Affairs, Bruno Kreisky, came on a visit to Warsaw on 1-3 March 1960.2 Later on, Kreisky visited Poland four times as Chancellor of Austria: in June 1973, in late January/early February 1975, in Sep- tember 1976, and in November 1979. While discussing the significance of those five visits, it is worth reflecting on the role of Austria in the diplomatic activity of the Polish Ministry of Foreign Affairs (MFA). The views on the motives of the Austrian politician’s actions and on Austria’s foreign policy towards Poland come from the MFA archives from 1972-1980. The time period covered in this study matches the schedule of the Chancellor’s visits. The activity of the Polish diplomacy in the Communist period (1945-1989) has been addressed as a research topic in several publications on Polish history. How- ever, as Andrzej Paczkowski says in the sixth volume of Historia dyplomacji polskiej (A history of Polish diplomacy), research on this topic is still in its infancy.3 A wide range of source materials that need to be thoroughly reviewed offer a number of 1 Stosunki dyplomatyczne Polski, Informator, vol. -

Statement of the Director General to the 21St Session of the General Conference of the IAEA
Statement of the Director General to the 21st Session of the General Conference of the IAEA INTRODUCTORY REMARKS May I first express our warmest thanks to President Kirchschlager for his kindness in joining us today to celebrate the twentieth anniversary of the International Atomic Energy Agency and for his thoughtful statement. His interest in and support for the Agency is evidenced by the fact that this is the second time this year that he has assisted in opening one of our meetings, the previous occasion being the Salzburg Conference in May. I would also like to convey through him to the Government and people of Austria and to the City of Vienna our sincere appreciation for the twenty years of generous and unfailing hospitality and understanding that the Agency has enjoyed in the city and in this country. I would like to thank the President of the National Council, Mr. Anton Benya, and the Minister for Foreign Affairs, Dr. Willibald Pahr, for honouring this conference with their presence. The founders of the Agency showed wisdom not only in the far-sighted provisions of the Agency's Statute but also in the selection of Vienna as the permanent headquarters of the Agency, a choice which has encouraged other United Nations organizations to come here, such as our sister organization UN I DO, and which I hope will be followed by many more. I should like to extend a special welcome to our guests of honour, each of whom has played a significant role in the history of the Agency. These include: Ambassador G.P. -
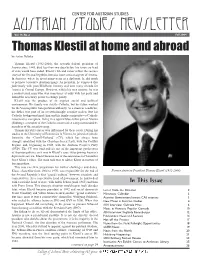
Fall 04 9-16.Idd
CENTER FOR AUSTRIAN STUDIES AUSTRIAN STUDIES NEWSLETTER Vol. 16, No. 2 Fall 2004 Thomas Klestil at home and abroad by Anton Pelinka Thomas Klestil (1932-2004), the seventh federal president of Austria since 1945, died less than two days before his tenure as head of state would have ended. Klestil’s life and career reflect the success story of the Second Republic, but also some critical aspects of Austria. In America, where he spent many years as a diplomat, he did much to promote a positive Austrian image. As president, he tempered that judiciously with post-Waldheim honesty and won many friends for Austria in Central Europe. However, within his own country, he was a controversial man who was sometimes at odds with his party and lacked the necessary power to change policy. Klestil was the product of an atypical social and political environment: His family was strictly Catholic, but his father worked for the Vienna public transportation authority. As a streetcar conductor, his father was part of an overwhelmingly socialist milieu. But his Catholic background made him and his family a minority—a Catholic conservative exception, living in a typical blue-collar part of Vienna (Erdberg); a member of the Catholic conservative camp surrounded by members of the socialist camp. Thomas Klestil’s career was influenced by these roots. During his studies at the University of Economics in Vienna, he joined a Catholic fraternity—the “Cartell-Verband” (CV), which has always been strongly identified with the Christian Social Party, with the Dollfuß Regime and, beginning in 1945, with the Austrian People’s Party (ÖVP). -

Global Austria Austria’S Place in Europe and the World
Global Austria Austria’s Place in Europe and the World Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Anton Pelinka, Alexander Smith, Guest Editors CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 20 innsbruck university press Copyright ©2011 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Book design: Lindsay Maples Cover cartoon by Ironimus (1992) provided by the archives of Die Presse in Vienna and permission to publish granted by Gustav Peichl. Published in North America by Published in Europe by University of New Orleans Press Innsbruck University Press ISBN 978-1-60801-062-2 ISBN 978-3-9028112-0-2 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lindsay Maples University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Helmut Konrad Universität Graz Universität -

220,000 > 500,000
STATS Social Housing for Everyone Afer the foundation of the First Austrian Republic (1918) and the creation of Vienna as a separate region (1922), the city’s ruling Social Democrats set Europe’s most ambitious program for social housing into motion. FACTS - NEARLY 65,000 new, modern and affordable GEMEINDEBAU flats were built by the city 2 government from 61 m average size of a flat 1919 to 1934, 1 METZLEINSTALER HOF 2 RABENHOF before Austro-fascists and (built 1920 & 1923/24) (built 1925-28) Nazis stopped the program. ROBERT KALESA & HUBERT GESSNER HEINRICH SCHMID & HERMANN AICHINGER 2,000 Mayor Jakob Reumann Mayor Karl Seitz The building resumed afer Vienna’s first-ever Gemeindebau was The site was intended to exude the “romantic the war, making the city of building complexes built in two stages and designed separately charms of a little town.” It also hosts the Vienna the biggest by two architects. Rabenhof theater. landlord in Europe. 220,000 flats (living units) > 500,000 residents (more than 1/4 of Vienna’s population) 3 KARL-MARX-HOF 4 PER-ALBIN-HANSSON- 5 NEW GEMEINDEBAU – (built 1927-33) SIEDLUNG FONTANASTRASSE KARL EHN (built 1947–1951 & 1954-1955) (to be completed 2017-2019) Mayor Karl Seitz FRIEDRICH PANGRATZ, FRANZ SCHUSTER, STEPHAN NMPB ARCHITEKTEN ZT GMBH WIEN 2 One of Vienna's biggest Gemeindebaus SIMONY & EUGEN WÖRLE Mayors Michael Häupl & Michael Ludwig > 13 MILLION m (150,000 m2, 1,382 flats, 5,000 residents) Mayors Theodor Körner & Franz Jonas After a 13-year hiatus, Red Vienna is once of total area rented out was the scene of fights in Austria’s The first new Gemeindebau after World War II again building new Gemeindebauten, starting civil war in 1934. -

Historisches 1 27
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 2 / 6. 12. 2002 27 Historisches 1 27. 04. 1945 Provisorische Staatsregierung unter dem Vorsitz von Dr. Karl Renner. Ihr gehörten Vertreter der ÖVP, SPÖ und KPÖ zu gleichen Teilen an. 20. 12. 1945 Provisorische Bundesregierungegierung 1945 Kabinett Figl I (Sitzung vom 29. Dezember 1945) im Reichs- ratsaal im Parlament in Wien. v.l.n.r.: Ing. Vin- zenz Schumy, Johann Böhm, Eduard Heinl, Dr. Georg Zimmermann, Dr. Ernst Fischer, Johann Koplenig, Ing. Leopold Figl, Staats- kanzler Dr. Karl Renner, Dr. Adolf Schärf, Franz Honner, Dr. Josef Gerö, Josef Kraus, Andreas Korp, Ing. Julius Raab. Vorsitz: Karl Seitz. Bild: Institut für Zeitgeschichte © BKA/BPD 08. 11. 1949 Kabinett Figl II Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 28. 10. 1952 Kabinett Figl III Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 02. 04. 1953 Kabinett Raab I Gruppenfoto I. v.l.n.r. sitzend: BM f. ausw. Angelegenheiten Ing. Dr. Karl Gruber, BM f. Inneres Oskar Helmer, BK Ing. DDDR. Julius Raab, VK Dr. Adolf Schärf, BM f. Handel und Wiederaufbau DDDr. Udo Illig, v.l.n.r. stehend: SSekr. im BMaA Dr. Bruno Kreisky, BM f. sozi- ale Verwaltung Karl Maisel, SSekr. im BM f. Finanzen Dr. Fritz Bock, SSekr. im BM f. Inne- res Ferdinand Graf, BM f. Finanzen DDr. Rein- hard Kamitz, BM f. Unterricht Dr.Ernst Kolb, SSekr. im BM f. Handel und Wiederaufbau Dipl. Ing. Raimund Gehart, BM f. -

Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Fuchs, Andreas; Richert, Katharina Working Paper Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving? Discussion Paper Series, No. 604 Provided in Cooperation with: Alfred Weber Institute, Department of Economics, University of Heidelberg Suggested Citation: Fuchs, Andreas; Richert, Katharina (2015) : Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving?, Discussion Paper Series, No. 604, University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg, http://dx.doi.org/10.11588/heidok.00019769 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/127421 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von -

Nicht-Orte Des Gedenkens? 637
www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 636 Nicht-Orte des Gedenkens? 637 Nicht-Orte des Gedenkens? Benennungen nach Prominenten im öffentlichen Raum Claudia Kuretsidis-Haider Einleitung Der Charakter von Benennungen im öffentlichen Raum Unter „öffentlichem Raum“ wird eine topografische Örtlichkeit verstanden, in dem sich so- ziales, kulturelles und politisches Leben abspielt.1 Erinnerungszeichen (denen die vorliegende Publikation überwiegend gewidmet ist), aber auch Benennungen von Straßen und Plätzen oder öffentlichen Gebäuden sind Würdi- gungen im öffentlichen Raum, die Geschichte(n), etwa von historischen Ereignissen oder bedeutenden Persönlichkeiten, erzählen und oftmals einen ersten Zugang zur Vergangenheit eines Ortes darstellen. Straßennamen sind vielfach „sogar die ersten Objekte des Wandels in Zeiten von Um- brüchen, noch bevor sich überhaupt die Zahnräder von Politik und Verwaltung in diesen Prozess einschalten“.2 Zwar dienen sie in erster Linie der Orientierung im Straßennetz, sie geben aber auch die politischen Umstände ihrer Entstehungszeit wieder und können, ähn- lich einem Denkmal, als Erinnerungsorte wirken. Neben Erinnerungszeichen sind es Plätze und Straßennamen, die sich vielfach zu einem aufeinander abgestimmten Zeichensystem kollektiver Selbstverständigung und Selbstvergewisserung zusammenfügen. Straßennamen spiegeln u. a. Herrschaftsverhältnisse und dominierende Geschichtsbilder wider. So wurden beispielsweise zur Zeit des Nationalsozialismus viele Straßen nach NS-Persönlichkeiten be- nannt bzw. umbenannt, wie die zahllosen Adolf-Hitler-Straßen bezeugen können. Das Rote Wien der Zwischenkriegszeit manifestierte sich auch durch den Friedrich-Engels-Platz oder den Karl-Marx-Hof. -

AA Auswärtiges Amt ADN Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst Adr Archiv Der Republik Akvvi Archiv Des Karl Von Vogelsang-Instituts Anm
Anhang Abkürzungen AA Auswärtiges Amt ADN Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst AdR Archiv der Republik AKvVI Archiv des Karl von Vogelsang-Instituts Anm. Anmerkung AP Associated Press APA Austria Presse Agentur Bd. Band BKA Bundeskanzleramt BKA/AA Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten im Bundeskanzleramt BMEIA Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegen- heiten BMfAA Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten BMfHGI Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie BStU Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ČSSR Československá socialistická republika DDR Deutsche Demokratische Republik DLF Deutschlandfunk EA Europa-Archiv ECE Economic Commission for Europe EFTA European Free Trade Association EG Europäische Gemeinschaft EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ER Europarat ESK Europäische Sicherheitskonferenz EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FRUS Foreign Relations of the United States GZl. Geschäftszahl IAEO Internationale Atomenergie-Organisation INF Intermediate Range Nuclear Forces KP Kommunistische Partei KPdSU Kommunistische Partei der Sowjetunion KPÖ Kommunistische Partei Österreichs KSZE Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KVAE Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa 448 Anhang MBFR Mutual and Balanced Force Reductions MRP Ministerratsprotokolle MV Multilaterale Vorbesprechungen -

Österreichs Außenpolitik Der Zweiten Republik
Michael Gehler Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik Von der alliierten Besatzung bis zum Europa des 21. Jahrhunderts Bandl StudienVerlag Innsbruck Wien Bozen Inhaltsverzeichnis Band 1 Vorbemerkung 13 Ausgangssituation und Motivationen 13 Quellengrundlage und Methodik 14 I. Existenzsicherung, Neutralitätsfindung, Emanzipation und UNO-Anrufung in den „langen Fünfzigern" (1945-1961) 21 1. Opferstatus, ERP-Hilfe und Westorientierung 23 • Im Anfang war die kriegsalliierte „Moskauer Deklaration" mit der „Opferthese" 23 • Zielsetzungen österreichischer Außenpolitik nach 1945 27 • Keine „Stunde Null" am Ballhausplatz - schwieriger Neubeginn 32 • Eintrittskarten für das Außenamt: Gesamtösterreich und Südtirol Karl Gruber als „Komet am Himmel" (1945-1953) 38 • Innen- und außenpolitische Aktionsfelder: Eine Übersicht 42 • Behauptung des österreichischen Opferstatus, Verzögerung der Restitution und Nicht-Wiedergutmachungspolitik 43 • Die österreichische Form der „Entschädigungspolitik" 49 • Die Raab-Figl-Fischer-Intrige, Westorientierung und ERP-Hilfe für ganz Österreich! 51 • Existenzsicherung durch den Balanceakt Marshall-Plan 1948-1953 57 2. Mit Allianzlosigkeit zur Handlungsfreiheit 63 • Im Schatten der Besatzungsmächte: Kaum Handlungsspielraum 1948/49 63 • Österreichs Außenminister als führender „Kalter Krieger"? 67 • Weder „Alpen-" noch „Donaublock": Die Konsequenzen aus dem Fehlschlag „Kurzvertrag" und der UNO-Anrufung (1952-1953) 75 • „Allianzfreiheit" als Ausgangspunkt für eine noch unausgegorene Neutralität 79 • „Geheimer Verbündeter", -

Jahresbericht 2017
JAHRESBERICHT 2017 JAHRESBERICHT ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ 2017 ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ JAHRESBERICHT ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ 2017 ÖSTERREICHISCHES OLYMPISCHES COMITÉ EDITORIAL ÖOC-Partnerschaft liegt im Trend Die ÖOC-Sponsorenfamilie wächst stetig – aktuell zählt die „Resolution für den olympischen Frieden“ verabschiedet. man 18 Partner (1 Premium-Partner, 3 Top-Partner, 14 Part- Im Jänner gab es dann seitens Nordkorea die Bereitschaft, ner) und 10 Ausstatter. Dazu wurden fürs Austria House in mit einer Delegation an den Winterspielen teilzunehmen. Pyeongchang rekordverdächtige 31 Kooperationsverträge (1 Premium-Partner, 7 Top-Partner, 23 Supporter) unterzeich- Gernot Mittendorfer (Österreichischer Eishockeyverband) net. Die wirtschaftliche Basis kann sich sehen lassen. Die und Horst Nussbaumer (Österreichischer Ruderverband) Marke Olympia ist bei Sponsoren gefragt, das ÖOC liegt zogen im März neu in den Vorstand ein. Der langjährige im Trend, Tendenz steigend. ÖEHV-Präsident Dieter Kalt, 20 Jahre lang Mitglied des ÖOC-Vorstandes, wurde zum Ehrenmitglied bestellt. Posi- Sportlich stand das abgelaufene Jahr im Zeichen der Euro- tive Nachrichten gab’s auf internationaler Front zu vermel- päischen Olympischen Jugendspiele in Györ. Österreich den, Österreich ist ab sofort wieder im zwölfköpfigen Vor- ging mit 51 Athleten in insgesamt sieben Sportarten an stand des Europäischen -

Der Handschlag. Die Affäre Frischenschlager-Reder
2 DISSERTATION Titel der Dissertation „Der Handschlag. Die Affäre Frischenschlager-Reder.“ Verfasserin Magistra Barbara Tóth Angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb 0 1 Gewidmet meinem Großvater Ladislav. 2 3 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Seite 6 II. Der „Handschlag“ im wissenschaftlichen Kontext Seite 12 Begriffsdefinition und Rollenverteilung – Skandalmuster in der Zweiten Republik – Die Funktion als Katalysator III. Der „Handschlag“ im Kontext seiner Zeit Seite 18 Reden über die Vergangenheit in der Prä-Waldheim-Ära – Kreiskys koalitionäres Erbe: Die keine Koalition als Kulisse – Walter Reder, der Soldat im “Bandenkampf” – Friedhelm Frischenschlager, das liberale Aushängeschild IV. Der „Handschlag“ im historischen Kontext Seite 40 Walter Reders „Spindoktor“: Schlüsselfigur Stefan Schachermayr – Der Meilenstein für die Reder- Mythologisierung: Die Rückeroberung der österreichischen Staatsbürgerschaft – Ein Vergleich: Wiesenthals Staatsbürgerschaftsakt – Geldflüsse: Überweisungen an den „ehemaligen Kriegsgefangenen“ – Der Mythos Reder verfestigt sich: Interventionen unter Kanzler Josef Klaus – Eingestellte Ermittlungen: Die Akte Reder der Staatsanwaltschaft Linz – Aus Angst, einen Märtyrer zu schaffen: Interventionen für Reder unter Kanzler Bruno Kreisky V. Der „Handschlag“– Die Affäre in der chronologischen Rekonstruktion Seite 112 Skandalmotor ÖVP und zwei