Siedlungsforschung. Archäologie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Old Norse Mythology — Comparative Perspectives Old Norse Mythology— Comparative Perspectives
Publications of the Milman Parry Collection of Oral Literature No. 3 OLd NOrse MythOLOgy — COMParative PersPeCtives OLd NOrse MythOLOgy— COMParative PersPeCtives edited by Pernille hermann, stephen a. Mitchell, and Jens Peter schjødt with amber J. rose Published by THE MILMAN PARRY COLLECTION OF ORAL LITERATURE Harvard University Distributed by HARVARD UNIVERSITY PRESS Cambridge, Massachusetts & London, England 2017 Old Norse Mythology—Comparative Perspectives Published by The Milman Parry Collection of Oral Literature, Harvard University Distributed by Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts & London, England Copyright © 2017 The Milman Parry Collection of Oral Literature All rights reserved The Ilex Foundation (ilexfoundation.org) and the Center for Hellenic Studies (chs.harvard.edu) provided generous fnancial and production support for the publication of this book. Editorial Team of the Milman Parry Collection Managing Editors: Stephen Mitchell and Gregory Nagy Executive Editors: Casey Dué and David Elmer Production Team of the Center for Hellenic Studies Production Manager for Publications: Jill Curry Robbins Web Producer: Noel Spencer Cover Design: Joni Godlove Production: Kristin Murphy Romano Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Hermann, Pernille, editor. Title: Old Norse mythology--comparative perspectives / edited by Pernille Hermann, Stephen A. Mitchell, Jens Peter Schjødt, with Amber J. Rose. Description: Cambridge, MA : Milman Parry Collection of Oral Literature, 2017. | Series: Publications of the Milman Parry collection of oral literature ; no. 3 | Includes bibliographical references and index. Identifers: LCCN 2017030125 | ISBN 9780674975699 (alk. paper) Subjects: LCSH: Mythology, Norse. | Scandinavia--Religion--History. Classifcation: LCC BL860 .O55 2017 | DDC 293/.13--dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2017030125 Table of Contents Series Foreword ................................................... -

Mit Stier Und Greif Durch Mecklenburg-Vorpommern
Mit Stier und Greif durch Mecklenburg-Vorpommern Eine kleine politische Landeskunde Hallo... ...wir sind Stier und Greif, die Wappentiere des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Der Stier aus Mecklenburg und der vorpommersche Greif. Und auch wenn wir nicht so aussehen, wir sind wie Zwillinge, sind Brüder im Geiste und im Dienste unseres Landes. Eines wunderbaren Landes wohlgemerkt. Ein Land mit zwei der vier größten Seen, der größten Insel und dem schönsten Landtagssitz Deutschlands. Ein Land mit breiten, weißen Ostseestränden und dem leckersten Fisch. Nun ja, ...letzteres ist Geschmackssache. Wir wollen zeigen, wie es funktioniert, unser wunderbares Land. Wir reisen in die Land- kreise, besuchen die Landeshauptstadt und den Landtag. Wir gehen wählen, sprechen über Geld und blicken auf die Wirtschaft. Wir schauen auf die Geschichte, zählen Ämter und Gemeinden und finden mitten im Land eine Grenze, die gar keine ist. Ach, genug geredet. Los geht’s! 1 Ein Bundesland, zwei Geschichten WIEKER TROMPER BODDEN WIEK LIBBEN Die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns Europa beherrschte, siedelten Germanen BREEGER BODDEN ist eigentlich kurz und schnell erzählt. Im (Sueben) an der Ostsee, die damals Suebi- Jahre 1990, als die DDR in den Geschichts- sches Meer hieß. Die Sueben zogen nach M büchern verschwand, wurde es neugegrün- Süden und die Slawen kamen ins Land. Im RO ST det. Es gab freie Wahlen, Schwerin wurde Jahr 995 taucht Mecklenburg das erste Mal ER BREETZER OW BODDEN Landeshauptstadt und der Landtag zog in einer Urkunde auf. Seinen Namen ver- RASS ins Schweriner Schloss. dankt es einer alten slawischen Burg in der Nähe von Wismar: der Michelenburg. Von Tetzitzer GROSSER See Neugegründet? Ja, denn Mecklenburg-Vor- der einst mächtigen Anlage ist heute nur JASMUNDER Sassnitz pommern hatte es schon einmal gegeben. -
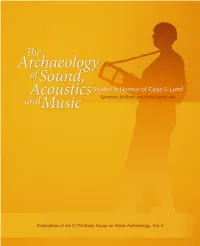
Contents & Introduction
e Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund Gjermund Kolltveit and Riitta Rainio, eds. Publications of the ICTM Study Group on Music Archaeology, Vol. 3 Series Editor: Arnd Adje Both Berlin: Ekho Verlag, 2020 368 pages with 86 gures and 6 tables ISSN 2198-039X ISBN 978-3-944415-10-9 (Series) ISBN 978-3-944415-39-0 (Vol. 3) ISBN 978-3-944415-40-6 (PDF) Layout and Typography: Claudia Zeissig · Kunst & Gestaltung | www.claudiazeissig.ch Printed in Poland Ekho Verlag Dr. Arnd Adje Both, Berlin [email protected] | www.ekho-verlag.com All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Ekho Verlag. © 2020 Ekho Verlag 5 Contents Prefaces and Introduction 11 The Sounds of Former Silence Cornelius Holtorf 13 Pioneering Archaeological Approaches to Music Iain Morley 15 My Tribute to Cajsa, or My Encounter with the Swedish Fairy Godmother of the New Music Archaeology Catherine Homo-Lechner 19 Ears wide open: Listening to the 4D Soundscapes of Cajsa S. Lund Emiliano Li Castro 21 Introduction to the Volume The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund Gjermund Kolltveit and Riitta Rainio 6 Contents Chapters 31 Sound Archaeology and the Soundscape Rupert Till 55 Ears to the Ground: On Cajsa Lund’s Legacy and Moving Movements Frances Gill 97 The Rommelpot of the Netherlands as a Case Study in Cajsa -

5 MICHAEL MÜLLER-WILLE, Introduction
TABLE OF CONTENTS MICHAEL MÜLLER-WILLE, Introduction . 9 I. Communication EDITH MAROLD, Hedeby – an ‘international’ trading place for Danes, Swedes, Norwegians, Germans, Frisians and Slavonic people. The linguistic and literary evidence . 13 MICHAEL MÜLLER-WILLE, Ribe – Reric – Hedeby. Early urbanization in southern Scandinavia and the western Slavonic area . 21 ELSE ROESDAHL, Walrus ivory in the Viking Age – and Ohthere (Ottar) . 33 DANIEL LÖWENBORG, Landscape and setting as a means of communication . 39 SØREN MICHAEL SINDBÆK, An object of exchange. Brass bars and the routinization of Viking Age long-distance exchange in the Baltic area . 49 ANDRES SIEGFRIED DOBAT, ‘Come together’. Three case-studies on the facilities of communication in a maritime perspective . 61 SEBASTIAN MESSAL, The Daugava waterway as a communication route to the East (9th–12th centuries) . 71 KRISTIN ILVES, About the German ships on the Baltic Sea at the turn of the 12th and 13th centuries: Data from the Chronicle of Henry of Livonia . 81 II. Scandinavians and Slavs HENRYK MACHAJEWSKI, The south-western part of the Baltic Sea basin at the end of Antiquity . 87 HANNA KÓČKA-KRENZ, The processes underlying the Piast state formation . 95 MONIKA MALESZKA, Viking and Slav: early medieval Baltic neighbours . 103 AGNIESZKA DOLATOWSKA, Wolin as a port-of-trade . 109 MARCUS GERDS, Worked and unworked amber from early medieval trading places in the south-western Baltic region . 115 KAROLINA SARGALIS, Local societies and Scandinavians in the light of grave goods in Pomerania and Great Poland. 123 5 III. Scandinavian Settlement and Central Places ANNE-SOFIE GRÄSLUND, Birka between West and East . 129 ANNIKA LARSSON, Oriental warriors in Viking Age Scandinavia – nothing but an illusion? . -

Symbols of Faith Or Symbols of Status? Christian Objects in Tenth-Century Rus´ by Fedir Androshchuk
Symbols of Faith or Symbols of Status? Christian Objects in Tenth-Century Rus´ by Fedir Androshchuk To study the Christianization of Rus´ based on archaeological evidence is not something new, and such a topic has already generated a considerable amount of research.1 This paper will deliberate some of the archaeological arguments pre- sented in earlier works, and aims to explore the social and functional contexts in which Christian objects or symbols associated with Christianity circulated in Rus´ during the Viking Age and in the tenth century in particular. Generally, two classes of archeological evidence have been associated with the dissemination of Christianity in Eastern Europe: inhumation graves with west–east orientation and specific objects with clear Christian symbolism (most often, cross-shaped pendants) found in burials. These two types of evidence are considered the obvi- ous markers of the deceased person’s adherence to the Christian faith, while their absence, conversely, is taken as an indication that the buried person belonged to those still practicing heathen cults. The earliest inhumation grave in early Rus´ is Grave 11 in the Plakun cemetery in Staraia Ladoga. A man between 60–70 years old was buried in a wooden cist oriented west–east (northwest–southeast). Close to his feet lay parts of a wooden trough and a birch box. A number of corroded iron and bronze objects lay to the right of the body. Pieces of felt and fur were also recorded in the grave.2 The timber of the chamber was dendrochronologically dated to 880–900, and there are construction traits that share parallels with sites in Denmark, such as Hede- 1 A selection of recent publications includes Aleksandr P. -

Verzeichnis Der Abkürzungen
Verzeichnis der Abkürzungen APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte BCSV Badisch-Christlich-Soziale Volkspartei BHE Block (Bund) der Heimatvertriebenen und Entrechteten BP Bayernpartei BVerfG Bundesverfassungsgericht BVP Bayrische Volkspartei CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands csu Christlich Soziale Union CVP Christliche Volkspartei DP Deutsche Partei DKP Deutsche Kommunistische Partei DNVP Deutschnationale Volkspartei DRP Deutsche Reichspartei DVP Deutsche Volkspartei DZP Deutsche Zentrumspartei EG Europäische Gemeinschaft EU Europäische Union EURATOM Europäische Atomgemeinschaft EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FDP Freie Demokratische Partei FR Frankfurter Rundschau GG Grundgesetz INFAS Institut ftir angewandte Sozialwissenschaft JÖR Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart KPD Kommunistische Partei Deutschlands LDPD Liberaldemokratische Partei Deutschlands MP Ministerpräsident MPen Ministerpräsidenten 395 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands NZZ Neue Züricher Zeitung ÖVP Österreichische Volkspartei POS Partei des Demokratischen Sozialismus PVS Politische Vierteljahreszeitschrift RNZ Rhein-Neckar-Zeitung SBZ Sowjetische Besatzungszone SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs ssw Südschleswigscher Wählerverband sz Süddeutsche Zeitung Zentrum Deutsche Zentrumspartei ZParl Zeitschrift flir Parlamentsfragen 396 Tabellenverzeichnis Tabelle I: Einstellungen zur Auflösung von Landtagen -

Flyer Opernale 2019
Der Opernale-Gedanke KONTAKT Der gemeinnützige Verein OPERNALE e.V. hat sich 2010 in Sund- Opernale INSTITUT für Musik & Theater in Vorpommern hagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, mit dem Zweck gegrün- c/o OPERNALE e.V. – Verein zur Förderung der det, die Darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern zu Darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern fördern. Er ist Träger des Opernale INSTITUTS für Musik & Thea- Jager 13 18519 Sundhagen Germany ter, das, 2018 ins Leben gerufen, Vorpommern durch vielfälti ge T +49 38333 88512, [email protected] auf TOUR Angebote in Schulen, Scheunen, Kirchen und Gutshäusern eine www.opernale.de 2019 Werden Sie Akti onär! klangvolle Sti mme gibt. Der Kooperati onsgedanke mit Fokus auf den ländlichen Raum ist fester Bestandteil unserer Philosophie. 10. August – 7. September Die OPERNALE-Förderakti e ist eine ideelle Akti e und garanti ert Die OPERNALE, das Opernfesti val im ländlichen Nordosten KARTENVORVERKAUF den besonderen Mehrwert bürgerschaft lichen Engagements Mecklenburg-Vorpommerns, ist das Herzstück des Opernale Karten zum Preis von 25 € zuzüglich VVK-Gebühr erhältlich unter sowie eine hohe kulturelle Rendite: die Akti e fi nanziert anteilig INSTITUTS. Es bietet Musiktheater jedes Jahr neu, professionell, www.opernale.de sowie an allen bekannten www.mvti cket.de die OPERNALE 2019 auf TOUR „Clanga pomarina. Die Schreiad- überraschend und auf Tour durch Vorpommern. Dabei ist es uns Vorverkaufsstellen oder den jeweiligen Veranstaltungsorten. leroper“ und unterstützt außerdem den weiteren Aufb au des ein Anliegen, die ausgewählten Spielorte nicht nur temporär neugegründeten Opernale INSTITUTS für Musik & Theater zu beleben, sondern die Arbeit der regionalen Kulturakteure zu Wir danken allen Förderern und Partnern der OPERNALE 2019: in Vorpommern. -

The First Sparks and the Far Horizons Stirring up the Thinking on the Earliest Scandinavian Urbanization Processes – Again
The First Sparks and the Far Horizons Stirring up the Thinking on the Earliest Scandinavian Urbanization Processes – Again BY MATS MOGREN Mogren, Mats. 2013. The First Sparks and the Far Horizons. Stirring up the Thinking on Abstract the Earliest Scandinavian Urbanization Processes – Again. Lund Archaeological Review 18 (2012), pp. 73–88. The author stresses the need for new input into research on Early Medieval (6th–11th century) urbanization processes in Scandinavia. A multi-pronged approach is suggested, where the societal structure of the region and period must be re-evaluated using hitherto relatively untried theoretical tools, such as a heterarchical perspective, the heterogenetic- orthogenetic conceptual pair, and a deconstruction of the bewildering concept of central place. It also includes a necessary critique of the “power paradigm”, current for 30 years. It is further stressed that comparative material should be sought globally. The Swahili coast of East Africa and maritime Southeast Asia are presented as the most operative comparison regions, due to a number of similar traits shared by the three areas. Network building with the chosen areas aims at a shared future understanding of the causes of the first sparks of urbanization. Mats Mogren, The County Administrative Board of Scania, 205 15 Malmö. mats.mogren@ lansstyrelsen.se. Department of Archaeology and Ancient History, Lund University, Sandgatan 1, 223 50 Lund. [email protected] The paradigmatic nature of research someti- questioned. such a paradigm, or at least a line mes bears a certain resemblance to the labours of thought with certain paradigmatic features, of sisyphus. an understanding of a field of is the idea that the societal elite was decisive inquiry is gradually built up through lots of for the emergence of the earliest urban centres individual and collaborative work until it ac- in northern europe. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Situne Dei Årsskrift För Sigtunaforskning Och Historisk Arkeologi
Situne Dei Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi 2018 Redaktion: Anders Söderberg Charlotte Hedenstierna-Jonson Anna Kjellström Magnus Källström Cecilia Ljung Johan Runer Utgiven av Sigtuna Museum SITUNE DEI 2018 Viking traces – artistic tradition of the Viking Age in applied art of pre-Mongolian Novgorod Nadezhda N. Tochilova The Novgorod archaeological collection of wooden items includes a significant amount of pieces of decorative art. Many of these were featured in the fundamental work of B.A. Kolchin Novgorod Antiquities. The Carved Wood (Kolchin 1971). This work is, perhaps, the one generalizing study capable of providing a full picture of the art of carved wood of Ancient Novgorod. Studying the archaeological collec- tions of Ancient Novgorod, one’s attention is drawn to a number of wooden (and bone) objects, the art design of which distinctly differs from the general conceptions of ancient Russian art. The most striking examples of such works of applied art will be discussed in this article. The processes of interaction between the two cultures are well researched and presented in the works of a group of Swedish archaeologists, whose work showed the complex bonds of interaction between Sweden and Russia, reflected in a number of aspects of material culture (Arbman 1960; Jansson 1996; Fransson et al (eds.) 2007; Hedenstierna- Jonson 2009). Moreover, in art history literature, a few individ- ual works of applied art refer to the context of the spread of Viking art (Roesdahl & Wilson eds 1992; Graham-Campbell 2013), but not to the interrelation, as a definite branch of Scandinavian art, in Eastern Europe. If we apply this focus to Russian historiography, then the problem of studying archaeological objects of applied art is comparatively small, and what is important to note is that all of these studies also have an archaeological direction (Kolchin 1971; Bocharov 1983). -

European Parliament
EUROPEAN PARLIAMENT ««« « « « « 1999 « « 2004 ««« Session document FINAL A5-0332/2001 11 October 2001 REPORT on the progress achieved in the implementation of the common foreign and security policy (C5-0194/2001 – 2001/2007(INI)) Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy Rapporteur: Elmar Brok RR\451563EN.doc PE 302.047 EN EN PE 302.047 2/18 RR\451563EN.doc EN CONTENTS Page PROCEDURAL PAGE ..............................................................................................................4 MOTION FOR A RESOLUTION .............................................................................................5 EXPLANATORY STATEMENT............................................................................................11 RR\451563EN.doc 3/18 PE 302.047 EN PROCEDURAL PAGE At the sitting of 18 January 2001 the President of Parliament announced that the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy had been authorised to draw up an own-initiative report, pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure and with a view to the annual debate pursuant to Article 21 of the EU Treaty, on the progress achieved in the implementation of the common foreign and security policy). By letter of 4 May 2001 the Council forwarded to Parliament its annual report on the main aspects and basic choices of the CFSP, including the financial implications for the general budget of the European Communities; this document was submitted to Parliament pursuant to point H, paragraph 40, of the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 (7853/2001 – 2001/2007(INI)). At the sitting of 14 May 2001 the President of Parliament announced that she had referred this document to the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy as the committee responsible (C5-0194/2001). -

THE DISCOVERY of the BALTIC the NORTHERN WORLD North Europe and the Baltic C
THE DISCOVERY OF THE BALTIC THE NORTHERN WORLD North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD Peoples, Economies and Cultures EDITORS Barbara Crawford (St. Andrews) David Kirby (London) Jon-Vidar Sigurdsson (Oslo) Ingvild Øye (Bergen) Richard W. Unger (Vancouver) Przemyslaw Urbanczyk (Warsaw) VOLUME 15 THE DISCOVERY OF THE BALTIC The Reception of a Catholic World-System in the European North (AD 1075-1225) BY NILS BLOMKVIST BRILL LEIDEN • BOSTON 2005 On the cover: Knight sitting on a horse, chess piece from mid-13th century, found in Kalmar. SHM inv. nr 1304:1838:139. Neg. nr 345:29. Antikvarisk-topografiska arkivet, the National Heritage Board, Stockholm. Brill Academic Publishers has done its best to establish rights to use of the materials printed herein. Should any other party feel that its rights have been infringed we would be glad to take up contact with them. This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Blomkvist, Nils. The discovery of the Baltic : the reception of a Catholic world-system in the European north (AD 1075-1225) / by Nils Blomkvist. p. cm. — (The northern world, ISSN 1569-1462 ; v. 15) Includes bibliographical references (p.) and index. ISBN 90-04-14122-7 1. Catholic Church—Baltic Sea Region—History. 2. Church history—Middle Ages, 600-1500. 3. Baltic Sea Region—Church history. I. Title. II. Series. BX1612.B34B56 2004 282’485—dc22 2004054598 ISSN 1569–1462 ISBN 90 04 14122 7 © Copyright 2005 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Academic Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP.