It's the Internet, Stupid!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 17/111 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 111. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 26. Mai 2011 Inhalt: Nachruf auf den ehemaligen Vizepräsidenten Thilo Hoppe (BÜNDNIS 90/ des Deutschen Bundestages Helmuth Becker 12603 A DIE GRÜNEN) . 12623 C Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU) . 12624 B neten Ruprecht Polenz, Dr. Martina Bunge Hartwig Fischer (Göttingen) (CDU/CSU) . und Karl Schiewerling . 12603 D 12625 B Begrüßung der neuen Abgeordneten Stefan Rebmann und Harald Ebner . 12604 A Wahl der Abgeordneten Karin Maag als or- Tagesordnungspunkt 4: dentliches Mitglied im Kuratorium der Stif- a) Erste Beratung des von der Fraktion der tung „Erinnerung, Verantwortung und Zu- SPD eingebrachten Entwurfs eines Neun- kunft“ . 12604 A zehnten Gesetzes zur Änderung des Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Bundeswahlgesetzes nung . 12604 A (Drucksache 17/5895) . 12626 A b) Erste Beratung des von den Abgeordneten Halina Wawzyniak, Sevim Dağdelen, Dr. Dagmar Enkelmann, weiteren Abgeordne- Tagesordnungspunkt 3: ten und der Fraktion DIE LINKE einge- brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än- Abgabe einer Regierungserklärung durch derung des Grundgesetzes und zur die Bundeskanzlerin: zum G-8-Gipfel am Reformierung des Wahlrechts 26./27. Mai 2011 in Deauville . 12605 A (Drucksache 17/5896) . 12626 B Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin . 12605 B Thomas Oppermann (SPD) . 12626 B Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) . 12609 B Dr. Günter Krings (CDU/CSU) . 12628 D Rainer Brüderle (FDP) . 12612 A Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD) . 12631 C Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 12614 B Thomas Oppermann (SPD) . 12633 C Volker Kauder (CDU/CSU) . 12617 A Jan Korte (DIE LINKE) . 12634 C Dr. Frithjof Schmidt (BÜNDNIS 90/ Dr. -

Anschriften Stellungnahme SGB II FG Armut Und Soziale Sicherungssysteme
Anschriften Stellungnahme SGB II FG Armut und soziale Sicherungssysteme Berlin Bundestagsabgeordnete CDU Monika Grütters, Prof. Monika Grütters, MdB Landesliste Fritz-Reuter-Straße 11 12623 Berlin Dr. Jan-Marco Luczak, CDU Bürgerbüro Tempelhof-Schöneberg Tempelhof-Schöneberg Dr. Jan-Marco Luczak, Tempelhofer Damm 158/160 D-12099 Berlin Frank Steffel, Dr. Frank Steffel, MdB Reinickendorf Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 11011 Berlin Stefanie Vogelsang, Frau Stefina Vogelsang, MdB Neukölln Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 11011 Berlin Kai Wegner, Bürgerbüro Spandau Herrn Kai Wegner MdB Hoher Steinweg 4 13597 Berlin Karl-Georg Wellmann, Wahlkreisbüro Steglitz-Zehlendorf Herrn Karl-Georg Wellmann Clayallee 349 14169 Berlin Berlin Bundestagsabgeordnete SPD Eva Högl, Wahlkreisbüro Mitte Dr. Eva Högl, MdB Müllerstraße 163 13353 Berlin Petra Merkel, Petra Merkel (SPD) Charlottenb.-Wilmersdorf Mitglied des deutschen Bundestages Deutscher Bundestag 11011 Berlin Mechthild Rawert, Wahlkreisbüro: Landesliste Mechthild Rawert, MdB Friedrich- Wilhelm- Straße 86 12099 Berlin- Tempelhof Swen Schulz, Bürgerbüro Spandau Landesliste Swen Schulz Bismarckstraße 61, 13585 Berlin Wolfgang Thierse, Wahlkreisbüro Landesliste Wolfgang Thierse, MdB Hagenauer Straße 3 10435 Berlin 1 Berlin Bundestagsabgeordnete CDU Renate Künast, Renate Künast, MdB Landesliste Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Platz der Republik 1 11011 Berlin Hans-Christian Ströbele, Hans-Christian Ströbele, MdB Friedrichsh.-Kreuzbg. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Platz der Republik -

Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael
www.ssoar.info Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grote, J., Müller, A., & Vollmer, M. (2016). Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015. (Annual Policy Report / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nationale Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68289-3 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses -

Plenarprotokoll 18/91
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/91 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 91. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 5. März 2015 Inhalt: Wahl des Abgeordneten Florian Post als d) Antrag der Abgeordneten Dr. Harald stellvertretendes Mitglied des Beirats bei der Terpe, Maria Klein-Schmeink, Kordula Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Schulz-Asche, weiterer Abgeordneter und Telekommunikation, Post und Eisenbah- der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- nen . 8579 A NEN: Gesundheitsversorgung umfas- send verbessern – Patienten und Wahl der Abgeordneten Ronja Schmitt (Alt- Kommunen stärken, Strukturdefizite hengstett) als Schriftführerin . 8579 B beheben, Qualitätsanreize ausbauen Drucksache 18/4153 . 8580 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung . 8579 B Annette Widmann-Mauz, Parl. Staatssekretärin BMG . 8580 C Nachträgliche Ausschussüberweisung . 8579 D Harald Weinberg (DIE LINKE) . 8582 A Dr. Karl Lauterbach (SPD) . 8583 A Tagesordnungspunkt 3: Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 8584 B a) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Ge- Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . 8585 D setzes zur Stärkung der Versorgung in Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ der gesetzlichen Krankenversicherung DIE GRÜNEN) . 8587 A (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) Birgit Wöllert (DIE LINKE) . 8588 A Drucksache 18/4095 . 8580 A Sabine Dittmar (SPD) . 8588 D b) Antrag der Abgeordneten Harald Jens Spahn (CDU/CSU) . 8590 A Weinberg, Birgit Wöllert, Sabine Hilde Mattheis (SPD) . 8591 D Zimmermann (Zwickau), weiterer Abge- ordneter und der Fraktion DIE LINKE: Karin Maag (CDU/CSU) . 8593 A Private Krankenversicherung als Voll- versicherung abschaffen – Hochwertige Tagesordnungspunkt 4: und effiziente Versorgung für alle Drucksache 18/4099 . 8580 A a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs c) Antrag der Abgeordneten Birgit Wöllert, eines Gesetzes zur Dämpfung des Sabine Zimmermann (Zwickau), Matthias Mietanstiegs auf angespannten Woh- W. -

Andrea Voßhoff Bundesbeauftragte Für Den Datenschutz Und Die Informationsfreiheit
Andrea Voßhoff Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit POSTANSCHRIFT Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 1468, 53004 Bonn An die HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn VERBINDUNGSBÜRO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin Vorsitzende des Ausschusses für TELEFON (0228) 997799-100 Recht und Verbraucherschutz TELEFAX (0228) 997799-550 des Deutschen Bundestages E-MAIL [email protected] Frau Renate Künast, MdB INTERNET www.datenschutz.bund.de DATUM Bonn, 29.05.2017 mit der Bitte um Weiterleitung an die GESCHÄFTSZ. 22-221-1/004#0165 Mitglieder Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei allen Antwortschreiben unbedingt an. und die Besuchen Sie uns: Tag der Deutschen Einheit Obleute des Rechtsausschusses und 1. – 3. Oktober 2011 in Bonn rechtspolitischen Sprecher der Frakti- onen des Deutschen Bundestages Frau Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB Herrn Dr. Stephan Harbarth, MdB Herrn Dr. Johannes Fechner, MdB Herrn Harald Petzold, MdB Frau Halina Wawzyniak, MdB Frau Katja Keul, MdB Platz der Republik 1 11011 Berlin BETREFF Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des Ju- gendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze HIER BT-Drs. Drucksache 18/11272 und Formulierungshilfe mit Änderungsantrag zur Einführung einer Quellen-Telekommunikationsüberwachung und einer Online- Durchsuchung in der Strafprozessordnung, A-Drs. 18(6)334 BEZUG Öffentliche Anhörung am 31.05.2017 ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 23107/2017 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße SEITE 2 VON 2 Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, beiliegend übersende ich Ihnen meine Stellungnahme zu dem oben genannten Ge- setzentwurf. Leider hat es das BMJV unterlassen, mich zu dem mit der Formulierungshilfe einge- reichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellen- Telekommunikationsüberwachung und einer Online-Durchsuchung in der Strafpro- zessordnung zu beteiligen (Ausschussdrucksache 18(6)334 v.15. -

EU Camps in North Africa Are Pointless and Illegal "The So-Called Disembarkation Platforms Remain Nothing but Hot Air
Andrej Hunko Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1, 11011 Berlin Telefon030 227 – 79133 Fax30 227 – 76133 E-Mail: [email protected] Wahlkreis Augustastr. 69, 52070 Aachen Telefon 0241 9906825-0 Fax 0241 9906825-1 E-Mail: [email protected] Berlin, October 25th, 2018 Press releas EU camps in North Africa are pointless and illegal "The so-called disembarkation platforms remain nothing but hot air. Not one of the intended countries in North Africa has been asked, there is not even a diplomatic concept or timetable in the relevant EU Council working groups. And the Federal Government now only wants to talk about 'disembarkation agreements'", stated Andrej Hunko, European policy spokesman for the Left Party parliamentary group in the German Bundestag in reaction to a related response from the Federal Ministry of the Interior. The European Union is examining the establishment of "regional disembarkation centres" or "regional disembarkation platforms" in third countries. In its conclusions of 28 June 2018, the Council calls upon the Commission to examine such a concept for refugees rescued in the Mediterranean Sea, alongside the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). According to the Ministry, to date no third country has declared itself willing to enter a "disembarkation agreement". Andrej Hunko continued: "A plan for European camps in North Africa was already floated by former Minister of the Interior Otto Schily. Yet it remains illegal, as these would perpetuate the return of those seeking protection Seite 1 von 2 Andrej Hunko Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1, 11011 Berlin Telefon030 227 – 79133 Fax30 227 – 76133 E-Mail: [email protected] Wahlkreis Augustastr. -
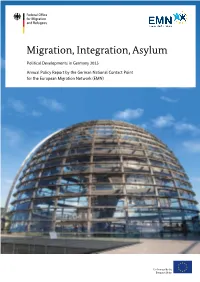
Migration, Integration, Asylum
Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Co-financed by the European Union Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Federal Office for Migration and Refugees 2016 Summary 5 Summary The German Bundestag passed a number of amendments The 2015 Policy Report of the German National Contact over the course of 2015, which include Point for the European Migration Network (EMN) provides an overview of the most important political dis- ■■ the Act on the redefinition of the right to stay and cussions as well as political and legislative developments the termination of residence (entry into force: in the areas of migration, integration, and asylum in the 1 August 2015), Federal Republic of Germany in the year 2015. The report ■■ Act on the Acceleration of Asylum Procedures – refers specifically to measures taken by the Federal Asylum Package I (entry into force: 24 October 2015), Republic of Germany to implement the Global Approach ■■ Act to improve accommodation, care and assistance to Migration and Mobility, the EU Strategy towards for foreign children and young persons (entry into the Eradication of Trafficking in Human Beings and the force: 1 November 2015), European Agenda for the Integration of Third-Country ■■ Third Victims’ Rights Reform Act (entry into force: Nationals. The report also describes the general struc- 31 December 2015). ture of the political and legal system in Germany. In addition to the legislation of the Bundestag, the Federal Ministry for Labour and Social Affairs (BMAS) revised the The jump in asylum migration and how to deal with it Employment Ordinance (BeschV) in 2015, which forms the was the central migration, integration and asylum issue basis for allowing immigrants in certain occupations and in 2015. -

Report Data Privacy and Data Security 2015
DATA PrivAcy AnD DATA securiTy rePorT 2015 upDates inDustry 4.0 Botnet seCurity poliCy interConneCtivity seCret CoDe CyBerwar regulation rules CryptograpHy Big Data CyBerspaCe Data proteCtion integrity CyBer DeFense Center Firewall virus proteCtion BasiC rigHts Digitization enCryption Control meCHanism DDos attaCk Data proteCtion oFFiCer rules it seCurity aCt inFormational selF-Determination passworD rules it seCurity HaCker ClouD serviCes eu general Data proteCtion regulation Data minimization selF-Determination emergenCy plan DATA PrivAcy AnD DATA securiTy rePorT 2015 DATA PrivAcy AnD DATA securiTy rePorT 2015 14 The generAl Data ProTecTion regulation sTrengThens The sTrengThs of The euroPeAn iT inDusTry conTenTs 06 A key sTeP TowArDs fAir comPeTiTion Jan Philipp Albrecht, Member of the European The grounDbreAking ruling shAking 16 Parliament SecuriTy for The uP The DigiTAl economy 21 Dr. Thomas Kremer, fourTh inDusTriAl Member of the Board of Management for Data Privacy, revoluTion Legal Affairs and Compliance at Deutsche Telekom Reinhard Clemens, CEO of T-Systems and Member of Deutsche Telekom’s Board of Management and Director of its IT Division 08 Beginning The journey To moDern-day data Policies Dr. Thomas de Maizière, 10 Data securiTy AnD 22 Capturing The mArkeT…. Federal Minister of the Interior PrivAcy Are imPorTAnT eAsy, fAsT AnD secure issues for germAny’s Dr. Ferri Abolhassan, DomesTic inTelligence Member of the Management Board service of T-Systems International Dr. Heinz-Georg Maaßen, President of the BfV 52 Welcome To The zeTTAbyTe Age 27 creating TrusT Anette Bronder, Lothar Schröder, Member of T-Systems Inter- 12 A big sTeP forwArD inTo Deputy Chairman of the Supervisory national’s Board of Manage- The DigiTAl revoluTion Board at Deutsche Telekom and ment and Director of its Vĕra Jurová, Chairman of the Data Protection Digital Division European Commissioner for Justice, Advisory Board Consumers and Gender Equality 18 Europe and its privacy shield Wolfgang Kopf, LL.M. -

Plenarprotokoll 17/96
Plenarprotokoll 17/96 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 96. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 17. März 2011 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Sigmar Gabriel (SPD) . 10889 D neten Dr. Lukrezia Jochimsen und Edelgard Birgit Homburger (FDP) . 10893 D Bulmahn . 10881 A Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 10896 B Begrüßung der neuen Abgeordneten Helmut Heiderich und Ingo Egloff . 10881 B Volker Kauder (CDU/CSU) . 10898 D Wahl des Abgeordneten Peter Wichtel als Michael Schlecht (DIE LINKE) . 109010000 AB Schriftführer . 10881 B Volker Kauder (CDU/CSU) . 10901 C Erweiterung der Tagesordnung . 10881 C Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . Absetzung der Tagesordnungspunkte 27 d und 10901 D 30 . 10882 B Michael Kauch (FDP) . 10903 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 10882 B Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) . 10905 A Michael Schlecht (DIE LINKE) . 10905 C Dr. Christian Ruck (CDU/CSU) . 10907 C Tagesordnungspunkt 5: Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/ Abgabe einer Regierungserklärung durch die DIE GRÜNEN) . 10909 B Bundeskanzlerin: zur aktuellen Lage in Ja- Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . 10910 B pan . 10882 D Jürgen Klimke (CDU/CSU) . 10911 D Erika Steinbach (CDU/CSU) . in Verbindung mit 10912 D Thomas Bareiß (CDU/CSU) . 10913 D Namentliche Abstimmungen . 10914 D Zusatztagesordnungspunkt 1: 10915 A, B, C Erste Beratung des von den Abgeordneten Ergebnisse . Jürgen Trittin, Renate Künast, Sylvia Kotting- 10921 A, 10923 B Uhl, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 10926 A, 10928 B BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten 10930 B, 10933 A Entwurfs eines Dreizehnten Gesetzes zur 10935 B Änderung des Atomgesetzes und zur Wie- Tagesordnungspunkt 6: derherstellung des Atomkonsenses (Drucksache 17/5035) . 10882 D Erste Beratung des von den Abgeordneten Volker Beck (Köln), Ingrid Hönlinger, Memet Dr. -

Answer of the Federal Government to the Minor Interpellation Tabled by the Members of the Bundestag Ulla Jelpke, Andrei Hunko, A
Answer of the Federal Government to the Minor Interpellation tabled by the Members of the Bundestag Ulla Jelpke, Andrei Hunko, Annette Groth, Inge Höger, Stefan Liebich, Petra Pau, Halina Wawzyniak and the Left Party parliamentary group - Bundestag printed paper 18/280, 20 December 2013 - Development of the EUBAM mission in Libya Preliminary remarks by the questioners In June of this year the EU launched the European Union Integrated Border Management Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya). The German Federal Police are also participating in this mission. Among its objectives is the establishment of a hitherto non-existent body of "Border Guards", a gendarmerie that is under the command of the military but is deployed domestically. In addition to their border security duties, the guards are to be deployed inter alia to secure "sensitive infrastructure". The portfolio also encompasses special operations such as those for which training is also provided within the framework of EUBAM (Libya Herald, 8 November 2013). The EUBAM mission is followed with a critical eye, not least because the human rights situation in Libya remains extremely poor. The security authorities, to the extent that they even exist in the true sense of the word and have not been replaced by militias, are at times involved in human rights abuses. Especially in regard to the treatment of refugees, there appears to have been no improvement compared to the Gaddafi era. The mission therefore harbours the risk of not improving the legal situation but instead contributing to the strengthening of groups, including militias, that are inimical to human rights. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 17/41 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 41. Sitzung Berlin, Freitag, den 7. Mai 2010 I n h a l t : Gedenkworte zum 8. Mai 1945 ..................... Joachim Poß (SPD) ...................................... 3989 A 3991 D Otto Fricke (FDP) ........................................ Tagesordnungspunkt 23: 3993 B Zweite und dritte Beratung des von den Frak- Carsten Schneider (Erfurt) (SPD) ................. tionen der CDU/CSU und der FDP einge- 3995 A brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Über- nahme von Gewährleistungen zum Erhalt Otto Fricke (FDP) ........................................ 3995 C der für die Finanzstabilität in der Wäh- Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) ................. 3995 D rungsunion erforderlichen Zahlungsfähig- Renate Künast (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ....................................... 3998 B keit der Hellenischen Republik (Wäh- Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) ................. 4000 B rungsunion-Finanzstabilitätsgesetz – Renate Künast (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ....................................... WFStG) 4000 C Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister (Drucksachen 17/1544, 17/1561, 17/1562) .... BMF ........................................................ 3989 D 4001 A Sigmar Gabriel (SPD) .................................. Norbert Barthle (CDU/CSU) ........................ 4003 B 3990 B II Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 41. Sitzung, Berlin, Freitag, den 7. Mai 2010 Otto Fricke (FDP) .................................... rung 4005 A (Drucksache 17/865) ............................... 4031 -

Plenarprotokoll 17/173
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 17/173 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 173. Sitzung Berlin, Freitag, den 30. März 2012 Inhalt: Nachträgliche Ausschussüberweisung . 20471 A Dieter Jasper (CDU/CSU) . 20490 A Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . 20491 C Tagesordnungspunkt 31: Antrag der Abgeordneten Dr. Joachim Tagesordnungspunkt 32: Pfeiffer, Nadine Schön (St. Wendel), Peter a) Antrag der Abgeordneten Dr. Konstantin Altmaier, weiterer Abgeordneter und der von Notz, Volker Beck (Köln), Kai Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeord- Gehring, weiterer Abgeordneter und der neten Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Martin Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Lindner (Berlin), Claudia Bögel, weiterer Ab- EU-Datenschutzreform unterstützen geordneter und der Fraktion der FDP: Wachs- (Drucksache 17/9166) . 20493 C tumspotenziale der Digitalen Wirtschaft weiter ausschöpfen – Innovationsstandort b) Antrag der Abgeordneten Dr. Konstantin Deutschland stärken von Notz, Volker Beck (Köln), Ingrid (Drucksache 17/9159) . 20471 B Hönlinger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Dr. Philipp Rösler, Bundesminister Völlige Unabhängigkeit für den Bun- BMWi . 20471 B desdatenschutzbeauftragten Garrelt Duin (SPD) . 20473 D (Drucksache 17/6345) . 20493 C Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP) . 20475 D c) Beschlussempfehlung und Bericht des In- nenausschusses zu dem Antrag der Abge- Garrelt Duin (SPD) . 20476 B ordneten Dr. Konstantin von Notz, Nicole Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) . 20476 D Maisch, Tabea Rößner, weiterer Abgeord- neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Halina Wawzyniak (DIE LINKE) . 20478 C GRÜNEN: Grundrechte schützen – Da- Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/ tenschutz und Verbraucherschutz in so- DIE GRÜNEN) . 20479 C zialen Netzwerken stärken (Drucksachen 17/8161, 17/9198) . 20493 D Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) . 20480 D Dr.