Barock Und Rokoko
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abstract Writing the Olympic Dream
ABSTRACT WRITING THE OLYMPIC DREAM: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MEDIA COVERAGE OF THE 2004 OLYMPIC PAUL HAMM MEDIA CONTROVERSY by Margi Sammons This thesis is a critical analysis of newspaper coverage of the 2004 Olympic men’s gymnastics “controversy.” In this coverage an Olympic media complex is present, in which the press must recognize the Olympic myth and simultaneously deal with its inherent hegemonic and capitalistic ideologies when reporting on Olympic “scandals.” This paper will present a case study of USA Today and The New York Times articles to illustrate the language, topics, and style these newspapers use to cover the “controversy.” Writing the Olympic Dream: A Critical Analysis of the Media Coverage of the 2004 Olympic Paul Hamm Media Controversy A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Communication by Margi Sammons Miami University Oxford, Ohio 2005 Advisor______________________________________ Dr. Kathleen German Reader_______________________________________ Dr. Bruce Drushel Reader_______________________________________ Dr. Ronald Scott TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1 ................................................................................................................................... 1 CHAPTER 2 ................................................................................................................................. 23 CHAPTER 3 ................................................................................................................................ -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Johann Baptist Hagenauer (1732–1810) und sein Schülerkreis. Wege der Bildhauerei im 18. und 19. Jahrhundert“ Verfasserin Mag. phil. Mariana Scheu angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 315 Dissertationsgebiet lt. Studien- Kunstgeschichte blatt: Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Ingeborg Schemper-Sparholz Inhalt I. Einleitung....................................................................................................................... 3 II. Forschungsstand ......................................................................................................... 13 III. Johann Baptist Hagenauer......................................................................................... 23 1. Hagenauers bildhauerisches Schaffen in Salzburg ................................................ 24 1.1. Die Salzburger Bildhauerwerkstatt ................................................................. 27 2. Hagenauer an der Wiener Akademie der bildenden Künste .................................. 30 2.1. Die Bildhauerprofessur ................................................................................... 31 2.2. Die Erzverschneiderschule an der Wiener Akademie .................................... 38 2.2.1. Zur Bedeutung der Schule als künstlerische Ausbildungsstätte ........... 64 3. Das künstlerische Schaffen zwischen 1780 und 1810 ........................................... 67 IV. Die Schüler Johann Baptist Hagenauers -

CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE Binney, Thomas - Bradford, John by James Strong & John Mcclintock
THE AGES DIGITAL LIBRARY REFERENCE CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE Binney, Thomas - Bradford, John by James Strong & John McClintock To the Students of the Words, Works and Ways of God: Welcome to the AGES Digital Library. We trust your experience with this and other volumes in the Library fulfills our motto and vision which is our commitment to you: MAKING THE WORDS OF THE WISE AVAILABLE TO ALL — INEXPENSIVELY. AGES Software Rio, WI USA Version 1.0 © 2000 2 Binney, Thomas D.D., LL.D. an eminent English Congregational minister, was born at Newcastle-on- Tyne, April 30, 1798. In early life he was engaged in secular employment, but found time for reading and composition, and, by the help of a Presbyterian clergyman, acquired a good knowledge of Latin and Greek. He was brought to Christ when he was young, and he early sought admission to the Christian ministry. His student-life was spent at Wymondley, Herts, and his first settlement was at Bedford, where he continued but twelve months. Mr. Binney was ordained in 1824 to the pastoral office at Newport, Isle of Wight. Here he preached five years, and here began his career as an author, by publishing a memoir of Rev. Stephen Morell, an intimate and beloved friend. In 1829 Mr. Binney accepted a call to the pastorate at the Weigh House, London, and then entered upon a course of usefulness and popularity, which for forty years he sustained with almost undiminished vigor. During the last two years of his life he occupied, with acceptance, the chair of homiletics at New College. -
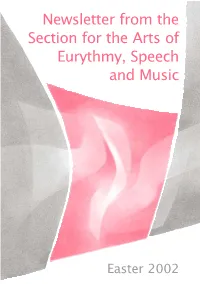
Easter 2002 1
Newsletter from the Section for the Arts of Eurythmy, Speech and Music Easter 2002 1 EDITORIAL Dear Readers, Since the last Newsletter, the world both around us and within us has become more demand- ing. The question about the very existence of our arts and our work is becoming more urgent. That applies here at the Goetheanum as much as in the whole world. You will have read about the changes in the Theatre Ensemble at the Goetheanum. In order that the work can get further a readiness for risk is required. Our next challenge is the project to produce Goethe’s Faust in a less extravagant style under the direction of Wilfried Hammacher. This will only be possible when we manage to engage all our friends in the world to raise the necessary finances. Then we shall be able in future to have an Ensemble at the Goetheanum. At the Christmas Conference, 2001, we experienced all four Mystery Dramas in a strong, sub- stance-filled production. With two new actors in the Ensemble it will be possible to work fur- ther and produce Rudolf Steiner’s four Mystery Dramas also for the Summer Conference. Please join in the efforts so that the work in the autumn can proceed with the production of Faust! Section work has grown enormously. In all areas acute tasks and burning questions are there to be solved. We gain Michael Kurtz as co-worker in the musical realm. His many contacts to musicians of the present day is an enormous help – the most recent biography of Sofia Gubaidulina was written by him. -

Die Münchner Akademie Der Bildenden Künste Vor 1808 Inhalt
Monika Meine-Schawe "... alles zu leisten, was man in Kunstsachen nur verlangen kan" Die Münchner Akademie der bildenden Künste vor 1808 Inhalt Die Forschung | Die Bittschrift | Die "Zeichnungs Schule respective Ma- ler= und Bildhauer academie" | Die Abgusssamlung der frühen Jahre | Der Umzug 1783/84 | Kopieren in der Galerie | Stipendien, Ausstellungen und Wettbewerbe | Die Professoren bis um 1800 | Die Abgusssammlung bis 1808 | Reformbestrebungen | Das Jahr 1808 | ANHANG 1 Die Bittschrift | ANHANG 2 Schülerliste | ANHANG 3 Gipsabgusssammlung | Verzeich- nis der abgekürzt zitierten Literatur | Abkürzungen | Abbildungen Erstpublikation in: Oberbayerisches Archiv, Bd. 128 (2004), S. 125-181. Die Forschung Die Münchner Akademie der bildenden Künste gilt als späte Gründung unter den deutschen Akademien1. Nur die 1808 ins Leben gerufene Institution hat ih- ren Platz im Bewusstsein der Öffentlichkeit (Abb. 1). Es ist die Akademie Jo- hann Peter von Langers (1756-1824, geadelt 1808) und Peter von Cornelius' (1783-1867). Zahlreiche Künstlergrößen gingen daraus hervor, die die süddeut- sche Kunstlandschaft des 19. Jahrhunderts nachhaltig prägten. Doch hatte diese Einrichtung ihre Vorgeschichte, die weit in das 18. Jahrhundert, noch vor die 1770 durch Kurfürst Maximilian III. Joseph (reg. 1745-1777) gegründete soge- nannte "Zeichnungsschule" zurückreicht, die die Bezeichnung "Akademie" be- reits im Namen trug ("Zeichnungs Schule respective Maler= und Bildhauer aca- demie"). Die Geschichte dieser älteren Institution ist, anders als die der spä- teren, nur unzureichend erforscht. Dies liegt einerseits sicherlich an der schwer zu überblickenden und lückenhaften dokumentarischen Überlieferung. Andererseits hat der lange Schatten der Akademie des 19. Jahrhunderts das Seinige dazu beigetragen, dass die Vorgängerin kaum zur Kenntnis genommen, 1 Zur Geschichte der Akademien siehe Pevsner 1986, hier S. -

Oberammergau and Its Passion Play, 1910. Munich. Routes to Oberammergau. Oberammergau and Its Environs. the Royal Castles. Garmi
DD UC-NRLF 901 025&7 to C\J m GIFT OF Mr* M Mangasarian log. Bruckmann's Illustrated Guide. assion Play 1910 Munich, Routes to Oberammergau, "to Royal Castles, Garmisch etc. etc. Illlllllll III HI IHIIIII HHII Illlllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllll I Royal Umbrella Manufactory of Austria J. B. FENSTERER By Appointment to the Royal Court of Bavaria 44 Theatinerstr. 44 MUNICH Entrance Perusastr. Umbrellas, Parasols, En Tout Cas, Walking Sticks. German, French and English Style. On parle frangais. <<#>* English Spoken. Daily Supply of Novelties. Branch in NUREMBERG, Kaiserstr. 21. I 111[111] I HIIIIIIIIIIIIIMl SCHENKER & Co. TOURIST OFFICE MUNICH, 16 PROMENADEPLATZ 16. TELEGRAMS: WELTREISEN. - TELEPHONES: 4700, 4701, 4702, 2203. Official Agents for the Passion Play at Oberammergau 1910. Branch-Offices: Bad Kissintjen Bad Reichenhall Nuremberg Kurhausstrasse 4 Central-Station Bozen Oberammergau Hotel Greii Building Hotel Wittelsbach Luggage forwarding and ticket office of the Royal Bavarian State-Railways, Rgency of all Steamship- Companies of the world. Correspondents of THOS. COOK & SON. Sleeping Car Hgency. Hll kinds of Railway and Steamship Tickets. Motor car excursions around the city and its environs. Conducted tours to all parts of the world. Conducted and independant tours to Oberammergau and the royal Castles. Hrrangements to witness the Passion Play. General Agency of the ,,GENTRAL GARAGE" in Ober- ammergau 1910 Central Agency of the ,,UNION", Auto Fernverkehr, Munich. I Permanent Exhibition of the G fi Munich ; G flrtists Association G Maximilianstr. 26 Munich Maximilianstr, 26 G in the building of the Old National (! Museum (nouj Deutsches Museum) 2582 G Telephone I Open daily fldmission 50 Pfg. I Visiting time: on I Weekdays 96 o'clock, :: Sundays :: I and Holidays 101 o'clock. -

Einmal So Richtig Abheben - Die Gelegenheit Dazu Beim Freundschaftstreffen Der Ballonfahrer Am 18
Jahrgang 13 September 2010 Ausgabe 09/2010 Einmal so richtig abheben - Die Gelegenheit dazu beim Freundschaftstreffen der Ballonfahrer am 18. - 19-09.2010 in Roßhaupten. Auf gutes Ballonfahrerwetter! Drachenbote Roßhaupten Seite 2 Ausgabe 09/2010 Ein Dankeschön in diesem Zusammenhang an die ausfüh- Aus dem Rathaus rende Firma Uhlemayr aus Seeg für die rasche und problemlose Installation. Ein „Wermutstropfen“ im Trinkwasser In Kürze wird ein Webportal eingerichtet, über das die Bürger Der ungewöhnlich hohe Grundwasserstand im August führte jederzeit die aktuellen Werte und Erträge mitverfolgen beim Roßhauptener Trinkwasser zu Verunreinigungen. Alle können. Hoffen wir, dass die Sonne in Zukunft etwas häufiger Lebensmittelbetriebe wurden unverzüglich informiert, ebenso scheint als in diesem doch sehr durchwachsenen Sommer! erfolgte ein Rundschreiben an die gesamte Bevölkerung. In Thomas Pihusch, 1. Bürgermeister Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde aufgrund der geringfügigen Verunreinigung auf eine Abkochanordnung verzichtet und stattdessen eine Chlorierung vorgenommen. Dazu wurde eigens von der Gemeinde Pfronten ein Chlorie- rungsgerät ausgeliehen. Die Chlorierung erfolgt mit der geringst-möglichen Dosierung bei täglicher Kontrolle und muß solange aufrechterhalten bleiben, bis die Proben die vorgeschriebenen Werte (3 x in Folge) wieder einhalten. Das gechlorte Wasser ist in der angewandten Dosierung für den Verzehr und die Gesundheit unbedenklich. Die Aufhebung der Chlorierung wird rechtzeitig über die Anschlagtafel bekannt gegeben. Für -

Die Bildnisbüsten Der Walhalla Bei Donaustauf. Von Der Konzeption Durch Ludwig I. Von Bayern Zur Ausführung
Die Bildnisbüsten der Walhalla bei Donaustauf Von der Konzeption durch Ludwig I. von Bayern zur Ausführung (1807 - 1842) Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie der Ludwig–Maximilians–Universität München vorgelegt von Simone Steger aus Großhöhenrain Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der LMU München Institut für Kunstgeschichte München, 2011 Erstgutachter: Prof. Dr. Steffi Roettgen Zweitgutachter: Prof. Dr. Frank Büttner Tag der mündlichen Prüfung: 14. Februar 2011 Danksagungen Hiermit möchte ich mich bei folgenden Personen für ihre große Hilfe und freundliche Un- terstützung bei dieser Arbeit, sowie die Bereitstellung und die Genehmigung zur Veröffentli- chung von Bildmaterial bedanken: Frau Prof. Dr. Steffi Roettgen Herrn Prof. Dr. Frank Büttner Herrn Robert Raith, Walhallaverwaltung Regensburg Allen Mitarbeitern des Geheimen Hausarchivs München sowie dem Hause Wittelsbach Dr. Herbert W. Rott, Bayerische Staatsgemäldesammlungen München Dr. des. Frédéric Bußmann, Bayerische Staatsgemäldesammlungen München Herrn Heino Kahrs Archivleiter, Bayerische Staatsgemäldesammlungen München Der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen München Herrn Edmund Hausfelder, Stadtmuseum Ingolstadt Herrn Dr. Ruprecht Stolz Frau Janna Weitkamp, Schlossverwaltung Bebenhausen Frau Christine Bernheiden, Galerie Neuse Bremen Herrn Dr. Christian Geyer und Herrn Dr. Eduard Wätjen Des weiteren für ihren hilfreichen Rat, die Korrektur der Arbeit, ihre Geduld und Zuversicht: Frau Rosemarie Steger Frau Dr. Regine Stefani und Frau Dr. Verena Dirnberger meiner Familie und meinem Mann Stefan Steger Hinweis zur Qualität der Abbildungen: Die Auflösung der nicht selbst fotografierten Abbildungen wurde aus bildrechtlichen Gründen in der Arbeit reduziert. Wurden Bildnachweise nicht explizit angegeben, handelt es sich um eigene Aufnahmen bzw. Fotografien oder Abbildungen, die mir mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in Mün- chen zur Verfügung gestellt wurden. -

Drinks at Plato's: Creating a Contemporary Symposium Or
DRINKS AT PLATO’S: CREATING A CONTEMPORARY SYMPOSIUM OR: “MY BIG FAT GREEK THESIS” by Donald J. Hauka FINAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS In the program of Graduate Liberal Studies © Donald James Hauka 2010 SIMON FRASER UNIVERSITY Spring 2010 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name: Donald J. Hauka Degree: Master of Arts Title of Thesis: “Drinks at Plato’s:” Creating a Contemporary Symposium, or: “My Big Fat Greek Thesis.” Examining Committee: Chair: Name Dr. Stephen Duguid, Director, Graduate Liberal Studies ______________________________________ Name Senior Supervisor Dr. Heesoon Bai, ______________________________________ Name Supervisor Dr. Lynn Fels ______________________________________ External Examiner: George Belliveau, Associate Professor, University of British Columbia Date Defended/Approved: March 30, 2010 ii Declaration of Partial Copyright Licence The author, whose copyright is declared on the title page of this work, has granted to Simon Fraser University the right to lend this thesis, project or extended essay to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. The author has further granted permission to Simon Fraser University to keep or make a digital copy for use in its circulating collection (currently available to the public at the “Institutional Repository” link of the SFU Library website <www.lib.sfu.ca> at: <http://ir.lib.sfu.ca/handle/1892/112>) and, without changing the content, to translate the thesis/project or extended essays, if technically possible, to any medium or format for the purpose of preservation of the digital work. -

Johann Baptist Straub
43 JULIA STROBL JOHANN BAPTIST STRAUB FROM WIESENSTEIG TO MUNICH AND VIENNA Being the eldest, Johann Baptist Straub (1704–84) cer- tainly had a special position and a pioneering role among his brothers. He was the first to leave his father’s workshop in Wiesensteig to pursue training as a sculp- tor at the Wittelsbach residence in Munich. However diligently he learned the craft of this father, master car- penter Johann Georg Sr, it must not be forgotten that he was a carpenter’s journeyman when he started his four-year apprenticeship with the Munich-based court sculptor Gabriel Luidl.1 His first independent works – though unfortunately not preserved – were made in 1725 under court architect Joseph Effner for the newly furbished rooms in the southern wing of the Munich 2 Residence. His brother Philipp Jakob, only two years 1 younger than him, soon followed him to Munich. His name can be found among the payments for assistant Laxenburg, parish church Exaltation of the Cross, Former carpenters employed by the electoral court cabinet pulpit of the Schwarzspanierkirche, 1730–4 (MP, 2019). maker Johann Adam Pichler in winter 1726–7 docu- Laxenburg, Pfarrkirche zur Kreuzerhöhung, Ehem. Kanzel mented by the court’s building authorities.3 At that der Wiener Schwarzspanierkirche, 1730–1734 (MP, 2019) time, the two brothers from Wiesensteig were predom- inantly working in the field of cabinetry and decorative any influence on his student. The young carpenter’s woodcarving. Johann Baptist Straub’s teacher Gabriel assistant and aspiring sculptor could not fail to get ac- Luidl was a less prominent sculptor within the circle quainted with Munich’s France-inspired court art un- of electoral court artists, and stylistically had barely der Elector Max II Emmanuel; Guillelmus de Groff and Giuseppe Volpini were the leading artists. -

Die Münchner Bildhauerschule Figürliches Arbeiten Im Zeichen Der Tradition
Birgit Jooss Die Münchner Bildhauerschule Figürliches Arbeiten im Zeichen der Tradition Zusammenfassung Abstract Die Bildhauerei stand in München stets im Schatten der Malerei. ln Munich, sculpture has always been overshadowed by paint Das mag der Grund dafür sein, dass die Münchner Bildhauer ing. That may explain why the Munich school of sculpture - schule, deren Geschichte sich vor allem anhand der Professoren whose history can be best illustrated in terms of the professors der Akademie der Bildenden Künste illustrieren lässt, bislang nie at the academy of fine arts - has never before been reviewed zusammenhängend untersucht wurde. Dabei werden gerade an as a whole. Such a study turnsout to reveal phenomena that are ihr typische Münchner Phänomene offenbar wie etwa die Aus typical for Munich, including the development of lines of tradi bildung von Traditionslinien und Filiationen, das an der klassi tion and Filiations, a classically influenced view of the human fig schen Antike orientierte Menschenbild oder die Betonung der ure and an emphasis on craftsmanship. This essay uses select Handwerklichkeit. Exemplarisch werden in diesem Beitrag die ed examples to trace the stages of development, since the Entwicklungsstufen von der klassizistisch und romantisch gepräg founding of the academy in 1 808, from classicism and roman ten Bildhauerei zu Beginn der 1808 gegründeten Akademie, ticism in the early periodvia neo-baroque and naturalism in the über neubarocke und naturalistische Tendenzen in der zweiten second half of the 191h century to the leading figure of the Mu Hälfte des 19. Jahrhunderts, hin zum bedeutendsten Vertreter der nich School, the sculptor Adolf von Hildebrand ( 1 847-1921 ). -

Principles of Decoration in the Roman World Decor Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy
Principles of Decoration in the Roman World Decor Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy Edited by Annette Haug Editorial Board Anna Anguissola, Bettina Bergmann, Jens-Arne Dickmann, Miko Flohr, Jörg Rüpke Volume 2 Principles of Decoration in the Roman World Edited by Annette Haug and M. Taylor Lauritsen This publication was funded by the ERC Consolidator Grants DECOR (Nr. 681269). ISBN 978-3-11-072906-1 e-ISBN (PDF) 978-3-11-073213-9 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-073221-4 ISSN 2702-4989 DOI https://doi.org/9783110732139 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020950976 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2021 Annette Haug, M. Taylor Lauritsen, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston The book is published with open access at www.degruyter.com. Typesetting: Dörlemann Satz, Lemförde Printing and binding: Hubert & Co. GmbH Co. KG, Göttingen Cover image: Photo by M. Taylor Lauritsen www.degruyter.com Preface In late February 2019, the ERC-funded project DECOR convened the first of two research colloquia dedicated to the exploration of decorative phenomena in the Roman world. Held in the Institut für Klassische Altertumskunde at Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Principles of Decoration in the Roman World brought together a group of international scholars who sought to address a range of important, if sometimes overlooked, topics related to various forms of decorative media.