Info Zivilstandswesen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau – Rgvk
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT 20. Januar 2021 AUSWERTUNGSBERICHT Aus der öffentlichen Anhörung/Mitwirkung zur Richtplananpassung "Re- gionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau – rGVK OASE 2040" (Ka- pitel M 1.2; Kapitel M 2.2, Beschlüsse 2.1, 3.1; Kapitel M 4.1, Be- schlüsse Planungsgrundsatz D, 1.1, 1.2, 2.1) inklusive entsprechender Anpassung des Kantonsstrassennetzes L:\AVK\2 FBI\640203342 OASE\5 Verfahren\55 Richtplan\557 Botschaft GR\Version 20210120\Arbeitsverzeichnis Rüe\Bot Jan\Web Auswertung Anhör öff MASTER\20210120_RP OASE_Auswertberi zusammengefasst-oeff.docx Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .......................................................................................................................................... 3 1.1 Verfahren und Stellungnahmen .................................................................................................. 3 2. Überblick ........................................................................................................................................... 5 3. Auswertung der Anhörung .............................................................................................................. 6 3.1 Gesamtkonzept OASE ................................................................................................................ 7 3.1.1 Allgemeines ......................................................................................................................... 7 3.1.2 Ziele ................................................................................................................................... -

Militär Und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz PLZ
DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES Militär und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz GEMEINDEN MIT IHREN ZIVILSCHUTZORGANISATIONEN 2020 PLZ Gemeinde ZSO 5000 Aarau Aare Region 4663 Aarburg Wartburg 5646 Abtwil Freiamt 5600 Ammerswil Lenzburg Region 5628 Aristau Freiamt 8905 Arni Freiamt 5105 Auenstein Lenzburg Region 5644 Auw Freiamt 5400 Baden Baden (Region) 5330 Bad Zurzach Zurzibiet 5333 Baldingen Zurzibiet 5712 Beinwil am See aargauSüd 5637 Beinwil (Freiamt) Freiamt 5454 Bellikon Aargau Ost 8962 Bergdietikon Wettingen-Limmattal 8965 Berikon Aargau Ost 5627 Besenbüren Freiamt 5618 Bettwil Seetal 5023 Biberstein Aare Region 5413 Birmenstorf Baden (Region) 5242 Birr Brugg Region 5244 Birrhard Brugg Region 5708 Birrwil aargauSüd 5334 Böbikon Zurzibiet 5706 Boniswil Seetal 5623 Boswil Freiamt 4814 Bottenwil Suhrental-Uerkental 5315 Böttstein Zurzibiet 5076 Bözen Oberes Fricktal 5225 Bözberg Brugg Region 5620 Bremgarten Aargau Ost 4805 Brittnau Zofingen (Region) 5200 Brugg Brugg Region 5505 Brunegg Lenzburg Region 5033 Buchs Aare Region 5624 Bünzen Freiamt 5736 Burg aargauSüd 5619 Büttikon Aargau Ost 5632 Buttwil Freiamt Seite 1 PLZ Gemeinde ZSO 5026 Densbüren Oberes Fricktal 6042 Dietwil Freiamt 5606 Dintikon Aargau Ost 5605 Dottikon Aargau Ost 5312 Döttingen Zurzibiet 5724 Dürrenäsch Seetal 5078 Effingen Oberes Fricktal 5445 Eggenwil Aargau Ost 5704 Egliswil Seetal 5420 Ehrendingen Baden (Region) 5074 Eiken Unteres Fricktal 5077 Elfingen Oberes Fricktal 5304 Endingen Zurzibiet 5408 Ennetbaden Baden (Region) 5018 Erlinsbach AG Aare -

Wenn Ein Restaurantbesuch Luxus Ist Ein Engel Verzückt Die Badstrasse
AZ 5200 Brugg •Nr. 52 –27. Dezember 2019 auch im lesen Sie Aktuelles Mit«GlückwünschefürsneueJahr» Das Amtsblatt der Gemeinden Birmenstorf, Ehrendingen, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal Die Regionalzeitung fürEndingen, Lengnau, Schneisingen, Tegerfelden, Würenlingen (Ausgabe Nord) viel mehr als Druck. Das PERSÖNLICHSTE 110059 Babyfachgeschäft DIESEWOCHE RSP derRegion. EMPFANG DerEhrendinger Ro- mano Meierwar mitseinem Cur- ling-Team am Empfangvon Sport- ministerin ViolaAmherd. Seite3 www.obrist.baby-rose.ch Baden-Dättwil 111511 BK RÜCKBLICK UnserJahr in Bildern –die wichtigstenMomente von 2019,die regionaleSchlagzeilen gemachthaben. Seiten 4und 10 UMFRAGE Sieben Gemeinde- ammänner blickenauf 2019 Einladung zum zurück undverraten, wasim2020 Dreikönigs- ihrHighlight wird. Seite8/9 kuchen-Essen MITTEILUNGEN AUS DENGEMEINDEN 6. JANUAR 2020,APÉROAB11.30 UHR ab Seite12 SBB HISTORIC-GEBÄUDE,WINDISCH www.museumaargau.ch ZITAT DERWOCHE «Schweinesindmei- ne Lieblingstiere. Siehaben mirimmer Glückgebracht.» Alfred Vogt vomBronnehof in Scherz Wenn einRestaurantbesuchLuxus isT dressiertRennschweine. Seite15 RUNDSCHAUNORD Michael Torti, Gabriele Born, Astrid Jakob und René Haber- Luxus, den sie sich sonst kaum leisten könnten. «Big Sam» Effingermedien AG IVerlag stich (von links) sind Menschen, mit denen es das Leben nicht Samy Scheller hat diesen Brauch vorzweiJahren in seinem Storchengasse 15 ·5200 Brugg Telefon 056 460 77 88 (Inserate) nur gut gemeint hat.Amvierten Advent warensie zusammen Restaurant eingeführt:«Einfach, -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Merkblatt "Mobilität in Obersiggenthal"
Gemeinde Obersiggenthal Verkehrskommission MOBILITÄT IN OBERSIGGENTHAL Eine Information der Verkehrskommission Liebe Neuzuzügerin, lieber Neuzuzüger Herzlich willkommen in Obersiggenthal! Damit Sie sich in Ihrer neuen Wohngemeinde schnell zu Recht finden, bietet Ihnen dieses Informationsblatt einen Überblick über die Möglichkeiten zur Fortbewegung in und um Obersiggenthal. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Ortsteile Nussbaumen, Rieden und Kirchdorf sind durch die Linien 2 und 6 der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen RVBW im 7½- bis 15-Minuten-Takt erschlossen. Genaue In- formationen über Fahrpläne und Haltestellen können Sie dem „Willkommenspaket“ der RVBW entnehmen. Darin finden Sie auch zwei Tageskarten für das gesamte Streckennetz. Mit dem Bus erreichen Sie innert kürzester Zeit den Bahnhof Baden mit direkten Anschlüssen nach Zürich HB, Zürich-Flughafen sowie Richtung Aarau, Bern und Basel. Fahrplanauskünfte er- halten Sie unter www.sbb.ch oder www.rvbw.ch. Abonnemente sind an den Automaten der Haltestellen, direkt im Bus sowie am Kiosk neben der Post im Zentrum Markthof erhältlich. Zu Fuss: In Obersiggenthal können Sie alle Einrichtungen von öffentlichem Interesse bequem und auf sicheren Wegen zu Fuss erreichen. Schulwege entlang von Strassen ausserhalb der Tempo 30- Zonen sind durch Trottoirs und Fussgängerstreifen gesichert. Innerhalb des Einkaufszentrums Markthof besteht eine Fussgängerzone. Sämtliche Fussgängerstreifen über verkehrsreiche Stras- sen wurden auf Ihre Sicherheit hin überprüft und an die Erfordernisse der BfU angepasst. Nebst den Strassenverbindungen steht Ihnen in Obersiggenthal ein ausgebreitetes, gut unter- haltenes Netz an Fusswegen zur Verfügung - an Hanglagen teilweise als Treppenwege - wo- durch Abkürzungen ermöglicht werden. Die grossen Naherholungsgebiete am Siggenberg und an der Limmat laden zu weitläufigen Spaziergängen, sportlicher Betätigung und Freizeitgestaltung ein. Mit dem Velo: Obersiggenthal verfügt über ein gut ausgebautes, sicheres Radwegnetz. -
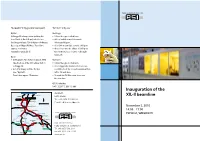
Inauguration of the XIL-II Beamline
P AUL SCHERRER INSTITUT To reach PSI by public transport To find PSI by car By Rail Via Brugg At Brugg AG railway station (railway line • Follow the signs to «Koblenz». from Zurich to Basle/Berne) take the bus • After «Lauffohr» turn left towards line Brugg–Villigen PSI–Böttstein–Döttingen. «Remigen/Villigen». Bus stop at Villigen PSI West. Travel time • After 300 m turn right towards «Villigen». approx. 20 minutes. • About 1 km after the village of «Villigen» Timetables: www.sbb.ch the PSI West area is located on the right hand side. By Air • At Flughafen Zürich (Zurich Airport, ZRH) Via Baden take the train at the SBB railway station • Follow the signs to «Koblenz». to Brugg AG. • After «Siggenthal Station» there are two • Get off in Brugg and take the bus roundabouts. At the second roundabout turn (see “By Rail”). left to PSI East area. Travel time approx. 75 minutes. • To reach the PSI West area, cross over the river Aare. GPS Coordinates N 47° 32.317‘ E 008° 13.808‘ Inauguration of the from Koblenz / Waldshut (DE) Contact: Tegerfelden XIL-II beamline Böttstein Edith Meisel PSI East / psi forum PSI West PSI N Tel. +41 (0)56 310 28 14 AARE Würenlingen 5 km E-mail: [email protected] Villigen Stilli Siggenthal Station November 5, 2010 Remigen Lauffohr Untersiggenthal 14:00 – 17:00 LIMMAT Turgi Obersiggenthal PSI West, WBGB/019 Brugg Ennetbaden Windisch Baden AARE Wettingen Hausen b. Brugg Baden West Exit REUSS A3 from Basel Baregg Wettingen Paul Scherrer Institut A3 A1 Exit Neuenhof 5232 Villigen PSI, Switzerland Brugg Exit Exit A1 A1 from Zurich Tel. -
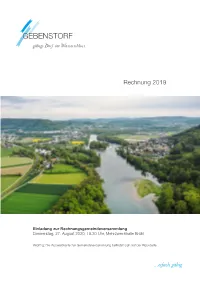
2020-08-27.Pdf
GEBENSTORF gäbigs Dorf im Wasserschloss Rechnung 2019 Einladung zur Rechnungsgemeindeversammlung Donnerstag, 27. August 2020, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Brühl Wichtig: Die Ausweiskarte zur Gemeindeversammlung befindet sich auf der Rückseite. ...eifach gäbig Inhaltsverzeichnis » Traktandenliste 3 » Editorial Gemeindeammann Fabian Keller 5 » Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 6 » Geschäftsbericht 2019 7 » Gemeinderechnungen 2019 8 » Kreditantrag von Fr. 550’000 für die technische Umrüstung der öffentlichen Strassenbeleuchtung 14 » Gemeindevertrag über den Regionalen Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz der Gemeinden Baden, Birmenstorf, Ehrendingen, Ennetbaden, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal und Würenlingen 16 » Kreditabrechnungen 21 a) Sanierung gemeindeeigenes Teilstück der Staldenstrasse 21 b) Sanierung Sandstrasse 21 c) Projektierung Pausenareal Brühl 21 » Verschiedenes, Termine und Umfrage 22 » Allgemeine Rechte der Stimmbürger 23 Einladung zur Rechnungsgemeindeversammlung am Donnerstag, 27. August 2020, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Brühl Werte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Wir freuen uns, Sie zur Rechnungsgemeindeversammlung einzuladen. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen im Voraus bestens. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgende Traktanden und Anträge 1. Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 Fabian Keller 2. Geschäftsbericht 2019 Fabian Keller 3. Gemeinderechnungen 2019 Fabian Keller 4. Kreditantrag von Fr. 550’000 für die technische -

Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios
Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios Author: Flurin Weber Supervisor: Alexander Genser Co-Supervisor: Dr. Mehdi Keyvan-Ekbatani (University of Canterbury, New Zealand) Professor: Dr. Anastasios Kouvelas Master Thesis January 2020 Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios January 2020 Acknowledgements I would like to extend my deepest gratitude to my supervisors Alexander Genser and Dr. Anastasios Kouvelas from ETH Zürich. Without your knowledge, support and advice, be it via e-mail, Skype, or in personal conversation, I would not have been able to complete this thesis. Furthermore, my thanks go to my co-supervisor Mehdi Keyvan-Ekbatani from University of Canterbury (New Zealand), who took the time for regular skype meetings and supported me via e-mail. I could absolutely benefit from your knowledge of perimeter control. I also would like to thank Richard de Witt and Franziska Baumgartner from the Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) of Kanton Aargau for the meetings and interesting inputs from a more practical point of view, as well as for providing the access to the traffic management computers. Also, my thanks are extended to Manuel Kalt, who gave me valuable inputs about different kinds of signal control logic. i Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios January 2020 Master Thesis, handed in on 27th of January 2020 Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios Flurin Weber IVT ETH Zurich Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland Phone: +41 79 684 48 24 E-Mail: [email protected] Abstract Nowadays, congestion in urban networks is abundant. -

2020-47 Rundschau Nord G.Pdf
AZ 5200 Brugg •Nr. 47 –19. November 2020 Aktuelles lesen Sie auch im Das Amtsblatt der Gemeinden Birmenstorf, Ehrendingen, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal Die Regionalzeitung fürEndingen, Lengnau, Schneisingen, Tegerfelden, Würenlingen (Ausgabe Nord) viel mehr als Druck. Aargovia TAXI DIESEWOCHE Rollstuhltaxi PÄCHTER AlessioGretz feierteam 056 288 22 22 Wochenende dieWiedereröffnung desRestaurantsWeisser Wind – Gerne jederzeit für Sie da! Seite13 111731 RSP miteiner PriseWallis. PÄDAGOGIN Im Teatro vonMirca ("!0&-&$++&$-/,! "%$#!%&' *#-$&.. ,$' )&.,$'%&#- DallaPiazzainSchneisingen lernen Kinder,übersichselbst hinauszuwachsen. Seite14 POWER PROGRAMM&INFO: Ab 1. Januar gelten für Töff-Einsteiger neueVorschriften. WWW.FIT4LIFE.CH 111935 RSN Dassorgt füreinen Boombei MÜDE UND schweren Motorrädern. Seite15 ENERGIELOS? 112676B RSP MITTEILUNGEN AUS DENGEMEINDEN ab Seite16 www.wohndoktor.ch | Tel. 056 200 93 00 ZITAT DERWOCHE «Ich behandle dieKinderimmer gleich wiedie 112639 RSK Erwachsenen.» 24/7 35 SERVICE38 05 0564 DerKinderanwalt GiuseppeDell'Olivo EinAbschiedmit starkemFrust vertritt Kinder vorGericht. Seite9 RUNDSCHAUNORD Vorder Versammlung der Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi seine Tätigkeiten ein. IhreBegründung: Der Präsident der Effingermedien AG IVerlag Ablauf quittiert eine weiteretreue Helferin ihren Dienst:Leny Killer Kirchenpflege habe mehrereMöglichkeiten nicht genutzt, Bahnhofplatz 11 ·5201 Brugg Telefon 056 460 77 88 (Inserate) hat nach 23 Dienstjahren ihreKündigung als Sakristanin der die Infrastrukturder -

Freiwilligen-Fahrdienst 056 511 23 47
www.mia-obersiggenthal.ch Freiwilligen-Fahrdienst Fahrzeiten Fahrtenbestellung 07.30 bis 18.00 Uhr jeweils von Die Fahrtenbestellung muss Suchen Sie eine Fahrgelegenheit Montag bis Freitag (ohne allgemeine Feiertage). mindestens 1 Tag für den Einkauf? Möchten Sie gerne vor der geplanten Fahrt erfolgen. einen Besuch machen? Kosten Benötigen Sie Unterstützung, um zu Die Fahrpreise sind nach Zonen eingeteilt Fahrtenbestellungen können aus Ihrem Hausarzt oder ins Spital zu gemäss Angaben auf der Rückseite. organisatorischen Gründen nur kommen? telefonisch erfolgen. Fahrer Die Koordinationsstelle MiA nimmt Freiwillige, geschulte Fahrerinnen und diese gerne entgegen unter: Für die Gemeinde Obersiggenthal wird Fahrer holen Sie zu Hause ab und bringen seit November 2013 ein Freiwilligen- Sie wieder zurück. Fahrgäste und Fahrer 056 511 23 47 Fahrdienst angeboten. sind durch den Verein versichert. Die primäre Zielgruppe sind Senioren über 60 Jahre aus Obersiggenthal. Trägerschaft Montag-Freitag jeweils Dieses Angebot gilt auch für jüngere, Der Freiwilligen-Fahrdienst ist ein Angebot 09:00 - 11:00 und 14:00 - 17:00 Uhr. mobilitätseingeschränkte Personen aus des Vereins MiA Obersiggenthal und wird unserer Gemeinde. von der Gemeinde unterstützt. Weitere Informationen: Rollstühle können nicht transportiert Der Fahrgast ist verpflichtet, dem Verein www.mia-obersiggenthal.ch werden. als Mitglied beizutreten. Der Mitglieder- Kinder unter 12 Jahren in Begleitung beitrag beträgt pro Kalenderjahr Fr. 20.00 [email protected] Erwachsener fahren gratis. Der Fahrgast für Einzelmitglieder, bzw. Fr. 30.00 für muss den Kindersitz selber bereit stellen. Ehepaare. Mobil im Alter Obersiggenthal 5416 Kirchdorf AG Aargauische Kantonalbank Aarau IBAN CH65 0076 1504 4562 3200 1 I Döttingen Fahrpreise und Zonenplan • Endingen • • Zone 1 Würenlingen Fr. -

Grafik 15.00 Parteistärke in %
Gemeinde: Würenlos Bezirk: Baden Kanton Aargau Analyse der Resultate Erneuerungswahl von 30 Mitgliedern des Grossen Rates Sonntag, 27. Februar 2005 45.00 2001 40.00 2005 35.00 30.00 25.00 20.00 Grafik 15.00 Parteistärke in % 10.00 5.00 - SVP FDP SP CVP EVP GPS SD AP Resultate im Detail: Liste Stimmenzahlen *) in Prozenten +/- 2001 2005 Bezeichnung 2001 2005 2001 2005 01 01 SVP 574 11'628 39.20 32.92 -6.28 03 02 FDP 250 5'570 17.10 15.77 -1.33 02 03 SP 187 5'409 12.80 15.31 2.51 04a+b 04 CVP 324 9'118 22.10 25.82 3.72 06 05 EVP 55 1'811 3.80 5.13 1.33 07 06 GPS 47 1'475 3.20 4.18 0.98 08 08 SD 9 221 0.60 0.63 0.03 05 14 AP 19 87 1.30 0.25 -1.05 Total 35'319 100.00 *) 2001 gemäss Listenstimmenproporz / 2005 gemäss Kandidatenstimmenproporz Seite 1 von 3 Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005 Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Baden nach Listen (aufsteigend). Seite drucken Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt 01 1 Killer Hans, Untersiggenthal 9'230 Ja 01 2 Moser Ernst, Würenlos 8'043 Ja 01 4 Frunz Eugen, Obersiggenthal-Nussbaumen 7'883 Ja 01 3 Markwalder Walter, Würenlos 7'629 Ja 01 7 Morach Annerose, Obersiggenthal-Kirchdorf 7'445 Ja 01 6 Bodmer Thomas, Wettingen 7'381 Ja 01 5 Kohler Ulrich, Baden 7'361 Ja 01 9 Schoch Adrian, Fislisbach 7'235 Ja 01 10 Schenkel Fabian, Bergdietikon 7'129 Nein 01 8 Ungricht Gusti, Bergdietikon-Kindhausen 7'088 Nein 01 12 Pfyl Daniel, Mägenwil 7'074 Nein 01 11 Frautschi Daniel, Würenlos 6'937 Nein 01 17 Keller Martin, Baden 6'805 Nein 01 18 Benz Pius, Wettingen 6'705 Nein -

07 Fusion Bevölkerungsschutz Der Regionen Baden Und Wasserschloss
Gemeinde Obersiggenthal Gemeinderat Nussbaumen, 6. Juni 2020 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat GK 2020 / 13 Fusion Bevölkerungsschutz und Zivilschutz der Regionen Baden und Wasserschloss per 1. Januar 2021, Genehmigung eines Gemeindever- trags Das Wichtigste in Kürze Der Regierungsrat schreibt die Zusammenlegung von Bevölkerungsschutzorganisatio- nen vor. Der Bevölkerungsschutz in den Regionen Baden und Wasserschloss soll ab 1.1.2021 in einer einzigen grossen Organisation zusammengefasst werden. Es geht um die Bildung einer neuen Zivilschutzorganisation ZSO und eines Regionalen Führungsor- ganes RFO. Die Regionen Baden und Wasserschloss sind bisher getrennt organisiert. Bereits heute werden in gewissen Bereichen Synergien genutzt. Für die Umsetzung muss ein Gemein- devertrag unterzeichnet werden. Der Gemeindevertrag wurde von den Gemeinderäten resp. dem Stadtrat der Ge- meinden Baden, Birmenstorf, Ennetbaden, Ehrendingen, Freienwil, Gebenstorf, Ober- siggenthal, Turgi, Untersiggenthal und Würenlingen geprüft. Sie beantragen jeweils die Genehmigung durch die Gemeindeversammlung resp. den Einwohnerrat. Der Gemeindevertrag wurde dem zuständigen Kantonalen Departement zur Vorprü- fung vorgelegt. Antrag Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: Der Gemeindevertrag zur Bildung einer Bevölkerungsschutzregion Baden sei zu genehmigen. Fusion Bevölkerungsschutz Baden mit Wasserschloss Seite 2 von 7 Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung