Masaryk Universität
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download/LN 03 09 Kpl A4.Pdf
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Exilliteratur in der Gegenwart. Das literarische Schaffen bosnischer und polnischer Autoren im Exil.“ Verfasserin Enisa Baraković angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2009\ Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuerin ODER Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Michael Rohrwasser Meinen Eltern in Liebe und Dankbarkeit gewidmet 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .............................................................................................................................. 4 2. Theoretische Ausgangspunkte............................................................................................. 10 2.1. Begriff Exil.................................................................................................................. 10 2.1.1. Exil im Ersten Weltkrieg..................................................................................... 12 2.1.2. Exil im Zweiten Weltkrieg.................................................................................. 13 3. Migration............................................................................................................................. 18 3.1. Historischer Überblick (Geschichte der Migration).................................................... 19 3.2. Problematik der Komparatistik und Uneinigkeiten über die Literatur im Zeitraum 1960-2000 .............................................................................................................................. -
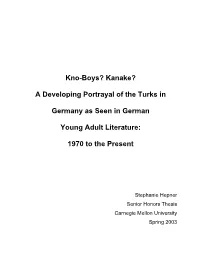
Table of Contents
Kno-Boys? Kanake? A Developing Portrayal of the Turks in Germany as Seen in German Young Adult Literature: 1970 to the Present Stephanie Hepner Senior Honors Thesis Carnegie Mellon University Spring 2003 Table of Contents Abstract p. 1 Introduction p. 2 History p. 5 1970s: Individual Quest, Idealistic Stories, Black and White Differences p. 14 1980s: Groups Acting for Change, Integration is Germans’ Problem, Explanation of Cultural Differences, Problems of the Second Generation p. 24 1990s: Second Generation Search for Identity, Strong German-Turkish Friendships, Generational Issue p. 42 Broad Themes: The Language Barrier, the Portrayal of Muslim Culture, the Reality of the Housing Problem p. 54 Conclusion p. 66 Appendix: Summary of Books p. 67 Fips schafft sie alle p. 67 Ülkü das fremde Mädchen p. 69 Wir sind doch nicht vom Mond! p. 71 Heisst du wirklich Hasan Schmidt? p. 73 Hamide spielt Hamide p. 75 Die Kopftuchklasse p. 77 “Die Todesengel” and “Ein Himmel voller Luftballons” p. 79 Kümmel und Karotte p. 82 Fünf Gummibärchen für den Notfall p. 84 Die Sonnentrinker p. 85 Works Cited p. 86 Endnotes p. 87 1 Abstract For my senior honors thesis, I am investigating how the Turkish people are portrayed in German children’s and young adult literature from the past three decades. As the largest single minority population in Germany, which is culturally very different from German, the Turks have faced many legal and social struggles, trying to adapt to living and working in German society while preserving their culture and heritage. Because many Turks in Germany do menial labor and they and their children often obtain the minimum required education, they have been discriminated against by the Germans. -

Zwischen Integration Und Dissoziation: Türkische Medienkultur in Deutschland
Jörg Becker Zwischen Integration und Dissoziation: Türkische Medienkultur in Deutschland I. Einleitung 1946 formulierte Antoine de Saint-Exupéry in seinem Buch “Der Kleine Prinz” folgende Passage: “Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, daß der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B 612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Er hatte damals beim internationalen Astrono- menkongreß einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Aber niemand hatte ihm geglaubt, und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen. Die großen Leute sind so. Zum Glück für den Ruf des Planeten B 612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk bei Todesstrafe, nur noch europäische Kleider zu tragen. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahr 1920 in einem sehr eleganten Anzug. Und diesmal gaben sie ihm alle recht.”1 In einem Essay über türkische Medienkultur in Deutschland sind diese Sätze Saint-Exupérys in mehrfacher Hinsicht ein nahezu idealer Ausgangspunkt, um die Vielfältigkeit verschiedener analytischer Dimensionen zu klären. Mit dem “türkischen Diktator” meinte der Schriftsteller den türkischen Staatspräsidenten Kemal Atatürk, der seinem Land in den zwanziger Jahren eine Modernisierungspolitik nach westeuropäischem Muster verordnet hatte. Die erste Dimension, die sich an diesem Zitat verdeutlichen läßt, ist die rigorose Medienzensur in der gegenwärtigen Türkei. Denn wegen Staatsbeleidigung ist “Der Kleine Prinz” in der Türkei ein nach wie vor verbotenes Buch. Auf eine zweite Dimension dieses Zitates macht der deutsch-türkische Autor Kemal Kurt aufmerksam. In seiner historisch angelegten Analyse von deutschen Vorurteilen gegenüber Türken argumentiert er anhand des Zitates von Saint-Exupéry, daß den Türken ihre neue Kleidung nichts genutzt habe. -

Karin Yeşilada: Publikationen
Dr. phil. Karin Yeşilada Stand: April 2021 Schriftenverzeichnis Monografien: 1. Poesie der Dritten Sprache. Türkisch-deutsche Lyrik der zweiten Generation. Literaturwissenschaftliche Dissertation. Tübingen (Stauffenburg) 2012. 2. Feridun Zaimoglu. Studienband. Hrsg. zus. m. Tom Cheesman. Zürich, Wien u.a. (Peter Lang) 2012. 3. Zafer Şenocak. Hrsg. zus. m. Tom Cheesman. (Cardiff, University of Wales Press) 2003. (Series: Contemporary German Writers). in Vorbereitung: 4. Kulturgeschichte der türkischen Einwanderung. Hrsg. Zusammen mit Michael Hofmann. In Zus.arb. mit Tobias Zenker et al. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2022. Aufsätze und Artikel: im Druck/ Manuskript eingereicht: Die Sprachen immer dabei. Interview mit Maike Bouassida. Festschrift für Maike Bouassida, Revue Tunisienne des Langues Vivantes, hg. v. Sayadi, Abderrazak et al., erscheint 2021. Erschienen: 28. Martin Luthers Türkenschriften – Hasspredigten oder Diskurse ihrer Zeit? Revue Tunisienne des Langues Vivantes, numèro special 2017, hg. v. Ouanes, Hedi / Ferchichi, Hedi / Bouassida, Maike. Tunis 2020, S. 241-265. 27. Feridun Zaimoǧlu. In: Dawidowski, Christian (Hrsg.): Popliteratur der 1990er und 2000er Jahre. (KLG Extrakt). München (edition text + kritik) 2019, S. 122-140. 26. Dig, dig, digger – oder die Ästhetik der Einwanderung. Ein komparatistischer Blick auf Peter Weiss, Fatih Akın und Gene Kelly. In: Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. 12/1, 2018, S. 71-98. (überarb. v. [23]) 25. Islam in der (interkulturellen) Kinder- und Jugendliteratur. In: kjl&m (Kinder- /Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek) 17.4 Luther & Co. – Religion(en) in der Kinder- und Jugendliteratur, 69. Jg., 4. Vj. 2017, S. 19-26. 24. Sufismus – ein neuer Islam-Diskurs? Lektüren deutschsprachiger Gegenwartsautoren. In: Alexandre, Philipe (Hrsg.): Orients et orientalisme dans la culture des pays de langue allemande au XXe siècle. -

Updated Checklist of Harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Turkey
Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (4), 1617-1631, 2014 DOI:10.2298/ABS1404617K UPDATED CHECKLIST OF HARVESTMEN (ARACHNIDA: OPILIONES) IN TURKEY KEMAL KURT* Gümüşhane University, Şiran Vocational High School, TR-29700, Gümüşhane, Turkey E-mail: [email protected] Abstract - In this work, faunistic studies on harvestmen from Turkey are reviewed. A total of 88 species and 7 subspecies from 35 genera belonging to 7 families were determined. The distribution in Turkey and the world of these taxa is given and their distribution in the geographical regions of Turkey are presented. Key words: Opiliones; Harvestmen; checklist; Turkey INTRODUCTION and Bayram, 2007; Yigit et al., 2007; Çorak et al., 2008; Kurt, 2005, 2013; Kurt and Erman, 2011, 2012; To date, 6 534 species if harvestmen, the third larg- Kurt et al., 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2013; Bayram est order in Arachnida after mites and spiders, have et al., 2007, 2010). been recorded worldwide of which 310 in Europe and 801 in the Palearctic region (Mitov, 2007; Kury, The first checklist of Turkish harvestmen fauna 2012, 2013). was prepared by Dr. Abdullah Bayram and co-work- ers. In this study, 50 species and 25 genera belonging The first data about on Turkish harvestmen were to 6 families were recorded (Bayram et al., 2010). In provide by non-Turkish scientists, such as Simon 2010, Kurt et al. (2010) made additions to this check- (1875, 1878, 1879, 1884), Pavesi (1876), Kulczyński list and reported 61 species, 3 subspecies and 33 gen- (1903), Nosek (1905), Roewer (1912, 1923, 1950, era belonging to 7 families from Turkey. -

Die Neue Türkei
Jörg Becker Die deutsch-türkische Medienrevolution: Weitere sieben Meilensteine Der in Deutschland gegenwärtig geführte wissenschaftliche Diskurs über deutsch-türkische, türkische, türkischsprachige, islamische und/oder Migrantenmedien ist im Vergleich zu ausländischen Diskursen recht provinziell, ist oft eigentlich ein oberflächlich-politisierter Diskurs (und damit der Wissenschaft nur schwer zugänglich), wird oft ohne wissenschaftliche Fach- und Sachkenntnis geführt, hantiert mit einem Integrationsbegriff und -konzept, der weder in der Realität noch in der sozialwissenschaftlich Theorie haltbar ist und lässt türkischsprachige Wissenschaftler aus diesem Diskurs völlig außen vor. (Diese Exklusion ist erstens kolonialistisch und stellt zweitens die Validität deutscher Arbeiten über türkische Medien in Frage.) Es war ein Ethnologe (nicht etwa ein Politik- oder Kommunikationswissenschaftler), nämlich Werner Schiffauer, der im Sommer 2002 einen wegweisenden Aufsatz über den Islam und die Medienrevolution veröffentlichte. Seine Thesen lassen sich zu folgender Aussage verdichten: Es sind die Medien (TV, Kassetten, Satelliten und digitale Medien), die den Islam säkularisieren und modernisieren. Der Einheitsgedanke im Islam (ein Gott, eine Gemeinde, eine offenbarte Schrift) weicht der Dynamik immer heterogener werdender Medienbotschaften. In den achtziger Jahren führte das in der gesamten islamischen Welt zu einem Abebben gewaltförmiger Politik, verschiedenartige Konzeptualisierungen sowohl von Moderne als auch von Islam wurden öffentlich sichtbar -

Turkish-German Representations of Berlin by Ela Eylem Gezen a Dissertation Submitted in Partial F
Writing and Sounding the City: Turkish-German Representations of Berlin by Ela Eylem Gezen A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Germanic Languages and Literatures) in The University of Michigan 2012 Doctoral Committee: Associate Professor Vanessa Agnew, Co-Chair Associate Professor Kader Konuk, Co-Chair Associate Professor Kerstin Barndt Associate Professor Mark Clague Associate Professor Johannes von Moltke © Ela E. Gezen 2012 Anneme ve Babama ii Acknowledgements Writing this dissertation has been a long journey, which I could not have embarked on and endured without the support of many people and institutions. First I would like to thank my “Doktormütter” Kader Konuk and Vanessa Agnew. Their support, academic and emotional, has been unconditional, invaluable and indispensible. I tremendously benefited from and always admired their ability to identify points at which I needed a push in the right direction—to dig deeper, and to think bigger and further. I could not have done it without them. I am grateful to my committee members. Kerstin Barndt provided encouragement, and advice from the earliest stages to the very end. She has helped me out of dead ends when most needed. Johannes von Moltke was always available to discuss my ideas and work. The clarity and poignancy of his feedback never ceases to impress me. Mark Clague provided encouragement and guidance in listening to and discussing music together, which was greatly appreciated and integral to my analysis. My colleagues and friends at the University of Michigan have helped me to feel at home in Ann Arbor emotionally as well as intellectually. -
Scope: Munis Entomology & Zoology Publishes a Wide Variety of Papers
_____________ Mun. Ent. Zool. Vol. 3, No. 2, June 2008___________ I MUNIS ENTOMOLOGY & ZOOLOGY Ankara / Turkey II _____________ Mun. Ent. Zool. Vol. 3, No. 2, June 2008___________ Scope: Munis Entomology & Zoology publishes a wide variety of papers on all aspects of Entomology and Zoology from all of the world, including mainly studies on systematics, taxonomy, nomenclature, fauna, biogeography, biodiversity, ecology, morphology, behavior, conservation, paleobiology and other aspects are appropriate topics for papers submitted to Munis Entomology & Zoology. Submission of Manuscripts: Works published or under consideration elsewhere (including on the internet) will not be accepted. At first submission, one double spaced hard copy (text and tables) with figures (may not be original) must be sent to the Editors, Dr. Hüseyin Özdikmen for publication in MEZ. All manuscripts should be submitted as Word file or PDF file in an e-mail attachment. If electronic submission is not possible due to limitations of electronic space at the sending or receiving ends, unavailability of e-mail, etc., we will accept “hard” versions, in triplicate, accompanied by an electronic version stored in a floppy disk, a CD-ROM. Review Process: When submitting manuscripts, all authors provides the name, of at least three qualified experts (they also provide their address, subject fields and e-mails). Then, the editors send to experts to review the papers. The review process should normally be completed within 45-60 days. After reviewing papers by reviwers: Rejected papers are discarded. For accepted papers, authors are asked to modify their papers according to suggestions of the reviewers and editors. Final versions of manuscripts and figures are needed in a digital format. -
Basin Almanak Press Almanac
BASIN ALMANAK PRESS’18 ALMANAC içindekiler contents 006-025 026-041 042-061 062-079 080-099 100-115 Ocak/January Şubat/February Mart/March Nisan/April Mayıs/May Haziran/June 116-131 132-141 142-159 160-177 178-191 192-203 Temmuz/July Ağustos/August Eylül/September Ekim/October Kasım/November Aralık/December 204 209 Medyada Otosansür Game Over Ülkesiyiz Game Over We’re a country in the media of self-censorship Ertuğrul Mavioğlu Güventürk Görgülü GÖZÜ KÖROLMAYASICALAR / WITH THANKS TO Aliye Gümüş, Alp Tekin Babaç, Candan Yıldız, Dilek Şen, Faruk Eren, Hasan Uludağ, Murat İnceoğlu, Murat Kaspar, Nazan Özcan, Nesil Altaca, Selin Kalkan, Stefan Martens, Süleyman Felamur, Şener Uluer, Zuhal Akpınar “Bu Almanak Avrupa Birligi Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla DİSK BASIN İŞ aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” 004 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC l 005 Sadece gazeteciler değil, muhalif öğrenciler, aydınlar, bilim insanları, siyasetçiler, avukatlar ya cezaevlerinde ya da yargılanıyor. Geçen yıl bir ilk yaşandı. Üçüncü havalimanı inşaatında dayanılmaz koşullara karşı çıkan işçiler, iş cinayetlerine karşı çıkan işçiler tutuklandı. İktidarın hoşlanmadığı yayın organlarını And it’s not just journalists; opposition- basan matbaaya el konuldu. Matbaa işçileri de minded students, intellectuals, scientists, tutuklandı! politicians and lawyers are either in jail or on Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik davalar the stand. Some firsts also took place last year: sessiz sedasız sonuçlanıyor. Özellikle gazetecilere Authorities arrested laborers who resisted ve barış bildirisine imza atan akademisyenlere against the inhuman working conditions at yönelik art arda hapis cezaları veriliyor. -
Die Integrationsfunktion Türkischer Ethnomedien in Deutschland
Die Integrationsfunktion türkischer Ethnomedien in Deutschland Eine qualitative Untersuchung aus der Sicht von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund in Hamburg DISSERTATION Zur Erlangung des Grades der Doktorin/des Doktors der Philosophie bei der Fakultät für Geisteswissenschaften Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien & Europäische Sprachen und Literaturen der Universität Hamburg vorgelegt von Eylem Şentürk aus Hamburg Hamburg im März 2012 Erstgutachter: Prof. Dr. Uwe Hasebrink Zweitgutachter: Prof. Dr. Catharina Dufft Der Tag der mündlichen Prüfung: 15.05.2012 i Inhaltsverzeichnis Danksagung ........................................................................................................... iv Einleitung ............................................................................................................... 1 1 Integration durch Medien ................................................................................ 7 1.1 Integration .................................................................................................... 7 1.1.1 Soziale Integration .............................................................................. 9 1.1.2 Mediale Integration .......................................................................... 10 1.2 Interkulturelle mediale Integration ............................................................ 11 1.2.1 Medienproduktion: Teilhabechancen für türkische Migranten ........ 12 1.2.2 Medieninhalte: Darstellung türkischer Migranten in deutschen Medien ............................................................................................. -

Info Daf · Heft 4 · August 2000
Herausgegeben vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsch als Fremdsprache Nr. 4 27. Jahrgang August 2000 Inhalt Artikel Siegfried Gehrmann Lerntheoretische Defizite der Zweitsprachenerwerbsforschung am Beispiel der Phonetik 337 Susanne Günthner Grammatik der gesprochenen Sprache – eine Herausforderung für Deutsch als Fremdsprache? 352 Didaktik DaF / Tamás Kispál Aus der Praxis Sprichwörter in einem phraseologischen Wörterbuch 367 Heidi Rösch Migrationsliteratur im DaF-Unterricht 376 Margarete Ott Textanalyse als individualisierendes Verfahren zur Optimierung schriftsprachlicher Kompetenzen in der Fremdsprache 393 Gabriele Thelen-von Damnitz Internetgestützter DaF-Unterricht ganz anders 407 Jörg Braunert Grammatik in berufssprachlichen Lehrwerken oder: Kann der DaF-Anfänger berufssprachlich einsteigen? 414 Malte Jaspersen Radio-Magazin ›Nipponia Nippon‹. Entwicklung kommunikati- ver Fähigkeiten im Deutschunterricht. Ein Beispiel 428 Peter Hohenhaus Zur Verwendung humoristischen Materials im DaF-Unterricht 433 (Fortsetzung umseitig) 336 Berichte Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht in neuem Gewand – und mit gesenktem Preis! 449 20. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenun- terrichts: Resolution zur Fremdsprachenausbildung an Universi- täten 449 Germanistik im anglophonen Westafrika. Bericht vom 4. Kon- greß der NATOG (Nigerian Association of Teachers of German) (Michael Aulbach, Dakar) 450 Internationale Lexikographiekonferenz vom 30. März bis 1. April 2000 an der Universität -
Berlin Kinderliterarisch. Neue Kinder- Und Jugendbücher Aus Und Über Berlin 1999 - 2004
Berlin kinderliterarisch. Neue Kinder- und Jugendbücher aus und über Berlin 1999 - 2004. Nach dem Fall der Mauer und rechtzeitig zum Kongress des International Board On Books For Young People (IBBY) in Berlin 1992 wurde die erste annotierte Bibliografie mit 316 Titeln für ganz Berlin aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur für die Zeit von 1790 bis 1991 zusammengestellt. Initiiert war sie von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der GEW (AJuM) Berlin und wir freuten uns damals, mit Claudia Rouvel vom Kinderbuchverlag eine Ostberlinerin zur Zusammenarbeit zu gewinnen. Die Broschüre erhielt eine Einleitung von Klaus Kordon (1) . Wolters, Rouvel, Eska: Emil – Alfons - Lady Punk – Berlin als Schauplatz in der Kinder- und Jugendliteratur. Statt eines Vorwortes: Klaus Kordon, Wurzeln. Berlin: Pädagogisches Zentrum Berlin 1992. PZ 92-05-0016 (2) Für diese Sammlung wurden verwendet und auch genannt u.a. die Bibliografien, die zur 750-Jahrfeier 1986 in beiden Stadthälften erstellt worden waren, eine Auflistung des Kinderbuchladens Kreuzberg „Haste mal’n Buch, ey?“ ebenso wie die Bibliografien von Wegehaupt, Heinz: Alte deutsche Kinderbücher, 1985 und Kunze/Wegehaupt: Spiegel proletarischer Kinder- und Jugendliteratur 1870-1936, 1985. Sämtliche Materialien gingen nach der Fertigstellung an die Gemeinschaft als Grundstock für eine aufzubauende Berlin-Bücherei für Kinder und Jugendliche im Haus in der Weinmeisterstraße 5. Inzwischen soll der Bestand auf ca. 400 Titel angewachsen sein. Ein Zugang übers Internet an diesen Bestand ist leider – noch (?) – nicht möglich. Auch die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) hat einen guten Bestand von Berlinbüchern auch für Jugendliche, der wie alle Berliner Stadtbibliotheken über www.vöbb.de erschlossen werden kann. Der Katalog „Det verwächst sich...? Kiezkindheit und Großstadtjugend in literarischen Texten mit Schauplatz Berlin (Kinder- und Jugendbücher 1949 – 1999).