Das Obere Stooberbachtal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Natur & Umwelt
29. Jahrgang • Ausgabe 2 / 2019 • Sommer NATUR & UMWELT im Pannonischen Raum RÜCKBLICK Das war der Aktionstag NATURSCHUTZBUND Schöpfung 2019 Projekt Beratung für Gemeinden im Finale BUCHPROJEKT Iwa Schmolztipfla, Gansbärn und Plitzerlwerfa ALLES WIESE Vom Nutzen einer frühen UMFRAGE Mahd Ergebnis bestätigt Entscheidung für Biowende Unser Klima im Wandel Klimavision 2050 in Ausarbeitung ... auch radeln hilft dem Klima In dieser Ausgabe: Editorial Hianzenverein Jessie Ann singt 03 NB-Obm. Ernst Breitegger 27 und Buch über Ortsnecknamen Klimaschutz-Appell Diözese Eisenstadt 04 António Guterres, UNO-GS 28 Kirchliche Umweltarbeit KlimaschutzreferentInnen 07 05 Projektfinale Burgenländischer Forstverein trafen sich im Burgenland Naturschutz in Gemeinden 29 Unsere Wälder im Klimastress Energie- und Klimastrategie 30 Burgenländischer Müllverband 06 Gedanken von Johann Binder Tag der Nachhaltigkeit 2019 07 Konferenz im Burgenland WLV Nördliches Burgenland KlimaschutzreferentInnen 31 Mehr Grundwasserschutz nötig 08 Umfrage: Mehr Bio Esterhazy Biowende in 12 Punkten 32 Tausend Stunden Adler live 10 Klimavision Burgenland 2050 Burgenländische Naturparks Meilenstein in Ausarbeitung 33 Wert der Biodiversität 11 Burgenland radelt Biologische Station Startschuss für Klima-Aktion 34 WeCon: Feldsaison hat begonnen Aktionstag Schöpfung Nachhaltigkeitspreis 2019 12 Lebenswert Lebensmittel 36 Die Ausschreibung 32 Adlerhorst vor der Linse: ... weniger ist ein Muss! Burgenland Tourismus Tausend Stunden live 13 von Mag. Dr. Josef Fally 37 Willkommen im Fahrradies -

Arisierungsakten Des Nördlichen Burgenlandes (Landeshauptmannschaft Niederösterreich)
Arisierungsakten des nördlichen Burgenlandes (Landeshauptmannschaft Niederösterreich) Faszikel 1 16 Orley Olga Bruck a. d. Leitha F 1 34 Feigelstock Hugo u. Jolan Deutschkreutz F 1 34 a Feigelstock Gustav, Hugo u. Jolan Deutschkreutz F 1 37 Nemeth Maria Eisenstadt F 1 117 Mayer Karl Bruckneudorf F 1 Fould Anna; Lederer Valarie; Stutzer 202 Deutschkreutz F 1 Charlotte; Weiler Sigmund u. Stefanie Aufzeichnungen über die zum Abbruch 214 Deutschkreutz F 1 bestimmten Judenhäuser 218 Reiner Netti Sara Deutschkreutz F 1 238 Mandel Ernst Israel Sauerbrunn F 1 246 Eisenberg Isidor Deutschkreutz F 1 248 Entenberg Sigmund Neudörfl F 1 249 Engel Leopold Frauenkirchen F 1 250 Steindler Julius Eisenstadt F 1 252 Gerstl Josefine Sara Frauenkirchen F 1 253 Goldner Sigmund, Gisela, Erich u. Rosa Deutschkreutz F 1 255 Grünwald Gabriel u. Giza Deutschkreutz F 1 257 Gerö Oskar Eisenstadt F 1 268 Hirschenhäuser Eugenie Mattersburg F 1 269 Hirsch Alfred Mattersburg F 1 272 Krauß Berta Deutschkreutz F 1 275 a Judenmöbel Oberpullendorf F 1 275 b Judenmöbel Frauenkirchen F 1 275 c Judenmöbel Sauerbrunn F 1 342 Hacker Isidor u. Maria Kobersdorf F 1 342 a Hacker Isidor u. Maria Kobersdorf F 1 342 c Hacker Maria Lindgraben F 1 Faszikel 2 417 Weiss Pratin Bruckneudorf F 2 433 Bruckner & Spiegel; Spiegel Emanuel Deutschkreutz F 2 439 Boskovits Hugo; Mayer Josef Nickelsdorf F 2 439 Boskovits Hugo Nickelsdorf F 2 445 Unger Karl Eisenstadt F 2 473 Rom Michael, Gustav u. Elisabeth Purbach F 2 489 Zinszahlungen an Hr. Fetter Frauenkirchen F 2 517 Hacker Ignatz Lackenbach F 2 517 a Hacker Ignatz Lackenbach F 2 517 b Hacker Ignatz Lackenbach F 2 523 Riegler Regina Kobersdorf F 2 527 Siegar Julius, Margarethe, Stefan u. -

Bibliotheks Entwicklungs Plan
BIBLIOTHEKS ENTWICKLUNGS FÜR DAS BURGENLAND PLAN 2021–2025 INHALTSVERZEICHNIS VORBEMERKUNG 4 VORWORT 5 Landeshauptmann Hans Peter Doskozil EINE BIBLIOTHEKSMILLION FÜR DAS BURGENLAND 6 Der Bibliotheksentwicklungsplan 2021-2025 auf einen Blick 1. EINLEITUNG UND AUSGANGSLAGE 10 2. DAS BURGENLÄNDISCHE BÜCHEREIWESEN: EINE ANALYSE 14 2.1 Wiederkehrendes aus der Geschichte 15 2.2 Befunde zur Gegenwart 16 2.2.1 Struktur 16 2.2.2 Versorgungsgrad 25 2.2.3 Finanzen 26 2.2.4 Personal 29 2.2.5 Image 32 2.2.6 Angebot 33 2.2.7 Nutzung 44 2.2.8 Kooperationen 46 2.2.9 Zielstandards und Förderrichtlinien des Bundes 49 2.2.10 Zusammenfassung 53 3. HANDLUNGSFELDER, MASSNAHMEN UND ZIELE 55 3.1 Der Bibliotheksentwicklungsplan 2021–2025 im Überblick 58 3.2 Der Bibliotheksentwicklungsplan 2021–2025 und seine Teilziele 61 3.2.1 Strukturen schaffen 61 3.2.2 Mitarbeiter*innen stärken 63 3.2.3 Bekannter werden 64 3.2.4 Infrastruktur und Leistungen ausbauen 64 3.2.5 Vernetzter sein 66 3.2.6 Fördern und fordern 68 4. AUF IN DIE ZUKUNFT! ENTWURF EINES LEITBILDES 69 5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 72 6. ANHANG 74 6.1 Abkürzungen und Begrifflichkeiten 75 6.2 Zeitplan 76 6.3 Quellenverzeichnis 76 6.4 Danksagung 77 IMPRESSUM 78 VORBEMERKUNG Der vorliegende „Bibliotheksentwicklungsplan für das Burgenland 2021–2025“ basiert auf der ausführlichen Grundlagenerhebung „Das burgenländische Büchereiwesen – Geschichte, Status Quo und ein Plan für die Zukunft“, die von einer Arbeitsgruppe des Landesverbandes Bibliotheken Burgenland (LVBB) zwischen April 2019 und Herbst 2020 gemacht worden ist. Es handelt sich dabei um eine umfassende und eingehende Auseinandersetzung mit vielen verschiedenen Aspekten des Büchereiwesens im Burgenland und bildet für die folgenden Ausführungen die fundierte Grundlage mit „Plädoyer“-Charakter. -

Bevölkerungsbeteiligung
Bevölkerungsbeteiligung Vorstand Obmann: BM Mag. Norbert DARABOS Obmann Stv.: LAbg. Bgm. Wilhelm HEIßENBERGER Schriftführer: Bgm. Ing. Paul PINIEL, Weppersdorf Kassier: Paul MAYERHOFER, Neckenmarkt Weitere Vorstandsmitglieder: LAbg. Bgm. Werner BRENNER Gemeinde Lockenhaus Elisabeth DORN, Oberpullendorf Frauen, Soziales Josef FUCHS, Hochstraß Landwirtschaft Dir. Gerhard GLÖCKL, Neutal Bildung Bgm. Franz HOSCHOPF Gemeinde Weingraben Ing. Anton IBY, Horitschon Landwirtschaft, Wein Herbert ROSENITSCH, Glashütten, Wirtschaft Bgm. Stefan ROZSENICH Gemeinde Großwarasdorf Dir. Mag. Helene SCHÜTZ-FATALIN, Bubend. Jugend Franz STIFTER, Steinberg-Dörfl Tourismus Strategieteam LAbg. Bgm. Werner BRENNER, Vorstand Elisabeth DORN, Vorstand Dir. Gerhard GLÖCKL, Vorstand LAbg. Bgm. Wilhelm HEIßENBERGER, Vorstand Ing. Anton IBY, Vorstand Paul MAYERHOFER, Vorstand Franz STIFTER, Vorstand WHR Mag. Georg SCHACHINGER, RMB Heidi DRUCKER, GFin und LAG Managerin Mitglieder Gemeinde Deutschkreutz Gemeinde Neutal Gemeinde Draßmarkt Gemeinde Niktisch Gemeinde Frankenau -Unterpullendorf Gemeinde Oberloisdorf Gemeinde Großwarasdorf Gemeinde Oberpullendorf Gemeinde Horitschon Gemeinde Pilgersdorf Gemeinde Kaisersdorf Gemeinde Piringsdorf Gemeinde Kobersdorf Gemeinde Rainding Gemeinde Lackenbach Gemeinde Ritzing Gemeinde Lackend orf Gemeinde Steinberg-Dörfl Gemeinde Lockenhaus Gemeinde Stoob Gemeinde Lutzmannsburg Gemeinde Unterfrauenhaid Gemeinde Mannersdorf a. d. Rabnitz Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben Gemeinde Markt St. Martin Gemeinde Weingraben Gemeinde Neckenmarkt -

Fahrplan Ab 25.09.2017
97 7990 Eisenstadt - Oberpullendorf - Oberwart - Jennersdorf www.suedburg.at Südburg Kraftwagen-Betriebs-GesmbH & Co KG, Steinamangerer Straße 142, 7400 Oberwart, Tel. 03352/38974 gültig ab: 25. September 2017 9701 8407 9703 9705 9707 9709 KURSNUMMER 9702 9704 9706 9708 8422 1 1 A A 8 9 Nr Km VERKEHRSBESCHRÄNKUNG A U A U 8 M 1 4 F10 13 05 16 05 1 0 ab Eisenstadt Technologiezentrum an 7 15 9 00 F10 13 10 16 10 2 0 ab Eisenstadt Hutweide an 7 20 9 05 13 25 16 25 18 10 18 15 3 0 ab Eisenstadt Domplatz an P 7 25 9 10 17 25 I I I I 4 0 ab Eistenstadt Bahnhof an 7 27 II 13 28 16 28 18 13 18 18 5 0 Eisenstadt Rotes Kreuz I I 17 23 13 29 16 29 18 14 18 19 6 0 Eisenstadt Merkur I I 17 22 I I 18 25 18 30 8 17 Mattersburg Martinsplatz I I I I I 18 35 18 40 11 29 Sieggraben III I I 18 38 18 43 12 33 Kalkgruben Mitte III I 18 40 18 45 14 35 Tschurndorf Mitte I I I 13 55 17 00 18 45 18 50 16 39 Weppersdorf Bäckerei Gradwohl I 8 44 16 58 13 58 17 03 18 48 18 53 17 42 Markt St Martin Gh Muschitz 6 41 8 41 16 55 14 00 17 05 18 50 18 55 20 44 Neutal Gemeindeamt 6 39 8 39 16 53 14 02 17 08 18 53 18 58 22 47 Stoob Gemeindeamt 6 36 8 36 16 50 6 00 6 30 14 05 17 10 18 58 19 03 26 51 Oberpullendorf Spitalstr 6 30 8 30 16 45 19 15 6 00 6 30 14 05 17 11 18 58 19 03 27 51 Oberpullendorf Kirche I I I IIIIII 28 51 Oberpullendorf Augasse/Bücherei 6 30 8 30 16 45 19 15 IIIIII 29 51 Oberpullendorf Augasse 41/26 6 30 8 30 16 44 19 14 IIIIII 30 51 Oberpullendorf Großfeldsdlg .Eisenst.Str. -

7941 Oberpullendorf - Klostermarienberg - Langental Betreiber: Blaguss Reisen Gmbh Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien Tel: 050655-1333
Wien - Mattersburg - Forchtenstein - 7941 Oberpullendorf - Klostermarienberg - Langental Betreiber: Blaguss Reisen GmbH Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien Tel: 050655-1333. Alle Angaben ohne Gewähr Montag - Freitag (Werktag) Kursnummer 4 8 12 14 52 54 60 60 56 62 68 70 74 74 114 76 78 80 82 Verkehrshinweis 32 31ha 31ho 32 32CG 32 31 32 31 1 Wien Hauptbahnhof (L1) 9.10 12.15 12.15 12.15 12.45 13.15 13.25 13.45 14.45 15.00 15.40 16.00 16.15 2 - Matzleinsdorfer Platz 9.15 12.20 12.20 12.20 12.50 13.20 13.32 13.50 14.50 15.05 15.45 16.05 16.20 3 - Spinnerin am Kreuz 9.18 12.23 12.23 12.23 12.53 13.23 13.34 13.53 14.53 15.08 15.48 16.08 16.23 4 - Triester Str./Computerstr. 9.20 12.25 12.25 12.25 12.55 13.25 13.35 13.55 14.55 15.10 15.50 16.10 16.25 16 Wiener Neustadt IZ/Fa. Triumph 9.50 12.56 12.56 12.56 13.55 15.55 15.55 20 - Ungargasse/Corvinusring 10.05 11.10 12.10 13.10 13.10 13.10 14.10 16.05 16.05 16.30 24 Neudörfl Abzw. Pöttsching 10.09 11.14 12.14 13.14 13.14 13.14 14.14 14.15 16.09 16.09 16.34 16.49 29 Bad Sauerbrunn Abzw.Pöttsching 10.15 11.20 13.20 13.20 13.20 14.20 14.21 16.15 16.15 16.40 16.55 31 - Römersee 10.17 11.22 13.22 13.22 13.22 14.22 14.23 16.17 16.17 16.42 16.57 32 Wiesen-Sigleß Bahnhof 10.20 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 16.20 16.20 16.45 17.00 36 Pöttsching Rathaus/Hauptstraße 12.21 38 Sigleß Ortsmitte 11.28 40 Krensdorf Gemeindeamt 11.32 12.27 41 Kleinfrauenhaid Friedhof 11.35 12.30 43 Hirm Hauptplatz/Kirche 11.38 12.33 44 Antau Kleine Zeile 11.43 12.38 46 Stöttera Feuerwehr 11.46 12.41 48 Zemendorf Wr.-Neustädter-Str. -

Ortspöst Wir Neutaler
WIR NEUTALER www.neutal.spoe.at ORTSPÖST Ein Service der SPÖ Neutal - Ausgabe 3/2019 IAC Konzern-Chef Manfred Gingl zu der beabsichtigten Betriebsansiedlung in Neutal: "Neues Tal für neue Produkte" mehr auf Seiten 2 und 3 IMPRESSUM Herausgeber: SPÖ NEUTAL, 7343 NEUTAL, ERLERNEWEG 12 Druck: Degendorfer Druck / Weppersdorf 2 Klartext Hochkarätige Betriebsansiedlung: Erich Trummer Bürgermeister IAC plant Standort für Entwicklung Liebe Neutalerinnen, Liebe Neutaler! Geschätzte Jugend! und Produktion Kooperationsvertrag und Grundstückserwerb it unserer gemeinsam erarbeiteten Zu- abgeschlossen – bis zu 200 neue Arbeitsplätze möglich M kunftsstrategie für Mensch und Wirt- schaft – Neutal 2025 – bauen wir Die International Automotive Components Group kontinuierlich an unserem Neuen Neutal. In- („IAC“), ein führender internationaler Automobil- und frastrukturprojekte wie die Sport- und Kul- Mobilitätszulieferer von Innenraumlösungen mit leich- turhalle, das Pflegezentrum oder der Wohnbau sind dabei genauso gezielte Um- ten und neuen Materialien, beabsichtigt einen neuen setzungsmaßnahmen der Gemeindevertre- Standort in Neutal zu errichten. Das gaben Landes- tung, wie auch die aktive hauptmann Hans Peter Doskozil, die Landesräte Alex- Betriebsansiedlungspolitik für zukunftsfähi- ander Petschnig und Heinrich Dorner sowie ge Jobs und Wirtschaftskraft in unserer Ge- meinde. Rund 10 Mio. Euro werden aktuell in Bürgermeister Erich Trummer gemeinsam mit IAC- Neutal für die Daseinsbereiche Wohnen, CEO Manfred Gingl und weiteren Vertretern des Un- Pflege, -
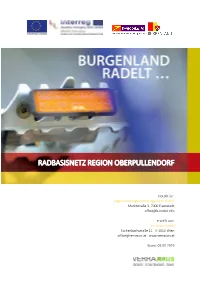
Radbasisnetz Region Oberpullendorf
RADBASISNETZ REGION OBERPULLENDORF erstellt für: Regionalmanagement Burgenland GmbH Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt [email protected] erstellt von: Verracon GmbH Eschenbachstraße 11 · A-1010 Wien [email protected] · www.verracon.at Stand: 05.09.2019 Inhaltsverzeichnis 2 INHALT 1 MEHR ALS GUTE GRÜNDE FÜRS RADFAHREN ................................................................................. 3 2 WORUM GEHT’S BEIM RADBASISNETZ ........................................................................................... 6 2.1 Die Radbasisnetze im Burgenland .......................................................................................... 6 2.2 Alltagsradverkehr vs. Freizeitradverkehr ............................................................................... 8 2.3 Woraus kann ein Radverkehrsnetz bestehen? ..................................................................... 10 3 DER WEG ZUM RADBASISNETZ ..................................................................................................... 12 3.1 Ein gemeinsamer Prozess .................................................................................................... 12 3.2 Ziele und Wunschlinien ........................................................................................................ 13 3.2.1 Ziele der Pendlerinnen und Pendler ......................................................................... 13 3.2.2 Wichtige regionale Ziele ........................................................................................... 13 3.2.3 Wunschliniennetz -

Das Obere Stooberbachtal Ein Beitrag Zur Siedlungsgeschichte Des Mittleren Burgenlandes Von Karl Semmelweis, Eisenstadt, Landesarchir I
©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at Das obere Stooberbachtal Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des mittleren Burgenlandes Von Karl Semmelweis, Eisenstadt, Landesarchir I. Der Stoober Bach, der das mittlere Burgenland gleich einer Diagonale von NW nach SO durchfließt, entspringt in Niederösterreich und erreicht knapp oberhalb von Oberpetersdorf unter dem Namen Schwarzbach die burgenlän dische Landesgrenze, durchfließt der Reihe nach die Orte (bzw. deren Gemein degebiet) Oberpetersdorf, Kobersdorf, Weppersdorf, St. Martin, Schwabenhof, Neutal, Stoob, Oberpullendorf, Mitterpullendorf, Unterpullendorf, Kleinmut schen sowie Großmutschen und mündet bei Strebersdorf in die Rabnitz. Un ter dem oberen Stooberbachtal verstehen wir jene breite Tallandschaft, die von Oberpetersdorf, richtiger von Kobersdorf, bis zum vorspringenden kristallinen Rücken des Nopplerberges reicht, der hier knapp vor Stoob von den tertiären Ablagerungen hervorstehend, das Stooberbachtal einengt. Heute sind nur die Höhen, die das Tal begleiten von Wäldern bedeckt, das Hügelland und die mehr oder minder sanften Hänge werden landwirtschaftlich genützt, die flache, bald enger, bald breiter werdende Talsohle weist von Kobersdorf bis zur Mün dung bei Strebersdorf nur Wiesen auf, die stellenweise versumpft sind. In Ur zeiten war dieses ganze Gebiet mit Ausnahme der flachen Talsohle von dich ten Urwäldern bedeckt, in denen nur wilde Tiere hausten. Die ersten Menschen, die dieses Gebiet zu besiedeln begannen, dürften die -

Deutschkreutz
Deutschkreutz - Weppersdorf - Draßmarkt - Bernstein 1848 gültig ab 16.6.2021 Betreiber: Österreichische Postbus AG, Kundeninformation: Tel.: 05 1717 Alle Angaben ohne Gewähr. Montag - Freitag Kursnummer 101 103 107 109 111 113 Verkehrshinweis 43 43 43 Deutschkreutz Bahnhof (P+R) 5.30 14.15 15.15 17.54 Deutschkreutz Bahngasse 40 5.31 14.15 15.15 17.54 Unterpetersdorf Kirche 5.33 14.18 15.18 17.57 Horitschon Friedhof 5.36 14.21 15.21 18.00 Horitschon Gasthaus Lazarus 14.22 15.22 18.01 Neckenmarkt Elisabethgasse 14.23 15.23 18.02 Neckenmarkt Rathausgasse 14.24 15.24 18.03 Neckenmarkt Elisabethgasse 14.25 15.25 18.04 Lackendorf Kriegerdenkmal 5.39 14.29 15.29 18.08 Lackendorf Hauptstr./Rochusg. 5.39 14.30 15.30 18.09 Lackenbach Bahnstraße 5.42 14.34 15.34 Lackenbach Schloßgasse 5.43 14.35 15.35 Lackenbach Haydngasse 5.44 Lackenbach Wiener Straße 5.45 Weppersdorf Raiffeisenplatz 5.50 Markt St. Martin Gh. Muschitz 5.52 Markt St. Martin Gh. Werkovits 5.53 Neutal Draßmarkter Straße 5.56 Neutal Draßmarkter Straße 5.56 Neutal Technologiezentrum 5.57 Draßmarkt Mühlweg/Ferkelhalle 6.00 Draßmarkt Gemeindeamt 6.01 Draßmarkt Kriegerdenkmal 6.02 Draßmarkt Herrschaftsgarten 6.03 Weingraben Hauptstraße 4/122 6.05 Weingraben Hauptplatz 6.05 Karl im Bgld Hauptplatz 6.08 Karl im Bgld Hauptplatz ab 6.10 Kirchschlag/Bucklige Welt Abzw. Lembach 6.12 Kirchschlag/Bucklige Welt Gemeindeamt 6.15 Kirchschlag/Bucklige Welt Pinzkerweg 6.16 Kirchschlag/Bucklige Welt Seiserstraße 6.16 Kirchschlag/Bucklige Welt Unterdorf 6.17 Kirchschlag/Bucklige Welt Ungerbach 6.18 Kirchschlag/Bucklige Welt Steinmühle 6.19 Kirchschlag/Bucklige Welt Habich 6.22 Redlschlag Abzw. -

Iron Curtain Trail
IRON CURTAIN TRAIL DIESES PROJEKT WIRD VOM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG, VON Österreich – Ungarn. Entlang des „Eisernen Vorhangs“. BUND UND LAND BURGENLAND KOFINANZIERT. BGLD_cover_ROADBOOK_210x110.indd 1 12.06.2015 14:07:49 The Burgenland “Iron Curtain Trail” Discovering a piece of history For almost half a century, the Iron Curtain sepa- land, Hans Sipötz, on 27 June 1989 at Klingenbach, rated the continent - from Barents Sea to Black the Iron Curtain became a part of history. Sea. Today, you can “discover” this past division A history that you will discover in the company of of Europe with your bicycle along the 14 long- this roadbook. The Burgenland “Iron Curtain Trail” distance routes of the EuroVelo 13 (a total of is one of six top Pannonical bicycle routes. In the 10,400 km). roadbook “Cycling along Lake Neusiedl”, you A 290 km-long section of this “Iron Curtain Trail” can find the famous Lake Neusiedl Cycle Path leads along the border between Burgenland and (Neusiedler See-Radweg), the Puddle Cycle Path Hungary, where the Iron Curtain used to stand from (Lackenradweg), the Cherry Blossom Cycle Path 1948 to 1989. Many tragedies took place here, (Kirschblütenradweg) and the new Festival Cycle with people trying to flee the Eastern Block losing Path (Festival-Radweg). The Paradise Route in their lives. And tears of joy were shed, too. Such Southern Burgenland is enchanting with its as during the “Pan-European picnic” on 19 August incredible diversity. In total, 2,500 kilometres of 1989, when 600 GDR citizens fled to the West. splendidly structured and well-marked cycle As Austrian Foreign Minister Alois Mock and his paths await you in the land of the sun. -

Documenta Praehistorica 28
UDK 303’12/’15(4-191.2)"634" Documenta Praehistorica XXVIII The beginning of the Neolithic in Austria – a report about recent and current investigations Eva Lenneis Department of Prehistoric Archaeology, University of Vienna, Austria [email protected] ABSTRACT – The “Earliest Linear Pottery-Culture” (LPC I) is to be seen as a synonym for the beginning Neolithic in Central Europe and therefore also in Austria. The distribution of this culture was limited by several facts of the natural environment, as its economic base was agriculture and stockbreeding. Traces are only to be found through Austrian territory outside the Alps in altitudes up to 400/450 m, on the best arable soils (mainly on loess base) and in the driest and warmest climatic zones with a clearly defined limit of tolerance. In the last two decades excavations of very different scale have been effected. A short overview is given upon the biggest ones and their main results. The first field re- searches had been between 1984–1986 within an international investigation project. Their results were analysed in detail and just gone into print. In this article they were presented shortly in a sort of summary. At least an outlook is given on current excavations and other projects. IZVLE∞EK – Najzgodnej∏a kultura linearnotrakaste keramike velja kot sinonim za za≠etek neolitika v srednji Evropi in zatorej tudi v Avstriji. Raz∏irjenost te kulture so omejevali dejavniki naravnega okolja, saj je gospodarsko temeljila na poljedelstvu in ∫ivinoreji. Njene sledi v Avstriji smo na∏li le iz- ven alpskega podro≠ja in na nadmorskih vi∏inah do 400/450 metrov, na najbolj plodni prsti (prete∫- no aluvialnega izvora) in v najbolj suhih in toplih klimatskih podro≠jih z jasno dolo≠eno mejo tole- rance.