Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
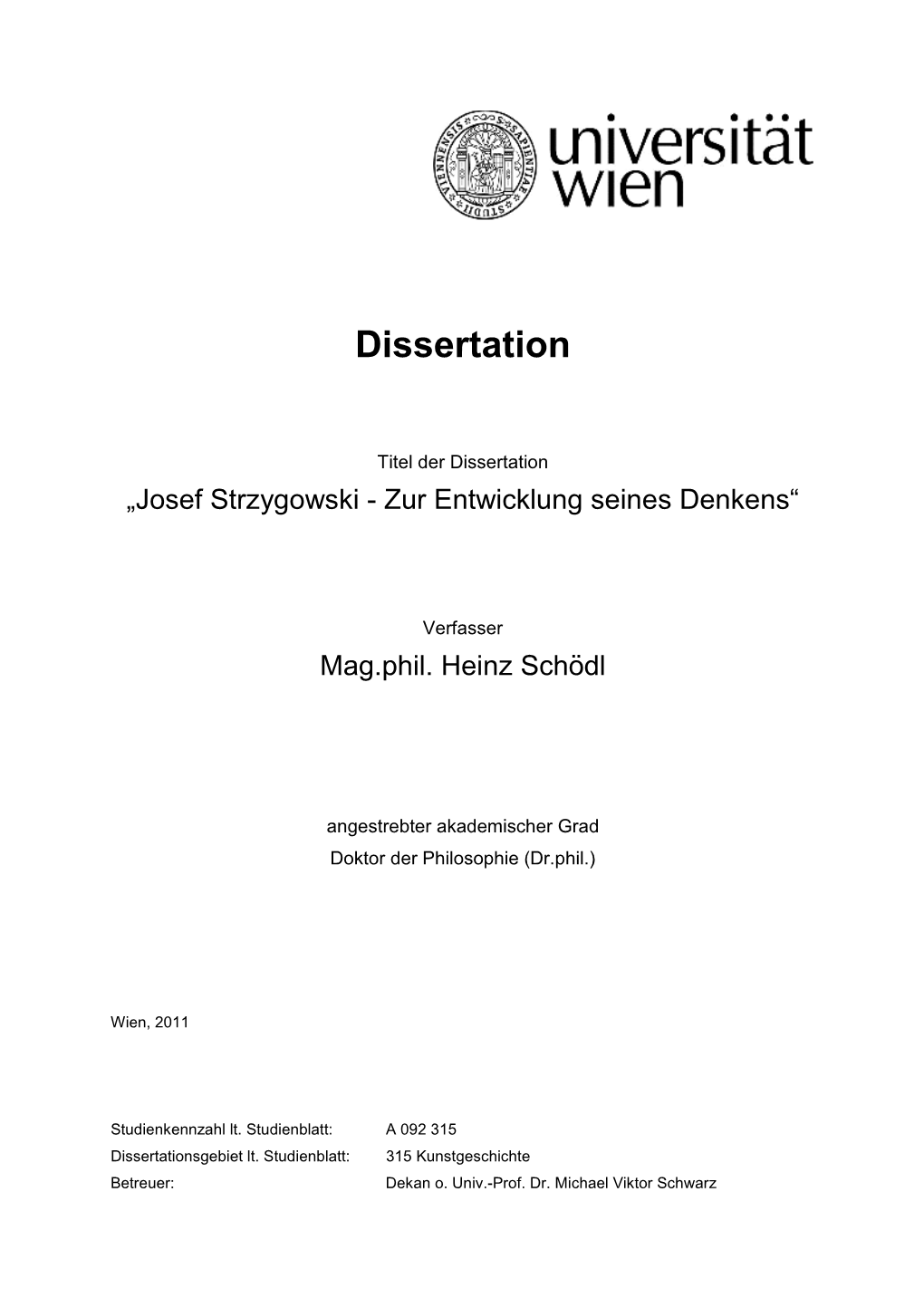
Load more
Recommended publications
-

Introduction
Introduction Just over a century has passed since a team of scholars from across Europe, led by German historian of ancient philosophy and science Hermann Diels (1848–1922)1, compiled the manuscripts containing Greek medical texts and their medieval translations into a catalogue2. Following such classical bibliographies as the Bibliotheca Graeca by Johann Albert Fabricius (1668–1736)3 and the several Bibliothecae by Albrecht von Haller (1708–1777)4, Diels, as the catalogue became known, was a landmark in classical and medico-historical scholarship5. It was not completely 1 For a broad approach to Diels’ multifaceted activity, see for example Calder et al. 1999. All works referred to in this introduction are cited in an abbreviated form (author’s last name and year of publication). For the full reference, see the bibliography at pp. xxi–xxx. 2 The catalogue was published in two issues in 1905 and 1906, in the proceedings of Berlin Acade- my of Science, with a supplement in 1908 in the same series (Diels 1905, 1906a, and 1908, respectively). The 1905 and 1906 issues were published together as a volume in 1906 (Diels 1906b) with a slightly different title (Die Handschriften der antiken Ärzte, Griechische Abtei- lung) which implied that a similar programme would have dealt with the Latin manuscripts. The frontmatter of the second issue (1906a), which provided a general presentation of the programme, the list of the collaborators, and the bibliography, is reproduced as the front matter of this volume with the same pagination as in the first publication. All three issues (1905, 1906a, and 1908) were reprinted in 1970 with an introduction by Fridolf Kudlien (1928–2008) (Kudlien 1970). -

UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Fantasies of Friendship: Ernst Jünger and the German Right's Search for Community in Modernity Permalink https://escholarship.org/uc/item/1f32711j Author Bures, Eliah Matthew Publication Date 2014 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Fantasies of Friendship: Ernst Jünger and the German Right’s Search for Community in Modernity By Eliah Matthew Bures A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Martin E. Jay, Chair Professor John F. Connelly Professor David W. Bates Spring 2014 Copyright © 2014 By Eliah Matthew Bures All rights reserved Abstract Fantasies of Friendship: Ernst Jünger and the German Right’s Search for Community in Modernity By Eliah Matthew Bures Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Martin E. Jay, Chair This dissertation argues that ideas and experiences of friendship were central to the thinking of German radical conservatives in the twentieth century, from the pre-WWI years to the emergence, beginning in the 1970s, of the New Right. I approach this issue by examining the role of friendship in the circle around the writer Ernst Jünger (1895-1998). Like many in his generation, Jünger’s youthful alienation from a “cold” bourgeois society was felt via a contrast to the intimacy of personal friendship. A WWI soldier, Jünger penned memoirs of the trenches that revealed similar desires for mutual understanding, glorifying wartime comradeship as a bond deeper than words and a return to the “tacit accord” that supposedly marked traditional communities. -

The German-Jewish Experience Revisited Perspectives on Jewish Texts and Contexts
The German-Jewish Experience Revisited Perspectives on Jewish Texts and Contexts Edited by Vivian Liska Editorial Board Robert Alter, Steven E. Aschheim, Richard I. Cohen, Mark H. Gelber, Moshe Halbertal, Geoffrey Hartman, Moshe Idel, Samuel Moyn, Ada Rapoport-Albert, Alvin Rosenfeld, David Ruderman, Bernd Witte Volume 3 The German-Jewish Experience Revisited Edited by Steven E. Aschheim Vivian Liska In cooperation with the Leo Baeck Institute Jerusalem In cooperation with the Leo Baeck Institute Jerusalem. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. ISBN 978-3-11-037293-9 e-ISBN (PDF) 978-3-11-036719-5 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-039332-3 ISSN 2199-6962 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: bpk / Staatsbibliothek zu Berlin Typesetting: PTP-Berlin, Protago-TEX-Production GmbH, Berlin Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Preface The essays in this volume derive partially from the Robert Liberles International Summer Research Workshop of the Leo Baeck Institute Jerusalem, 11–25 July 2013. -

Modernism and Fascism in Norway by Dean N. Krouk A
Catastrophes of Redemption: Modernism and Fascism in Norway By Dean N. Krouk A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Scandinavian in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Mark Sandberg, Chair Professor Linda Rugg Professor Karin Sanders Professor Dorothy Hale Spring 2011 Abstract Catastrophes of Redemption: Modernism and Fascism in Norway by Dean N. Krouk Doctor of Philosophy in Scandinavian University of California, Berkeley Professor Mark Sandberg, Chair This study examines selections from the work of three modernist writers who also supported Norwegian fascism and the Nazi occupation of Norway: Knut Hamsun (1859- 1952), winner of the 1920 Nobel Prize; Rolf Jacobsen (1907-1994), Norway’s major modernist poet; and Åsmund Sveen (1910-1963), a fascinating but forgotten expressionist figure. In literary studies, the connection between fascism and modernism is often associated with writers such as Ezra Pound or Filippo Marinetti. I look to a new national context and some less familiar figures to think through this international issue. Employing critical models from both literary and historical scholarship in modernist and fascist studies, I examine the unique and troubling intersection of aesthetics and politics presented by each figure. After establishing a conceptual framework in the first chapter, “Unsettling Modernity,” I devote a separate chapter to each author. Analyzing both literary publications and lesser-known documents, I describe how Hamsun’s early modernist fiction carnivalizes literary realism and bourgeois liberalism; how Sveen’s mystical and queer erotic vitalism overlapped with aspects of fascist discourse; and how Jacobsen imagined fascism as way to overcome modernity’s culture of nihilism. -

An Analysis of Antisemitic Political Cartoons in Fin-De-Siècle Vienna
W&M ScholarWorks Undergraduate Honors Theses Theses, Dissertations, & Master Projects 4-2013 The Origins of Hatred: An Analysis of Antisemitic Political Cartoons in Fin-de-Siècle Vienna Meredith Lee Duffy College of William and Mary Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/honorstheses Part of the History Commons Recommended Citation Duffy, Meredith Lee, "The Origins of Hatred: An Analysis of Antisemitic Political Cartoons in Fin-de-Siècle Vienna" (2013). Undergraduate Honors Theses. Paper 617. https://scholarworks.wm.edu/honorstheses/617 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Honors Theses by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. THE ORIGINS OF HATRED: AN ANALYSIS OF ANTISEMITIC POLITICAL CARTOONS IN FIN-DE-SIÈCLE VIENNA A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Arts in History from the College of William and Mary in Virginia, Meredith Lee Duffy Accepted for _______________________________ _________________________________ Leslie Waters, Director _________________________________ Tuska Benes _________________________________ Marc Raphael Williamsburg, Virginia 24 April 2013 TABLE OF CONTENTS LIST OF IMAGES ................................................................................. IV LIST OF TABLES ....................................................................................V -

Arthur Schnitzler and Jakob Wassermann: a Struggle of German-Jewish Identities
University of Cambridge Faculty of Modern and Medieval Languages Department of German and Dutch Arthur Schnitzler and Jakob Wassermann: A Struggle of German-Jewish Identities This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy by Max Matthias Walter Haberich Clare Hall Supervisor: Dr. David Midgley St. John’s College Easter Term 2013 Declaration of Originality I declare that this dissertation is the result of my own work. This thesis includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except where specifically indicated in the text. Signed: June 2013 Statement of Length With a total count of 77.996 words, this dissertation does not exceed the word limit as set by the Faculty of Modern and Medieval Languages, University of Cambridge. Signed: June 2013 Summary of Arthur Schnitzler and Jakob Wassermann: A Struggle of German- Jewish Identities by Max Matthias Walter Haberich The purpose of this dissertation is to contrast the differing responses to early political anti- Semitism by Arthur Schnitzler and Jakob Wassermann. By drawing on Schnitzler’s primary material, it becomes clear that he identified with certain characters in Der Weg ins Freie and Professor Bernhardi. Having established this, it is possible to trace the development of Schnitzler’s stance on the so-called ‘Jewish Question’: a concept one may term enlightened apolitical individualism. Enlightened for Schnitzler’s rejection of Jewish orthodoxy, apolitical because he always remained strongly averse to politics in general, and individualism because Schnitzler felt there was no general solution to the Jewish problem, only one for every individual. For him, this was mainly an ethical, not a political issue; and he defends his individualist position in Professor Bernhardi. -

Architecture and Nation. the Schleswig Example, in Comparison to Other European Border Regions
In Situ Revue des patrimoines 38 | 2019 Architecture et patrimoine des frontières. Entre identités nationales et héritage partagé Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions Peter Dragsbo Electronic version URL: http://journals.openedition.org/insitu/21149 DOI: 10.4000/insitu.21149 ISSN: 1630-7305 Publisher Ministère de la culture Electronic reference Peter Dragsbo, « Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions », In Situ [En ligne], 38 | 2019, mis en ligne le 11 mars 2019, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/insitu/21149 ; DOI : 10.4000/insitu.21149 This text was automatically generated on 1 May 2019. In Situ Revues des patrimoines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other Europe... 1 Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions Peter Dragsbo 1 This contribution to the anthology is the result of a research work, carried out in 2013-14 as part of the research program at Museum Sønderjylland – Sønderborg Castle, the museum for Danish-German history in the Schleswig/ Slesvig border region. Inspired by long-term investigations into the cultural encounters and mixtures of the Danish-German border region, I wanted to widen the perspective and make a comparison between the application of architecture in a series of border regions, in which national affiliation, identity and power have shifted through history. The focus was mainly directed towards the old German border regions, whose nationality changed in the wave of World War I: Alsace (Elsaβ), Lorraine (Lothringen) and the western parts of Poland (former provinces of Posen and Westpreussen). -

Antiquariatsangebot Nr.989
Versandantiquariat Robert A. Mueller Nachf. ∗ gegründet 1950 ∗ Inh. Herbert Mueller * D-30916 Isernhagen Bothfelder Str. 11 Tel.:0511 / 61 40 70 Antiquariats-Angebot Nr. 989 Pädagogik von Mnu bis Rey Bei Bestellungen innerhalb von 10 Tagen 50 Prozent Rabatt Der Rabatt gilt nur für dieses Angebot Erhaltungszustands-Abkürzungen: 1)= Tadellos, 2)= gut erhalten, 3)= mit leichten Gebrauchsspuren, 4)= mit stärkeren Gebrauchsspuren, Na.= Name auf Titelblatt, (St.)= Stempel, U.= Unterstreichungen, (oJ.)= ohne Angabe des Erscheinungsjahres, Bibl. = Bibliotheksexemplar mit Stempel und Rückennummer (evtl. in Folie eingeschweißt). Falls Bestelltes nicht innerhalb 30 Tagen geliefert wurde, ist der Titel bereits verkauft. Sollte ein Titel kurzfristig (90 Tage) erneut angekauft werden können, wird dieser automatisch nachgeliefert. Benachrichtigung über verkaufte Titel nur auf Wunsch ! - 2007 - > Fax 0511 / 61 40 75 < > E-Mail [email protected] < 1) MNU: Jg.47.1994.Heft 6 und Jg.49.1996 Heft 1 und 2. Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht. Organ des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e. V. Dümmler Verlag. Bonn. 323-384. IV. , XXVIII. 128 S. Quart. m. Textabb. (St. ). Kt. -2)je Heft. {AO393} 3,47 € 2) Möbus,Gerhard: Sowjetpädagik in Deutschland. Sonderdruck aus Psychagogie u. Pädagogik des Kommunismus. Westdeutscher Vlg. Köln. 1959. 76 S. (St. )Kt. -2). {AU986} 4,49 € 3) Modern Sprak: Vol. 66. Edited for the Modern Language Teachers' Association. by Johannes Hedberg, Gustav Korlén, Börje Schlyter. Moderna Sprak.Hefte 1-4 gebunden. U.a. Wessner, Die deutschsprachige Minderheit in Rumänien. Testpapers. Saltsjö-Duvnäs. Sweden. 1972. VII. 464 S.(St.) Hln. - 2)Bibl. engl., schwedisch, deutsch u.a.. {BR4687} 35 € 4) Modern Sprak: Vol.67. -

International Academy of Perinatal Medicine (Iapm)
History, Organization and Activities PREFACE Organization and Activities History, he International Academy of Perina- by Prof. Erich Saling, President of IAPM. tal Medicine (IAPM) was created in T 2005, with the agreement of the Presi- FOREWORD dents of three scientific societies: the by José M. Carrera, Secretary General ) World Association of Perinatal Medicine of IAPM. (WAPM), the European Association of Peri- CHAPTER 1 natal Medicine (EAPM) and the Internatio- The History of Perinatal Medicine. nal Society «The Fetus as a Patient» (ISFAP). IAPM ( th On the 25 of May 2005 took place the CHAPTER 2 foundational ceremony in Barcelona The fathers of Perinatal Medicine: (Spain) with venue at the Royal Academy the academic medals. of Medicine of Catalonia. CHAPTER 3 The objective of the Academy is to create a Identity and mission of International place for the studystudy, reflection, dialogue Academy of Perinatal Medicine (IAPM). INTERNATIONAL and prpromotionomotion of PPerinatal Medicine, es- CHAPTER 4 pecially on those ississues related to bioethics, History of International Academy the appropriate appapplication of the techno- of Perinatal Medicine (IAPM): ACADEMY logical advances aand the sociologic and the foundation. huhumanisticmanistic ddimensionsimensi of the fi eld. CHAPTER 5 OF PERINATAL Furthermore, the AAcademy endeavours to Constitution of IAPM and By-Laws. constitute a friendshfriendship-based bond among ththee ththreeree scscientificientifi Societies that have CHAPTER 6 sponsored its foundfoundation. Basic Organization of the IAPM. MEDICINE In the same act oof the foundation, the CHAPTER 7 members of the BBoard of the Academy The International Council: were elected. Prof. Erich Saling (Germany) Regular Fellows of IAPM. (IAPM) was elected as President,Pre and Professors CHAPTER 8 Asim Kurjak (Croati(Croatia), Aris Antsaklis (Gree- Honorary Members ce), Frank ChervenaChervenak (USA) and H. -

Literaturliste.Pdf
A# Mark B. Abbe, A Roman Replica of the ‘South Slope Head’. Polychromy and Identification, Source. Notes in Abbe 2011 History of Art 30, 2011, S. 18–24. Abeken 1838 Wilhelm Abeken, Morgenblatt für gebildete Stände / Kunstblatt 19, 1838. Abgusssammlung Bonn 1981 Verzeichnis der Abguss-Sammlung des Akademischen Kunstmuseums der Universität Bonn (Berlin 1981). Abgusssammlung Göttingen Klaus Fittschen, Verzeichnis der Gipsabgüsse des Archäologischen Instituts der Georg-August-Universität 1990 Göttingen (Göttingen 1990). Abgusssammlung Zürich Christian Zindel (Hrsg.), Verzeichnis der Abgüsse und Nachbildungen in der Archäologischen Sammlung der 1998 Universität Zürich (Zürich 1998). ABr Paul Arndt – Friedrich Bruckmann (Hrsg.), Griechische und römische Porträts (München 1891–1942). Michael Abramić, Antike Kopien griechischer Skulpturen in Dalmatien, in: Beiträge zur älteren europäischen Abramić 1952 Geschichte. FS für Rudolf Egger I (Klagenfurt 1952) S. 303–326. Inventarium Von dem Königlichen Schloße zu Sanssouci, und den neuen Cammern, so wie solches dem Acta Inventur Schloss Castellan Herr Hackel übergeben worden. Aufgenommen den 20 Merz 1782, fol. 59r-66r: Nachtrag Mai Sanssouci 1782−1796 1796, in: Acta Die Inventur Angelegenheiten von Sanssouci betreffend. Sanssouci Inventar 1782-1825, vol. I. (SPSG, Hist. Akten, Nr. 5). Acta betreffend das Kunst- und Raritaeten-Cabinet unter Aufsicht des Herrn Henry 1798, 1799, 1800, 1801. Acta Kunst-und Königliche Akademie der Wissenschaften, Abschnitt I. von 1700–1811, Abth. XV., No. 3 die Königs Cabinette Raritätenkabinett 1798–1801 a[?] des Kunst-Medaillen u. Nat. Cab. Acta Commissionii Reclamationen über gestohlene Kunstsachen. 1814, vol. 1, fol. 4r–33v: Bericht Rabes über gestohlene Kunstsachen an Staatskanzler von Hardenberg, 12. Februar 1814, fol. 81r–82r: Brief Acta Kunstsachen 1814 Henrys an Wilhelm von Humboldt, 26. -

The Ethical Formation of the Hippocratic Physician Joseph A
ABSTRACT The Hippocratics in Context: The Ethical Formation of the Hippocratic Physician Joseph A. Lloyd Director: Joseph A. DiLuzio, Ph.D. The Hippocratic Oath is widely known today as something that medical students say at their graduation ceremony as they are about to go out into the world and begin their practice of medicine. This long-standing tradition goes back centuries, and begs the question of why this is done? Who was Hippocrates, and what did he and the physicians he taught use the Hippocratic Oath for? In order to answer this question, one must have an understanding of several things about ancient Greece: the history of education in ancient Greece, communities of physicians contemporary with Hippocrates, the Hippocratic Corpus, and Hippocrates himself. In this thesis I provide this context in order to elucidate how the Hippocratic Oath was used in the education of Hippocratic physicians in fifth century BCE Greece. APPROVED BY DIRECTOR OF HONORS THESIS: ___________________________________________________ Dr. Joseph A. DiLuzio, Department of Classics APPROVED BY THE HONORS PROGRAM: ___________________________________________________ Dr. Elizabeth Corey, Director DATE: _________________________ THE HIPPOCRATICS IN CONTEXT: THE ETHICAL FORMATION OF THE HIPPOCRATIC PHYSICIAN A Thesis Submitted to the Faculty of Baylor University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Honors Program By Joseph A. Lloyd Waco, Texas August 2018 TABLE OF CONTENTS Introduction iii Chapter One: Ancient Greek Medical Schools: Cyrene, Croton, Cnidus, and Rhodes 1 Chapter Two: The Hippocratic Medical School at Cos 20 Chapter Three: The Ethics of the Hippocratic Oath 32 Conclusion 47 Appendices 49 Appendix A: The Hippocratic Oath Bibliography 52 ii INTRODUCTION The age of modernity is an age of moral subjectivism; all but gone are the days of a belief in an objective moral truth, the Truth to which Socrates refers in Plato’s writings. -

On Sheldon Pollock's “NS Indology”
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Springer - Publisher Connector History in the Making: On Sheldon Pollock’s “NS Indology” and Vishwa Adluri’s “Pride and Prejudice” Reinhold Grünendahl Taking up a recent publication on the history of ‘German Indology’ is often like walking into a fast-food outlet: you have a basic idea of what you will be served, and to some this may be part of the attraction. With few exceptions, these preparations implicitly or explicitly follow the recipe of Sheldon Pollock’s “Deep Orientalism?” (1993), albeit with the increasing tendency to drop (metaphorically) the invertebrate question mark, as if Pollock’s amorphous presumptions had meanwhile coagu- lated into hard facts. When Pollock set out in 1988–89 to theorize ‘German Indology,’ it was his declared ambition to adapt the theoretical premises of Edward W. Said’s Orientalism (1978) in such a way that they could also be applied to “German Orientalism,” which Said had decided to ignore—a deplorable “lacuna” in the eyes of some (Adluri 2011: 253), in my view a necessary precaution to prevent his construct from disintegrating before he could complete it. Meanwhile, thanks to Robert Irwin (2006) and others, it has been thoroughly dismantled—a fact Said’s committed adherents may not have realized or choose to ignore. Pollock’s point of departure is the presumption that, contrary to Said’s notion of European ‘Orientalism,’ “as directed outward—toward the colonization and domination of Asia,…we might conceive of…[German Indology] as potentially directed inward—toward the colonization and domination of Europe itself” (1993: 77).1 International Journal of Hindu Studies 16, 2: 189–257 © The Author(s) 2012.