Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. Teil: Siegfrieds Tod Auf Der Burg Zu Xanten Im Niederland Herrscht Das Stolze Geschlecht Der Wälsungen
DAS NIBELUNGENLIED (vorgetragen auf der Anreise nach Worms von Annemarie Reinitzhuber) 1. Teil: Siegfrieds Tod Auf der Burg zu Xanten im Niederland herrscht das stolze Geschlecht der Wälsungen. Unter der Obhut von König Siegmund und seiner Frau Sieglinde wächst deren Sohn Siegfried zum stattlichen Jüngling heran. Als zukünftiger Nachfolger seines Vaters muss er sich einer umfangreichen Ausbildung unterziehen, diese soll aber noch durch Erlernen eines Handwerks ergänzt werden. Wegen seiner körperlichen Kräfte möchte er sich zusätzliche Kenntnisse über das Schmiedehandwerk bei dem berühmten Meister Mine aneignen. Als Siegfried zum ersten Mal an dem Ambos steht, schlägt er so gewaltig auf das glühende Eisen ein, dass die Splitter nur so herumfliegen und der Ambos tief in den Boden versinkt. Mine beginnt sich vor dem hünenhaften Jungen zu fürchten. Hinterlistig wie er war, überlegt er, wie er Siegfried wieder loswerden könne. Deshalb gibt er ihm den Auftrag, bei einem Köhler in einer finsteren Bergschlucht Holzkohlen zu holen. Dabei verschweigt er aber, dass dort kein Köhler sondern ein Lindwurm haust. „Der kehrt nie wieder“, meint der Schmied zu sich spottend. Singend zieht also Siegfried am nächsten Morgen bewaffnet mit einem selbstgeschmiedeten Schwert durch den Wald dahin. Zwischen immer engeren Felsenwänden erhebt sich plötzlich das furchtbare Ungetüm: „Die Doppelzunge züngelte, der Rachen hauchte heiß, der Schuppenschweifumzingelte den Wälsungsohn im Kreis!“ Mutig schwingt Siegfried sein gutes Schwert. Der erste furchtbare Schlag hat dem Lindwurm gleich eine erhebliche Wunde zugefügt, neue Schläge rauben dem grässlichen Leibe bald die Lebenskräfte. Ein letzter Hieb trennt das Haupt vom Rumpfe. Dann verbrennt er das tote Untier auf einem Scheiterhaufen, ein heißer Strom aus Blut und Fett quillt hervor. -

Das Nibelungenlied Lehrmaterial Ab Klassenstufe 7
Das Nibelungenlied Lehrmaterial ab Klassenstufe 7 1 Inhalt Einführung Historischer Hintergrund Inhalt des Liedes Der unbekannte Dichter Überlieferung Figuren Konflikte Das Nibelungenlied im 20. Jahrhundert Weiterführende Links Quellen Impressum 2 Einführung Liebe, Treue, Eifersucht, Betrug – der Stoff aus dem spannende Liebesfilme oder dramatische Seifenopern gemacht sind. Wer hat noch nie von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder „Titanic“ gehört? Doch auch schon vor über 800 Jahren gehörten diese Themen zur höfischen Unterhaltung. Das Nibelungenlied, eine Sage über heldenhafte Männer und liebende Frauen – oder auch hinterhältige Männer und rachsüchtige Frauen, befasst sich mit den gleichen Inhalten wie die Serien und Filme unserer Zeit. 3 Historischer Hintergrund Zwei historische Ebenen Das Nibelungenlied spielt auf zwei verschiedenen historischen Ebenen. Der Untergang der Burgunder, mit dem das Lied endet, reicht noch in die Zeit der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert zurück. Das Lied wurde aber für die höfische Gesellschaft im Mittelalter um 1200 verfasst und daher an sie angepasst. Das sieht man an der Beschreibung der Hofgesellschaft, der Lehnsbindung, des gesellschaftlichen Umfeldes, insbesondere des höfischen Zeremoniells, der Rituale und der Kleider. Das mittelalterliche Lehnswesen Das mittelalterliche Lehnswesen der Stauferzeit ist wie das germanische Gefolgschaftswesen durch ein Treueverhältnis gekennzeichnet: Ein Treueverhältnis auf Gegenseitigkeit zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann. Der Lehnsherr verpflichtete sich, dem Lehnsempfänger „Schutz und Schirm“ zu geben, während der Lehnsempfänger dem Lehnsherrn Dienste leistet, vor allem Kriegsdienst sowie Rat und Hilfe in Form verschiedener Dienste, wie z. B. auch das Halten des Steigbügels, die Begleitung bei festlichen Anlässen und der Dienst als Mundschenk bei der Festtafel. Der oberste Lehnsherr war der Kaiser oder König. Er vergab Lehen an die Fürsten. -

Handout 17. U. 28.12. Nibelungenlied
1 Einführung in die germanistische Mediävistik Jochen Conzelmann Verschriftlichung der Heldensage: Das ‚Nibelungenlied’ Das ‚Nibelungenlied‘ (abgekürzt: NL) , entstanden um 1200 vermutl. in Passau, • stellt, abgesehen vom ahd. ‚Hildebrandslied‘ aus dem 9. Jh. (das nur zwei Handschriftenseiten umfasst), das erste schriftliche Zeugnis germanischer Heldensage dar; • schöpft aus mündlicher Tradition; • mediävalisiert mündlich tradierte Erzählungen von Ereignissen der Völkerwanderungszeit (4.- 6. Jh.), dem ‚heroic age‘ der germanischen Heldensage in schriftliterarischer Form. Heldensage • verweist als Begriff auf Mündlichkeit: „Sage“ „sagen“, mündlich „erzählen“, „berichten“; • besitzt stets einen ‚historischen Kern‘ und dient der memoria , der Erinnerung an Taten und Ereignisse früherer Zeiten und so der Verankerung historischer Ereignisse im kollektiven kulturellen Gedächtnis; • formt aber die tatsächlichen historischen Ereignisse in erzählerischer Weise um – vom Faktualen zur ‚Sage‘: Haupt-Personal des NL: Wormser Hof: Die Burgunden-Könige Gunther, Gernot und Giselher Ihre Schwester Kriemhild Ute, die Königin-Mutter Hagen von Tronje, ‚Chefberater’ und Verwandter Gunthers Dankwart, Hagens Bruder Volker von Alzey, Kampfgefährte Hagens und adliger Spielmann Xanten: Siegfried, sehr starker Held mit magischen Hilfsmitteln Siegmund, sein Vater, König Sieglinde, Gemahlin Siegmunds, Siegfrieds Mutter Îsenstein , Island: Brünhilde, starke Frau und Herrscherin über Island; später als Gattin Gunthers Königin der Burgunden Nibelungenland: Alberich, -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Literatur und Film: Perfekte Symbiose oder mediale Verfremdung Verfasser Jürgen Alfred Eder angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin ODER Betreuer: Ao.Univ.-Prof. Dr. Rainer Maria Köppl Inhaltsverzeichnis 0. Prolog S. 1 1. Über die Literarisierung des Films S. 3 2. Einführung in die literaturwissenschaftlichen Quellen S. 7 2.1 Die Nibelungen: Zuerst war die Sage, dann das Lied… S. 7 2.2 Verfasser des Nibelungenliedes: Anonymus S. 8 2.3 Was steckt hinter den Nibelungen: Vorgeschichtliche Quellen S. 9 2.3.1 Historische Quellen S. 9 2.3.2 Die nordische Edda S. 11 2.3.3 Die Lieder Edda S. 11 2.3.4 Die Prosawerke S. 12 2.4 Form und Aufbau des Nibelungenliedes S. 13 2.5 Die Nibelungenabschriften: kein Ende in Sicht S. 13 2.5.1 Die Klage S. 14 3. Zur Rezeptionsgeschichte: Kunst, Kitsch & Kommerz S. 16 3.1 Die theatralische und musikalische Rezeption S. 16 3.2 Die politische Rezeption: Helden braucht das Land S. 19 3.3 Die Trivialisierung der Nibelungen im Comic und Fantasybereich S. 23 3.3.1 Die Nibelungen erobern die Comics S. 23 3.3.2 Die Abwandlung der Nibelungen im Fantasygenre S. 28 3.4 Die mediale Rezeption S. 30 3.4.1 Die Nibelungen auf Tonträgern S. 30 3.4.2 Die Nibelungen auf der Leinwand-ein Blick durch die Filmgeschichte S. 33 3.5 Die Nibelungen in der Populärkultur S. 36 4. Das Nibelungen-Epos in der Weimarer Republik 4.1 Die Schöpfer des Nibelungenfilms: Fritz Lang und Thea von Harbou S. -
Stadt Worms" class="text-overflow-clamp2"> "Wer Mit Wem" Bei Den Nibelungen > Stadt Worms
6.3.2020 "Wer mit wem" bei den Nibelungen > Stadt Worms "Wer mit wem" bei den Nibelungen Das deutsche Nationalepos "Nibelungenlied" enthält mehr als 30 Namen von Personen, die zum großen Teil miteinander verwandt sind. Gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten... Die Nibelungen aus dem Nibelungenlied Zwei Hauptpersonen haben zweimal geheiratet und sich in der zweiten Ehe miteinander verbunden: Kriemhild hatte aus erster Ehe mit Siegfried den Sohn Gunther und aus zweiter Ehe mit Etzel den Sohn Ortlieb. Etzel war zuerst mit Helche verheiratet. Seine zweite Ehe mit Kriemhild war auch für diese die zweite. Daraus ging Ortlieb hervor. Die Recken aus beiden Heerlagern hatten unterschiedliche Funktionen. Damit Sie die Übersicht nicht verlieren, werden hier alle Personen auf einen Blick dargestellt: https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2012-03_ahnentafel-nibelungen.php?viewmode=print 1/3 6.3.2020 "Wer mit wem" bei den Nibelungen > Stadt Worms Danke Linktipp Ein Beitrag von Edmund Ritscher (März 2012). Vielen Dank dafür! Nibelungen Sie kennen auch eine Wormser Anekdote? https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2012-03_ahnentafel-nibelungen.php?viewmode=print 2/3 6.3.2020 "Wer mit wem" bei den Nibelungen > Stadt Worms Dann schreiben Sie uns: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort "Wussten Sie´s ?" an [email protected] (Internetredaktion Stadtverwaltung Worms). https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2012-03_ahnentafel-nibelungen.php?viewmode=print 3/3 Die Nibelungen aus dem Nibelungenlied Markgraf Rüdiger Gibich Pilgrim Siegmund von Bechelaren König am Rhein Bischof von Passau König von Xanten Onkel von Kriemhild oo oo oo Gotelind Ute Sieglinde | |________________________ | | | | | | | Dietlinde Brunhilde Gunther Gernot Giselher Kriemhild Siegfried Etzel Königin von Könige der Burgunder König der König der Isenstein Nibelungen Hunnen | |_____________| | | I. -

Fritz Lang: Die Nibelungen
Fritz Lang: Die Nibelungen [von Gunter Grimm; Februar 2020] Fritz Lang hat 1924 mit seinem berühmten Stummfilm die Reihe der Nibelungenfilme eröff- net. Insofern kommt seinem Film schon rein historisch eine Position zu, an der sich die nach- folgenden Filme alle messen müssen. Und das gilt nicht nur für die chronologischer Priorität, sondern auch für den künstlerischen Wert. Sicherlich ist es heute einigermaßen schwierig und beschwerlich, sich einen dreistündigen Zweiteiler anzuschauen, in dem die Protagonisten stumm und dafür überdeutlich und zeitlupenhaft agieren. Die Stummheit des Films bringt es mit sich, dass Lang auf das dekorative und das mimisch-gestische Moment den allergrößten Wert gelegt hat. Zur künstlerischen Machart wird im Folgenden noch einiges zu sagen sein. Freilich war der primäre Ansatz von Lang eindeutig ein politisch-ideologischer. Deutschland hatte den ersten Weltkrieg verloren. Langs Intention war, die Katastrophe des verlorenen Krieges zu erklären, indem er seine Analogie zum schicksalhaften Geschehen der Nibelun- gensage herstellte. Erklärterweise sollte der Film das nationale Selbstbewusstsein stärken. In diesem Sinne schrieb 1924 die „Filmwoche“: „Ein geschlagenes Volk dichtet seinen kriegerischen Helden ein Epos in Bildern, wie es die Welt bis heute kaum noch gesehen hat – das ist eine Tat! Fritz Lang schuf sie und ein ganzes Volk steht ihm zur Seite ... Dieses Kunstwerk wird in Deutschland nur getragen werden vom Nationalbewußtsein unseres Volkes ... Er ist aus unserer Zeit geboren, der Nibelungenfilm, und nie noch haben der Deutsche und die Welt ihn so gebraucht wie heute … Wir brauchen wieder Helden!“ (Zit. nach Schulte-Wülwer, S. 164) Fritz Lang versuchte mit seinem Film aus den schwierigen Anfängen der Weimarer Republik dem deutschen Volk seine verloren geglaubten heldischen Traditionen wieder ins Gedächtnis zu rufen und zum Wiederaufbau der Nachkriegsgesellschaft beizutragen. -

Chronologie Der Nibelungenrezeption
1 Die Rezeption des Nibelungenstoffes in Literatur, Kunst, Musik und Wissenschaft EINE SYNOPSE Zusammengestellt von Gunter E. Grimm (Universität Duisburg-Essen) Stand: Januar 2017 Die erste Spalte enthält eine farblich verschieden grundierte Übersicht über die historischen Epochen bzw. Phasen Europas von der Antike bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Geschichte, die eine historisch-politische Einordnung der betreffenden Werke ermögli- chen soll. Einige auf die Nibelungen-Rezeption bezogene Geschichtsdaten sind explizit aufgeführt. Die zweite Spalte nennt das Erscheinungsjahr der betreffenden Werke, in Ausnahmefällen die Entstehungsdaten. Die dritte Spalte enthält Titel aus der literarischen Rezeption des Nibelungen-Sagenkreises, in erster Linie belletristische Werke (Versepen, Roma- ne, Erzählungen, Dramen, Festspiele, Balladen, Gedichte, Parodien), aber auch Nacherzählungen und Kinderbücher. Die vierte Spalte enthält Werke der Bildenden Kunst, der Musik und der Filmkunst, die sich auf den Nibelungenstoff in der deutschen und der nordischen Version beziehen, die Eigenrezeption von Wagners „Ring des Nibelungen“ jedoch nicht einbeziehen. Da sich die Arbeit an Bildwerken oft über Jahre erstreckt, können in einigen Fällen nur Näherungsdaten angegeben werden, meist wurde das Jahr der Fertigstellung für die zeitliche Platzierung gewählt. Die fünfte Spalte enthält eine Auswahl der Editionen und Übersetzungen des Nibelungenlieds, sowie wichtige wissenschaftliche Monographien. Die mit Stern (*) versehenen Titel -

Das Nibelungenlied Ist in Mittelhochdeutsch Verfasst Worden
Das Nibelungenlied Lehrmaterial bis Klassenstufe 7 1 Inhalt Inhalt des Liedes Das Mittelalter Die Sage Die Sprache Wer ist wer im Nibelungenlied? Nibelungen - Quiz Weiterführende Links Quellen Impressum 2 Inhalt des Liedes „Nachdem er einen schrecklichen Drachen getötet und den riesigen Schatz der Nibelungen erobert hat, kommt der junge Siegfried aus Xanten an den Königshof von Worms. Dort will er Kriemhild, die Schwester König Gunthers, heiraten. Der König stimmt unter der Bedingung zu, dass Siegfried ihm im Gegenzug dabei hilft, Brünhild, die Königin von Island, zur Frau zu gewinnen. Brünhild hat übermenschliche Kräfte und nimmt nur denjenigen zum Mann, der sie in drei Wettkämpfen besiegt. Während der König bei den Wettkämpfen die Bewegungen ausführt, besiegt Siegfried mit Hilfe der unsichtbar machenden Tarnkappe die isländische Königin: Brünhild erkennt Gunther als ihren Gatten an und zieht mit ihm nach Worms. Den Vollzug der Ehe verweigert sie allerdings ihrem burgundischen Gatten. Wieder muss Siegfried, der Kriemhild geheiratet hat, helfen. In der Tarnkappe ringt er Brünhild im Ehebett nieder, so dass Gunther die Ehe vollziehen kann. Dabei nimmt ihr Siegfried heimlich Ring und Gürtel und schenkt beides Kriemhild. Einige Zeit später: Gunther lädt Siegfried und Kriemhild, die mittlerweile in Xanten leben, nach Worms ein. Beim Fest geraten die Königinnen in Streit. Brünhild, der Siegfried bei der Brautwerbung auf Island als Vasall Gunthers vorgestellt worden war, besteht auf Unterordnung Siegfrieds unter Gunther. Kriemhild kontert: Ihr Mann Siegfried habe als erster mit Brünhild geschlafen. Als Beweis dafür präsentiert sie Ring und Gürtel. Brünhild versinkt in Scham, Trauer und Hass. Hagen von Tronje, Gunthers mächtigster Vasall, will seine gedemütigte Herrin Brünhild rächen. -

Berichte, Informationen Veranstaltungen „Meinen Traum Gewinnen.“
Kreisstadt Alzey STADT-INFO Ausgabe 122-I /2020 Berichte, Informationen Veranstaltungen „Meinen Traum gewinnen.“ Sparen – Helfen – Gewinnen: Jeden Monat 100.000 Euro oder einen Audi Q2 Für nur 5 Euro im Monat können auch Sie bis zu 100.000 Euro, tolle Reisen oder eines von mehreren Traumautos gewinnen. Pro Los und Monat sparen Sie 4 Euro, 1 Euro ist der Spieleinsatz. Sichern Sie sich das 10-Gewinnt-Los. Jedes Ihrer Lose unter- stützt gemeinnützige Projekte vor Ort und nimmt an allen (Zusatz-)Verlosungen teil. Werden auch Sie zum Gewinnsparer. www.vb-alzey-worms.de - 1 - Vorwort 02 - 03 Sonderseiten: Wohin an Fastnacht? 04 - 05 Save the date: Scheu time 2020 06 Sonderseite: Werbung Fliesen Neufeld / BSK Büro Assistenz 07 3. Frühlingsfest und Saisonstart Marktfrühstück 08 Alzeyer Wochenmarkt stellt seine Händler vor 09 Galerie im Burggrafiat: Ehrenamtliche gesucht! 09 DA CAPO Open Air: Das Programm ist fast komplett 10 - 12 Sonderseite: Galerie im Burggrafiat – Gruppe impuls(e) „MENSCH.“ 13 „Friends of Alzey“ zu Besuch in der Volkerstadt 14 Sonderseite: Werbung Rheinhessen-Fachklinik Alzey 15 Sonderseite: Löwenschule Alzey – Jubeljahr 2020 16 Der Veranstaltungsflyer 2020 – Alle Events auf einen Blick! 17 - 18 Weinkönigin gesucht! 19 Sonderseite: Werbung HUK-COBURG 20 Sonderseiten: Museum Alzey – Osterferienprojekt für Kinder, Aktions- und Bastelnachmittage, KIMA-Termine 21 - 22 Das Zirkusprojekt am JuKu in den Sommerferien 23 Sonderseiten: Zirkusprojekt der Stadt Alzey mit Anmeldebogen 24 - 25 Sonderseiten: Ferienspiele der Stadt Alzey mit -

Die Nibelungen (1966-1967) Der Fimregisseur Und Drehbuchautor Heiβt Harald Reinl
Bearbeitungen des Nibelungenliedes Die Völsunga Sage Die Völsunga Saga ist eine isländische Sage aus der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts. Sie beschreibt die Geburt und den Niedergang des Clans Volsunga, die Legende von Sigurd (Siegfried) und Brynhildr (Brunhild) und die Zerstörung der Nibelungen. Die Völsunga Sage war in vielen Kontexten neu angepasst. Die bekanntesten Werke, die von dieser Saga inspiriert wurden, sind: Richard Wagners “Des Nibelungen Ring”, “Die Geschichte von Sigurd der Volsung und dem Fall der Niblungs” von Eiríkr Magnússon und William Morris und “Die Legende von Sigurd und Gudrún” von J. R. R. Tolkien. Sigurd geht in einen Wald, um ein Pferd zu finden und trifft Odin, der ihm Grains gibt, das beste der Pferde. Sein Vater ist tot und wird von Regin angenommen. Sigurds Mutter gibt ihm die Stücke des zerbrochenen Schwerts seines Vaters und Regin schmiedet Gram. Als der Drache stirbt, sagt er Sigurd, dass sein Gold und Regin der Tod von Sigurd sein werden. Regin trinkt das Blut des Drachen und bittet Sigurd das Herz zu braten und ließ es ihn essen. Sigurd testet, ob das Herz gekocht war und leckt seine Finger, und er versteht plötzlich die Sprache der Vögel. Er hört zwei Spechte über Regins Plan, ihn zu töten, sprechen. Deshalb tötet er Regin. Sigurd reitet in das Land der Franken und findet einen Schlaf Krieger. Sie war Brunhild, Odin sagt ihr, dass sie heiraten müssen, aber sie weigert sich jeden Mann zu heiraten, der Angst kennt, also stach er sie mit einem schlafenden Dorn. Dann entscheiden sie zu heiraten. Kriemhilds Mutter gibt ihm etwas zu trinken und er vergisst Brünhild. -

Die Nibelungen in Metall Und Stein Werke Der Bildhauerei an Rhein Und Donau
Die Nibelungen in Metall und Stein Werke der Bildhauerei an Rhein und Donau Rainer Schöffl [September 2015] Noch vor der ersten neuhochdeutschen Übersetzung des Nibelungenlieds 1807 durch Friedrich Heinrich von der Hagen gab es bereits ab 1798, angeregt durch die Veröffentlichungen des Nibelungenlieds durch Johann Jakob Bodmer und Christoph Heinrich Müller, erste Nibelungenillustrationen von Johann Heinrich Füssli.1 Danach folgten und folgen noch immer eine fast unüberschaubare Anzahl von Illustrationen (Bilder, Grafiken, Holzschnitte, Fresken), die teilweise in der Literatur beschrieben sind. Den Anfang machte König Ludwig II. von Bayern, in dessen Auftrag der Hoffotograf Joseph Albert die Nibelungenfresken in der Münchener Residenz ablichtete und anschließend in einem Buch veröffentlichte.2 Spätere Schriften bieten eine teils ausführliche Rezeption von Werken der Bildenden Kunst.3,4 Einen umfassenden Überblick erhält man durch das Buch von Wolfgang Storch,5 in dem auch einige Skulpturen beschrieben werden. Werke der Bildhauerei finden sich in größerem Umfang aber erst in dem mystisch gestalteten Buch von Gerald Axelrod.6 Im vorliegenden Beitrag werden Werke der Bildhauerei zum Thema Nibelungenlied in Orten an Rhein und Donau vorgestellt (Abb.1). Abb. 1: Spuren der Nibelungen Der geografische Anfang des Nibelungenlieds liegt in Xanten am Niederrhein, dem Herkunftsort von Siegfried. Touristischer Mittelpunkt sind dort allerdings nicht die Nibelungen, sondern die Römer, mit deren Hinterlassenschaften der Archäologische Park Xanten mit Römermuseum gestaltet wurde. Xanten führt daher auch den Titel „Römerstadt“. Eine Windmühle mit dem Namen Kriemhildmühle gibt es allerdings schon seit langer Zeit. Im Jahre 2000 wurde an der Mauer daneben ein Bronzerelief der lokalen Künstlerin Erika Rupert angebracht, welches Episoden und Texte aus dem Nibelungenlied zeigt (Abb. -
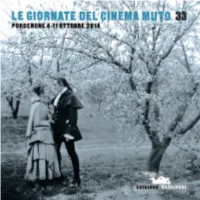
GCM2014 Catalogo Plus.Pdf
The 33rd Pordenone Silent Film Festival is dedicated to PETER VON BAGH (1943-2014) “We are the last generation which could know everything” ASSOCIAZIONE CULTURALE Italia: Aldo Bernardini; Irela Núñez Del Pozo, “LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO” Franca Farina, Emiliano Morreale, Mario Musumeci (Centro Sperimentale di Cinematografia – Soci fondatori Cineteca Nazionale); Carmen Accaputo, Davide Paolo Cherchi Usai, Lorenzo Codelli, Pozzi (Cineteca di Bologna / L’Immagine Ritrovata); Piero Colussi, Andrea Crozzoli, Luciano De Giusti, Luisa Comencini, Matteo Pavesi (Cineteca Livio Jacob, Carlo Montanaro, Mario Quargnolo†, Italiana); Fotocinema; Sergio Mattiassich Germani; Piera Patat, Davide Turconi† Luca Giuliani; Alberto Barbera, Donata Pesenti Presidente Campagnoni, Claudia Gianetto (Museo Nazionale Livio Jacob del Cinema); Alessandra Montini (Orchestra Direttore San Marco); Federico Striuli; Fulvio Toffoli; Jay David Robinson Weissberg Olanda: Lotte Belice Baltussen; Rommy Albers, Ringraziamo per la collaborazione al programma: Sandra Den Hamer, Annike Kross, Marleen Labijt, Austria: Paolo Caneppele, Oliver Hanley, Alexander Mark-Paul Meyer, Elif Rongen-Kaynakçki (EYE Horwath (Österreichisches Filmmuseum) Filmmuseum); Oliver Gee; Nico de Klerk; Bregt Belgio: Nicola Mazzanti, Clémentine De Blieck Lameris (Cinémathèque Royale de Belgique) Norvegia: Tina Anckarman, Bent Kvalvik (Nasjonal- Finlandia: Antti Alanen, Peter von Bagh biblioteket) Francia: Mahboubi Fereidoun, Eric Le Roy Regno Unito: William Barnes; Bryony Dixon, Sonia (Archives françaises