Fritz Lang: Die Nibelungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. Teil: Siegfrieds Tod Auf Der Burg Zu Xanten Im Niederland Herrscht Das Stolze Geschlecht Der Wälsungen
DAS NIBELUNGENLIED (vorgetragen auf der Anreise nach Worms von Annemarie Reinitzhuber) 1. Teil: Siegfrieds Tod Auf der Burg zu Xanten im Niederland herrscht das stolze Geschlecht der Wälsungen. Unter der Obhut von König Siegmund und seiner Frau Sieglinde wächst deren Sohn Siegfried zum stattlichen Jüngling heran. Als zukünftiger Nachfolger seines Vaters muss er sich einer umfangreichen Ausbildung unterziehen, diese soll aber noch durch Erlernen eines Handwerks ergänzt werden. Wegen seiner körperlichen Kräfte möchte er sich zusätzliche Kenntnisse über das Schmiedehandwerk bei dem berühmten Meister Mine aneignen. Als Siegfried zum ersten Mal an dem Ambos steht, schlägt er so gewaltig auf das glühende Eisen ein, dass die Splitter nur so herumfliegen und der Ambos tief in den Boden versinkt. Mine beginnt sich vor dem hünenhaften Jungen zu fürchten. Hinterlistig wie er war, überlegt er, wie er Siegfried wieder loswerden könne. Deshalb gibt er ihm den Auftrag, bei einem Köhler in einer finsteren Bergschlucht Holzkohlen zu holen. Dabei verschweigt er aber, dass dort kein Köhler sondern ein Lindwurm haust. „Der kehrt nie wieder“, meint der Schmied zu sich spottend. Singend zieht also Siegfried am nächsten Morgen bewaffnet mit einem selbstgeschmiedeten Schwert durch den Wald dahin. Zwischen immer engeren Felsenwänden erhebt sich plötzlich das furchtbare Ungetüm: „Die Doppelzunge züngelte, der Rachen hauchte heiß, der Schuppenschweifumzingelte den Wälsungsohn im Kreis!“ Mutig schwingt Siegfried sein gutes Schwert. Der erste furchtbare Schlag hat dem Lindwurm gleich eine erhebliche Wunde zugefügt, neue Schläge rauben dem grässlichen Leibe bald die Lebenskräfte. Ein letzter Hieb trennt das Haupt vom Rumpfe. Dann verbrennt er das tote Untier auf einem Scheiterhaufen, ein heißer Strom aus Blut und Fett quillt hervor. -

* Hc Omslag Film Architecture 22-05-2007 17:10 Pagina 1
* hc omslag Film Architecture 22-05-2007 17:10 Pagina 1 Film Architecture and the Transnational Imagination: Set Design in 1930s European Cinema presents for the first time a comparative study of European film set design in HARRIS AND STREET BERGFELDER, IMAGINATION FILM ARCHITECTURE AND THE TRANSNATIONAL the late 1920s and 1930s. Based on a wealth of designers' drawings, film stills and archival documents, the book FILM FILM offers a new insight into the development and signifi- cance of transnational artistic collaboration during this CULTURE CULTURE period. IN TRANSITION IN TRANSITION European cinema from the late 1920s to the late 1930s was famous for its attention to detail in terms of set design and visual effect. Focusing on developments in Britain, France, and Germany, this book provides a comprehensive analysis of the practices, styles, and function of cine- matic production design during this period, and its influence on subsequent filmmaking patterns. Tim Bergfelder is Professor of Film at the University of Southampton. He is the author of International Adventures (2005), and co- editor of The German Cinema Book (2002) and The Titanic in Myth and Memory (2004). Sarah Street is Professor of Film at the Uni- versity of Bristol. She is the author of British Cinema in Documents (2000), Transatlantic Crossings: British Feature Films in the USA (2002) and Black Narcis- sus (2004). Sue Harris is Reader in French cinema at Queen Mary, University of London. She is the author of Bertrand Blier (2001) and co-editor of France in Focus: Film -

Berkeley Art Museum·Pacific Film Archive W Inte R 2 0 18 – 19
WINTER 2018–19 BERKELEY ART MUSEUM · PACIFIC FILM ARCHIVE UNIVERSITY OF CALIFORNIA PROGRAM GUIDE 100 YEARS OF COLLECTING JAPANESE ART ARTHUR JAFA MASAKO MIKI HANS HOFMANN FRITZ LANG & GERMAN EXPRESSIONISM INGMAR BERGMAN JIŘÍ TRNKA MIA HANSEN-LØVE JIA ZHANGKE JAMES IVORY JAPANESE FILM CLASSICS DOCUMENTARY VOICES OUT OF THE VAULT IN FOCUS: WRITING FOR CINEMA 1 / 2 / 3 / 4 CALENDAR DEC 9/SUN 21/FRI JAN 2:00 A Midsummer Night’s Dream 4:00 The Price of Everything P. 15 Introduction by Jan Pinkava 7:00 Fanny and Alexander BERGMAN P. 15 1/SAT TRNKA P. 12 3/THU 7:00 Full: Home Again—Tapestry 1:00 Making a Performance 1:15 Exhibition Highlights Tour P. 6 4:30 The Cabinet of Dr. Caligari P. 5 WORKSHOP P. 6 Reimagined Judith Rosenberg on piano 4–7 Five Tables of the Sea P. 4 5:30 The Good Soldier Švejk TRNKA P. 12 LANG & EXPRESSIONISM P. 16 22/SAT Free First Thursday: Galleries Free All Day 7:30 Persona BERGMAN P. 14 7:00 The Price of Everything P. 15 6:00 The Firemen’s Ball P. 29 5/SAT 2/SUN 12/WED 8:00 The Apartment P. 19 6:00 Future Landscapes WORKSHOP P. 6 12:30 Scenes from a 6:00 Arthur Jafa & Stephen Best 23/SUN Marriage BERGMAN P. 14 CONVERSATION P. 6 9/WED 2:00 Boom for Real: The Late Teenage 2:00 Guided Tour: Old Masters P. 6 7:00 Ugetsu JAPANESE CLASSICS P. 20 Years of Jean-Michel Basquiat P. 15 12:15 Exhibition Highlights Tour P. -

Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1
* pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. These films shed light on the way Ger- many chose to remember its recent past. A body of twenty-five films is analysed. For insight into the understanding and reception of these films at the time, hundreds of film reviews, censorship re- ports and some popular history books are discussed. This is the first rigorous study of these hitherto unacknowledged war films. The chapters are ordered themati- cally: war documentaries, films on the causes of the war, the front life, the war at sea and the home front. Bernadette Kester is a researcher at the Institute of Military History (RNLA) in the Netherlands and teaches at the International School for Humanities and Social Sciences at the University of Am- sterdam. She received her PhD in History FilmFilm FrontFront of Society at the Erasmus University of Rotterdam. She has regular publications on subjects concerning historical representation. WeimarWeimar Representations of the First World War ISBN 90-5356-597-3 -

Bertelsmann and UFA Present 'Extended Version' of UFA Film Nights
PRESS RELEASE Bertelsmann and UFA Present ‘Extended Version’ of UFA Film Nights • From 22 to 25 August, early masterpieces of cinema history as well as – for the first time – a contemporary UFA movie will be screened in the open air accompanied by live music • Premiere of the digitized version of the silent movie classics “Die Liebe der Jeanne Ney” (The Love of Jeanne Ney), “Metropolis,” and “Der letzte Mann” (The Last Laugh) with new score • Live musical accompaniment by Jeff Mills, the WDR Radio Orchestra, the Neues Kammerorchester Potsdam and Deutsche Oper Berlin’s UFA Brass • Maria Furtwängler, Tom Schilling, Katharina Wackernagel and Franz Dinda introduce the UFA Film Nights • Tickets now available Berlin, July 12, 2017 – Bertelsmann and UFA will present the UFA Film Nights in Berlin for the seventh time from August 22 to 25, 2017. This year, early masterpieces of cinema history as well as a contemporary box office hit from UFA – to mark the centenary of Germany’s leading film production company – will be screened in the open air against a spectacular backdrop and accompanied by live music. The UFA Film Nights have become a cinematic-musical highlight of Berlin’s cultural summer with a dedicated stage orchestra and big screen erected for the occasion in the Kolonnadenhof on Museum Island, a World Cultural Heritage site. The international media company Bertelsmann and UFA thus continue their tradition of presenting silent movie classics in a historic architectural setting. As in previous years, more than 800 guests are expected to attend each evening. Following a reception at Bertelsmann Unter den Linden 1, Berlin, the UFA Film Nights open on August 22nd with Georg Wilhelm Pabst's “Die Liebe der Jeanne Ney” (“The Love of Jeanne Ney”) an exciting melodrama set during the October Revolution. -

Der Kinematograph (January 1922)
Der iph — Düsseldorf No. 77t» KOOP CHARLOTTENBURG BERLINER STRASSE 46 TELEPHON WILHELM 6786 * DAS EREIGNIS DER NÄCHSTEN SAISON MACBETH * REGIE: HEINZ SCHALL Fabrikanten und Patentinhaber Aktien- Oes. ,Urun(Änrumlcrireain,,,< Mannheim Der Ktneinatograph Düsseldorf Vllerdmg» muß werden. duß die Hamburger Tbeaterpreiee l*xlen Rekord uushalten. Im Hamburger 8tadttheater ist ein einiger • näßen guter Platz nicht uuter 50,— Mk. zu haben, da» Publikum ■et« »ich daher auch durchweg nur au» Kreisen der ..neuen Keielien .msammen. Bi«h«r war da» Kinn noch da» Theater de» kleinen Maniu-s. aller die»er wird »ich bald auch dic«en <a>nuü verkneifen und »ein mühsam verdiente» Geld lielaw fiir l.cben«Tnittel ausgetieii Itaß die Behörde l*»-i die»««r X«>tläge de» Kinogewerbe» -»• wenig Verständnis zeigt, die enormen Steuern nirlit ermäßigt und — nach der Harburg»;- Katastrophe mit immer soharfereu Betrieb» Vorschriften aufwartet, muß um so mehr Wunder nehmen, al» di«- Ihgierenden in Hamburg sieh fast ausschließlich aus Sozialdemo kruten zusanuucnsetzen. «lie doch angeblich ein tiefe» Verständnis &ino*%ripffr&onfrenforen für soziale Dinge Juden. Sollten unter dem Druck der Nut einzeln** Theaterbesitzer zur Schließung ihrer Betrielje gezwungen werden, acoäf;rIcTfttn hurt^ so hat der Staat nicht nur für die Arbeit »losen zu sorgen. sondern ••r ist auch mit Schuld daran, wenn die pessimistische Volksstirnmm.g günstigere Sluenutjung ber lampe immer trostloser wird. Der Mensch braucht nicht nur Bmt zun beben sondern auch uichtmaterielle Genüsse. wenn er geistig frisch ohne örhöbung ber ©fromfetlcn bleiben soll. Jedenfalls fangt das neue Jahr für da- Hamburger Theaterbesitzer nicht gerade glückverheißend an. Sie können sich höchstens damit trösten, daß ihre Kollegen im Reiche auch -<-hwer bebeutenbe ©fetgerung ber zu ringen haben. -

Transatlantica, 2 | 2006 Film and Art : on the German Expressionist and the Disney Exhibitions 2
Transatlantica Revue d’études américaines. American Studies Journal 2 | 2006 Révolution Film and Art : On the German Expressionist and the Disney Exhibitions Penny Starfield Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/transatlantica/1192 DOI : 10.4000/transatlantica.1192 ISSN : 1765-2766 Éditeur AFEA Référence électronique Penny Starfield, « Film and Art : On the German Expressionist and the Disney Exhibitions », Transatlantica [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 23 janvier 2007, consulté le 29 avril 2021. URL : http:// journals.openedition.org/transatlantica/1192 ; DOI : https://doi.org/10.4000/transatlantica.1192 Ce document a été généré automatiquement le 29 avril 2021. Transatlantica – Revue d'études américaines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Film and Art : On the German Expressionist and the Disney Exhibitions 1 Film and Art : On the German Expressionist and the Disney Exhibitions Penny Starfield Le Cinéma expressionniste allemand, La Cinémathèque française, curators : Marianne de Fleury and Laurent Mannoni, October 26, 2006-January 22, 2007. Il était une fois Walt Disney, aux sources de l’art des studios Disney, curator : Bruno Girveau, Le Grand Palais, September 16, 2006-January 15, 2007 ; Musée des Beaux- Arts, Montréal, 8 March-24 June 2007. 1 Two major exhibitions in Paris delve into the relationship between the artistic and the film worlds. The German Expressionists in Film celebrates the seventieth anniversary of the French Cinémathèque, founded by Henri Langlois in 1936. It is housed in the temporary exhibition space on the fifth floor of the recently-inaugurated Cinémathèque, which moved from its historic site at the Palais de Chaillot to the luminous building conceived by Frank Gehry on the far eastern side of the right bank. -
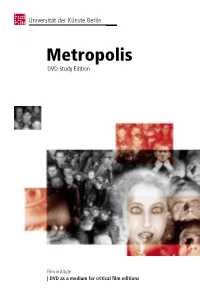
Metropolis DVD Study Edition
Metropolis DVD Study Edition Film institute | DVD as a medium for critical film editions 2 Table of Contents Preface | Heinz Emigholz 3 Preface | Hortensia Völckers 4 Preface | Friedemann Beyer 5 DVD: Old films, new readings | Enno Patalas 6 Edition of a torso | Anna Bohn 8 Le tableau disparu | Björn Speidel 12 Navigare necesse est | Gunter Krüger 15 Navigation-Model 18 New Tower Metropolis | Enno Patalas 20 Making the invisible “visible” | Franziska Latell & Antje Michna 23 Metropolis, 1927 | Gottfried Huppertz 26 Metropolis, 2005 | Mark Pogolski & Aljioscha Zimmermann 27 Metropolis – Synopsis 28 Film Specifications 29 Contributors 30 Imprint 33 Thanks 35 3 Preface Many versions and editions exist of the film Metropolis, dating back to its very first screening in 1927. Commercial distribution practice at the time of the premiere cut films after their initial screening and recompiled them according to real or imaginary demands. Even the technical requirements for production of different language versions of the film raise the question just which “original” is to be protected or reconstructed. In other fields of the arts the stature and authority that even a scratched original exudes is not given in the “history of film”. There may be many of the kind, and gene- rations of copies make only for a cluster of “originals”. Reconstruction work is therefore essentially also the perception of a com- plex and viable happening only to be understood in terms of a timeline – linear and simultaneous at one and the same time. The consumer’s wish for a re-constructible film history following regular channels and self-con- tained units cannot, by its very nature, be satisfied; it is, quite simply, not logically possible. -

Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930S European Cinema 2007
Repositorium für die Medienwissenschaft Tim Bergfelder; Sue Harris; Sarah Street Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema 2007 https://doi.org/10.5117/9789053569801 Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Bergfelder, Tim; Harris, Sue; Street, Sarah: Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema. Amsterdam University Press 2007 (Film Culture in Transition). DOI: https://doi.org/10.5117/9789053569801. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons BY-NC 3.0/ This document is made available under a creative commons BY- Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz NC 3.0/ License. For more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ * hc omslag Film Architecture 22-05-2007 17:10 Pagina 1 Film Architecture and the Transnational Imagination: Set Design in 1930s European Cinema presents for the first time a comparative study of European film set design in HARRIS AND STREET BERGFELDER, IMAGINATION FILM ARCHITECTURE AND THE TRANSNATIONAL the late 1920s and 1930s. Based on a wealth of designers' drawings, film stills and archival documents, the book FILM FILM offers a new insight into the development and signifi- cance of transnational artistic collaboration during this CULTURE CULTURE period. IN TRANSITION IN TRANSITION European cinema from the late 1920s to the late 1930s was famous for its attention to detail in terms of set design and visual effect. Focusing on developments in Britain, France, and Germany, this book provides a comprehensive analysis of the practices, styles, and function of cine- matic production design during this period, and its influence on subsequent filmmaking patterns. -

Das Nibelungenlied Lehrmaterial Ab Klassenstufe 7
Das Nibelungenlied Lehrmaterial ab Klassenstufe 7 1 Inhalt Einführung Historischer Hintergrund Inhalt des Liedes Der unbekannte Dichter Überlieferung Figuren Konflikte Das Nibelungenlied im 20. Jahrhundert Weiterführende Links Quellen Impressum 2 Einführung Liebe, Treue, Eifersucht, Betrug – der Stoff aus dem spannende Liebesfilme oder dramatische Seifenopern gemacht sind. Wer hat noch nie von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder „Titanic“ gehört? Doch auch schon vor über 800 Jahren gehörten diese Themen zur höfischen Unterhaltung. Das Nibelungenlied, eine Sage über heldenhafte Männer und liebende Frauen – oder auch hinterhältige Männer und rachsüchtige Frauen, befasst sich mit den gleichen Inhalten wie die Serien und Filme unserer Zeit. 3 Historischer Hintergrund Zwei historische Ebenen Das Nibelungenlied spielt auf zwei verschiedenen historischen Ebenen. Der Untergang der Burgunder, mit dem das Lied endet, reicht noch in die Zeit der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert zurück. Das Lied wurde aber für die höfische Gesellschaft im Mittelalter um 1200 verfasst und daher an sie angepasst. Das sieht man an der Beschreibung der Hofgesellschaft, der Lehnsbindung, des gesellschaftlichen Umfeldes, insbesondere des höfischen Zeremoniells, der Rituale und der Kleider. Das mittelalterliche Lehnswesen Das mittelalterliche Lehnswesen der Stauferzeit ist wie das germanische Gefolgschaftswesen durch ein Treueverhältnis gekennzeichnet: Ein Treueverhältnis auf Gegenseitigkeit zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann. Der Lehnsherr verpflichtete sich, dem Lehnsempfänger „Schutz und Schirm“ zu geben, während der Lehnsempfänger dem Lehnsherrn Dienste leistet, vor allem Kriegsdienst sowie Rat und Hilfe in Form verschiedener Dienste, wie z. B. auch das Halten des Steigbügels, die Begleitung bei festlichen Anlässen und der Dienst als Mundschenk bei der Festtafel. Der oberste Lehnsherr war der Kaiser oder König. Er vergab Lehen an die Fürsten. -
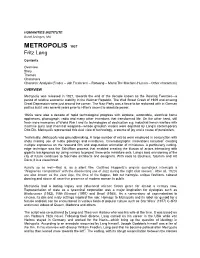
METROPOLIS 1927 Fritz Lang
HUMANITIES INSTITUTE Burak Sevingen, MA METROPOLIS 1927 Fritz Lang Contents Overview Story Themes Characters Character Analysis (Freder – Joh Fredersen – Rotwang – Maria/The Machine-Human – Other characters) OVERVIEW Metropolis was released in 1927, towards the end of the decade known as the Roaring Twenties—a period of relative economic stability in the Weimar Republic. The Wall Street Crash of 1929 and ensuing Great Depression were just around the corner. The Nazi Party was a force to be reckoned with in German politics but it was several years prior to Hitler‘s ascent to absolute power. 1920s were also a decade of rapid technological progress with airplane, automobile, electrical home appliances, phonograph, radio and many other inventions that transformed life. On the other hand, still fresh were memories of World War I and its technologies of destruction e.g. industrial trench warfare with machine guns and chemical weapons—whose ghoulish visions were depicted by Lang‘s contemporary Otto Dix. Metropolis represented this dual view of technology, a source of joy and a cause of pessimism. Technically, Metropolis was groundbreaking. A large number of extras were employed in conjunction with shots making use of matte paintings and miniatures. Cinematographic innovations included1 creating multiple exposures on the rewound film and stop-motion animation of miniatures. A particularly cutting- edge technique was the Schüfftan process that enabled creating the illusion of actors interacting with gigantic backgrounds by using mirrors to project them onto miniature sets. Lang‘s bold envisioning of the city of future continues to fascinate architects and designers. With nods to Bauhaus, futurism and Art Déco, it is a visual treat. -

Späte Stummfilme
Heinz-Peter Preußer (Hg.) Späte Stummfilme Ästhetische Innovation im Kino 1924–1930 Meinolf Schumacher Ein Heldenepos als stumme Film-Erzählung Fritz Lang, Die Nibelungen 1 Siegfried oder Artus? Ein Hel- denepos, kein höfischer Roman Am 18. Januar 1919 kündigte die Zeit- schrift Der Film an, die Produktions- firma Decla werde «unter Fritz Langs Spielleitung ein ganz neues Genre bringen», sie verriet aber noch nicht, worum es sich handeln sollte. Was Fritz Lang dann mit den Spinnen (1919/20) als Beginn eines «Abenteurer-Zyklus» vorlegte (Abb. 1), war filmisch realisier- tes ‹Abenteuer› eher im Sinne von Karl May als von Wolfram von Eschenbach oder Chrétien de Troyes (vgl. Gehler/ Kasten 1990, S. 33). Es hätte ja durchaus nahe gelegen, auf Stoffe zurückzugrei- fen, in denen das Konzept des Abenteu- ers, der Aventiure, erstmals literarisch realisiert worden ist: auf die Stoffe der 1 39 Meinolf Schumacher mittelalterlichen Artus-Epik (V. Mertens 1997). Zwar war der Begriff des ‹Abenteu- ers› zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem durch Abenteuerromane bestimmt, die oft zum weiteren Bereich der Rezeption von Coopers Lederstrumpf gehören (vgl. u. a. Klotz 1989; Best 1980; Schmied 1997; auch Seeßlen 1996), doch verwun- dert es nicht, dass die Decla 1922 zunächst einen Zyklus König Artus’ Tafel- runde nach Drehbüchern von Thea von Harbou und Fritz Lang geplant hatte (Keiner 1991, S. 84 f.). Es ist nicht ganz leicht, heute die Entscheidungsprozesse zu rekonstruieren, die letztlich dann doch zur Auswahl eines Heldenepos geführt haben, obwohl die Gattung des Artusromans hinsichtlich des Abenteuers einschlä- giger gewesen wäre. Die bisherige Fritz-Lang-Forschung, auch die neue Biografie von Norbert Grob (2014), gibt keine Antwort auf diese Frage; ja man scheint sie bisher nicht einmal gestellt zu haben.