Vorsatz Essay Gesellschaft – Analysen & Alternativen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eine Rußlandreise Im Jahr 7 Der Oktoberrevolution
632 UTOPIE kreativ, H. 201/202 (Juli/August 2007), S. 632-656 KÄTE und HERMANN DUNCKER Eine Rußlandreise im Jahr 7 der Oktoberrevolution Im Frühjahr 1924, sieben Jahre nach der Oktoberrevolution, sind Käte und Hermann Duncker in das für sie »heilige Land«, nach Sowjetrußland, gereist. Sie haben dort, zuerst in Moskau und dann 1 auf der Krim, ca. 3 /2 Monate (Hermann anschließend nochmals 6 Wochen im Kaukasus) verbracht. Von dieser Reise hat sich im Duncker-Nachlaß eine Anzahl höchst unterschiedlicher Dokumente (Briefe, Aufzeichnungen, Notizen, Termine, Adressen) erhalten.1 Es ist sicher nicht nur für den Historiker von Interesse, sich im Jahre 2007, anläßlich des 90. Jahrestages der Oktoberrevolution, mit sol- chen Dokumenten von Zeitgenossen zu beschäftigen, noch dazu, wenn es sich, wie im Fall des hier aufbereiteten Materials, um bis- her unveröffentlichte und auch nicht für eine Veröffentlichung ver- faßte Texte handelt. Käte Duncker hatte es übernommen, den Mitgliedern des engsten Familienkreises systematisch in ausführlichen Briefen über die Vorabdruck aus dem Reise zu berichten.2 Diese Briefe bilden den Hauptteil der folgenden »Jahrhundertbriefwechsel« Dokumentation, die außerdem Briefe bzw. Auszüge aus Briefen zwischen Käte und Her- mann Duncker, den Ruth einschließt, die Käte und Hermann Duncker während des Rußland- und Heinz Deutschland für aufenthaltes gewechselt haben. Die Dokumentation wird ergänzt dietz berlin zur Veröffentli- durch (vorwiegend unveröffentlichte) Texte, die lange Zeit vor der chung vorbereiten. Reise bzw. viele Jahre danach entstanden sind. All diese Texte zusammengenommen vermitteln den Nachgebore- 1 SAPMO-BArch, Berlin, nen einen recht aufschlußreichen Einblick: einerseits in die hoch- NY 4445/1; 149; 157; 233; fliegenden Hoffnungen, die sich für Menschen wie die Dunckers, die 237. -

University Microfilms
INFORMATION TO USERS This dissertation was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating' adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding o f the dissertation. -

Jahrbuch Für Forschungen Zur Geschichte Der Arbeiterbewegung September 2008 III NDZ-Gmbh
JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung September 2008 III NDZ-GmbH Inhaltsverzeichnis Werner Bramke: Eine ungeliebte Revolution. Die Revolution von 1918/1919 im Widerstreit von Zeitgenossen und Historikern ...... 5 Mario Keßler: Die Novemberrevolution in der Geschichtswissenschaft der DDR: Die Kontroversen des Jahres 1958 und ihre Folgen im internationalen Kontext ...... 38 Gottfried Oy: Ein anderes 1968. Jenseits von Partei und Spontaneismus: Das Sozialistische Büro ...... 59 Dokumentarisches Gerhard Engel: Aufzeichnungen des Kommandanten der Volksmarinedivision Fritz Radtke. November/Dezember 1918 ...... 74 Regionales Walter Schmidt: Die Breslauer Ressource, die „Ressourcen-Zeitung“, die oppositionelle Politik, die Frauen- und die Soziale Frage (1845-1848) ...... 86 2 RezensionenInhalt Biografisches Theodor Bergmann: August Thalheimer – ein kommunistischer Ketzer. Zu seinem 60. Todestag ...... 122 Hartmut Rüdiger Peter: Vor dem Vergessen bewahren: Fedor I. Dan (1871-1947) ...... 141 Herbert Böhme: Adolf Rosengarten: Du starbst als Opfer und als Opfer mahnst du ...... 153 Götz Hillig: „Sie konnten zusammen nicht kommen…“ Wie die Brüder Makarenko in den 1930er-Jahren versuchten, ihre erzwungene Trennung zu überwinden ...... 158 Bericht Martin Herzig: Kolloquium „Biographien in der Achtundvierziger Revolutionshistoriographie“ ...... 173 Leserzuschrift Fritz Zimmermann: Zu Heiner Jestrabek: Max Sievers, in: JahrBuch, 2008/II ...... 176 Buchbesprechungen Helmut Bleiber/Walter Schmidt: Schlesien auf dem Weg in die bürgerliche -

Empirical Essays on the Socioeconomic Consequences of Economic Uncertainty
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Auer, Wolfgang Research Report Empirical Essays on the Socioeconomic Consequences of Economic Uncertainty ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, No. 79 Provided in Cooperation with: Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Suggested Citation: Auer, Wolfgang (2018) : Empirical Essays on the Socioeconomic Consequences of Economic Uncertainty, ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, No. 79, ISBN 978-3-95942-047-1, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/191297 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available -

The Kpd and the Nsdap: a Sttjdy of the Relationship Between Political Extremes in Weimar Germany, 1923-1933 by Davis William
THE KPD AND THE NSDAP: A STTJDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL EXTREMES IN WEIMAR GERMANY, 1923-1933 BY DAVIS WILLIAM DAYCOCK A thesis submitted for the degree of Ph.D. The London School of Economics and Political Science, University of London 1980 1 ABSTRACT The German Communist Party's response to the rise of the Nazis was conditioned by its complicated political environment which included the influence of Soviet foreign policy requirements, the party's Marxist-Leninist outlook, its organizational structure and the democratic society of Weimar. Relying on the Communist press and theoretical journals, documentary collections drawn from several German archives, as well as interview material, and Nazi, Communist opposition and Social Democratic sources, this study traces the development of the KPD's tactical orientation towards the Nazis for the period 1923-1933. In so doing it complements the existing literature both by its extension of the chronological scope of enquiry and by its attention to the tactical requirements of the relationship as viewed from the perspective of the KPD. It concludes that for the whole of the period, KPD tactics were ambiguous and reflected the tensions between the various competing factors which shaped the party's policies. 3 TABLE OF CONTENTS PAGE abbreviations 4 INTRODUCTION 7 CHAPTER I THE CONSTRAINTS ON CONFLICT 24 CHAPTER II 1923: THE FORMATIVE YEAR 67 CHAPTER III VARIATIONS ON THE SCHLAGETER THEME: THE CONTINUITIES IN COMMUNIST POLICY 1924-1928 124 CHAPTER IV COMMUNIST TACTICS AND THE NAZI ADVANCE, 1928-1932: THE RESPONSE TO NEW THREATS 166 CHAPTER V COMMUNIST TACTICS, 1928-1932: THE RESPONSE TO NEW OPPORTUNITIES 223 CHAPTER VI FLUCTUATIONS IN COMMUNIST TACTICS DURING 1932: DOUBTS IN THE ELEVENTH HOUR 273 CONCLUSIONS 307 APPENDIX I VOTING ALIGNMENTS IN THE REICHSTAG 1924-1932 333 APPENDIX II INTERVIEWS 335 BIBLIOGRAPHY 341 4 ABBREVIATIONS 1. -

Hundsfelder Stadtblatt. Mit Den Amtlichen Bekanntmachungen 1933
Breslau \\ n l itt Ajik d en amtlichen Bekannkmachnngen Erscheinungstagei S onnabend und Zweimal w öchentlich erscheinende Zeitung lJnsertio n sgebiihr für die einspaltige klei- Mittwoch früh. — Preis pro Monat ne Zeile 15 RPf, außerhalb Hundsfeld 50 RPsg., ausschließlich Botenlohu 20 RPs., Reklamezeile 45 bezw. 60 RPs. für Hundgseld, Sacrau und Umgegend· Jnserate werden bis Dienstag bezw. bezw. Postgebühren. Freitag Mittag 1 llhr angenommen. Erstillungsort Hundsseld bei Breslau. Druck und Verlag: S. Kopjewski, Hundsfeld. Größere Jnserate einen Tag vorher. Verantwortlicher Redakteur: S. Kopjewsli, Hundsfeld 5m. 2 mittwocb. d en 29. März ms. 29- k lebte-. —- Die A briiiinngstonferenz _ . aus den 25. April vertagt. Gegen d ie (ßreuelnronaganba.i ' Noch in letzter Minute Sabotageversuche. .französisch-tschechische propaganda g egolten. In unterrichteten Kreisen wird er- bis Die Abrüstungskonferenz ist am Montagabeiid klart, daß die nationalsozialistische Be- nahm Schärssier A bwehriamvf zum 25. April vertagt worden. Der Hauptausschuß inne g u n g schon in den nächsten Tagen zu schärferen gesetz- des mit 44 Stimmen ohne Gegenstimmen einen Antrag maßigen Gegenmaßnahmen in Deutschland greifen wird, Generalberichterstatters Benesch an, in dem der englische gegen die Auslendshetze Ber- um damit die intellektuellen Urheber und Nutznießer dieser Abrüstungsplan als die Grundlage der weiteren Die R eichsregierung und ihre Vertretungen im Aus- landesverräterischen hebe, die in der Hauptsache von ehe- und Ab- handlungen unter dem Vorbehalt von Zusatz- lande haben in den letzten Tagen alles nur erdenkliche mals in Deutschland ansässigen Juden im Auslande be- änderungsanträgen erklärt wird. Die Konserenz wird getan, um den jenseits der Grenzen verbreiteten Lügen des eng- trieben wird, zu treffen. Ende April unverzüglich die artikelweise Lesung über Greuel in Deutschland entgegenzutreten, und die Was die beabsichtigte nationalsozialistische Abwehr lischen Abkommensentwurfs aufnehmen. -

1967-68 Bulletin Vol. 5 No. 2
Pl'LZER COLLEG bULLE'Ll J967-6 CAt:ALo pi'CZER coLLEGE 13ullE'CiN 1967-68 CA'CAlOG T.\.BL€ OF CONT€NTS Open Letter from the President 6 About Pitzer College 9 Community Life 15 Community Government Structure I? Admission 23 Expenses and Financial Aid 27 Curriculum 33 Distribution Requirements 33 Concentration Requirements 38 Courses of Study 53 Freshman Seminars 99 Physical Education I02 Academic Regulations I05 Faculty III Administration 119 Board of Trustees 121 Pitzer Support Groups 123 Student Roster 125 Calendar 132 Index 134 Map of the Colleges 137 OpeN L€TT€R FROM TH€ PR€Slb€NT If you are an intelligent, curious, and vital young woman, devoted At Pitzer College, you will be expected to take an active part in to the pursuit of knowledge, we at Pitzer College extend to you a the designing of your education through discussion, research and cordial invitation. experimentation. You will find your professors and advisors eager If you would choose learning through experience and experimen to work with you individually in planning a program of study to fit tation, we are interested in having you as a member of the Pitzer your interests and ambitions- whether you prefer to investigate Community. man's past through history and anthropology, explore man's pres Our educational emphasis is on individual development, and our ent and his potential through biology, sociology and psychology, or curricular focus is on the social and behavioral sciences within the begin to make a contribution of your own to man's creative achieve wide and varied field of the liberal arts. -

Gustav Von Schmollers Erinnerungen an Seine Jugendzeit in Heilbronn
Heinz Rieter Gustav von Schmollers Erinnerungen an seine Jugendzeit in Heilbronn Sonderdruck aus: Christhard Schrenk · Peter Wanner (Hg.) heilbronnica 4 Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Heilbronn 19 Jahrbuch für schwäbisch-fränkische Geschichte 36 2008 Stadtarchiv Heilbronn Gustav von Schmollers Erinnerungen an seine Jugendzeit HEINZ RIETER Der gebürtige Heilbronner Gustav Friedrich Schmoller (1838 – 1917) war im letz- ten Drittel des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der führenden – wenn nicht sogar der führende – Volkswirt in Deutschland.1 Er hatte in Tübingen Staatswissenschaften, Philosophie und Geschichte studiert und über ein national- ökonomisches Thema promoviert. Er wurde 1864 Professor in Halle, ging 1872 an die Universität Straßburg und nahm 1882 den Ruf auf einen Lehrstuhl der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität an, als deren Rektor er 1897/98 amtierte und der er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1913 angehörte. Er vertrat die Uni- versität viele Jahre im Preußischen Herrenhaus, saß im Preußischen Staatsrat und war ein hoch angesehenes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaf- ten. Und nicht zuletzt auf seine Initiative hin versammelten sich 1872 in Eisenach sozialpolitisch engagierte Gelehrte und Praktiker und gründeten den Reform- Verein für Socialpolitik, der besonders unter Schmollers Ägide wissenschaftlich wie politisch einflussreich war. Wegen seiner Verdienste wurde Schmoller 1908 geadelt. Er war ohne Frage ein bedeutender akademischer Lehrer und überaus produktiver Forscher, der in Wort und Schrift ein wissenschaftliches Programm entwickelte und vertrat, das schulenbildend wirkte. Es wurde zur Charta der soge- nannten jüngeren Historischen oder – treffender – Historisch-ethischen Schule, die die deutsche Nationalökonomie zumindest bis zu Schmollers Tod dominierte und ihr darüber hinaus zu jener Zeit im Ausland Ansehen verschaffte. -

Biographische Skizzen
BIOGRAPHISCHE SKIZZEN Ottokar Luban (Berlin) Fanny Thomas-Jezierska (18871945) Von Rosa Luxemburg zu Gramsci, Stalin und August Thalheimer Stationen einer internationalen Sozialistin Der Name Fanny Jezierska taucht in den Editionen der Briefe Rosa Luxemburgs sowie Karl Liebknechts und auch Clara Zetkins mehrmals als Adressatin von Schreiben dieser bekannten Sozialistinnen und Sozialisten auf. Doch enthalten diese Publikationen entweder überhaupt keine oder nur wenige und äußerst unvollständige, teilweise sogar unrichtige biographische Angaben zur Person F. Jezierskas.1 Wer war diese Fanny Jezierska, deren Name von drei Ausnahmen2 abgesehen im Laufe ihrer politischen Tätigkeit nie in der Öffentlichkeit auftauchte, die aber mit vielen prominenten Sozialisten und Kommunisten wie Karl Liebknecht, Käte und Hermann Duncker, Franz Mehring, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, James Thomas, Clara Zetkin, Angelo Tasca, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Jules Humbert-Droz, Dmitri S. Manuilski, Josef W. Stalin, Nikolai Bucharin, Clara Zetkin, Paul Frölich, August Thalheimer und Heinrich Brandler in Kontakt stand? Eine Frau, mit der C. Zetkin 1931 »in diesen Wochen in Gedanken lange Gespräche« führte und der sie brieflich ihr Herz über ihre eigene schwierige 1 Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 5, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Leitung der Redaktion: Annelies Laschitza und Günter Radczun. Berlin-Ost 1984 (im folgenden: R. Luxemburg, Ges. Briefe, 5), S. 34, 58, 77, 81, 84, 109, 110, 352, 387, 411 (S. 116, unklar, ob mit Frl. J. auch F. Jezierska gemeint ist). Karl Liebknecht, Gesammelte Reden und Schriften, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus, Bd. VIII, August 1914 bis April 1916, Berlin [Ost] 1966 (im folgenden: Liebknecht, Ges. Reden u. -
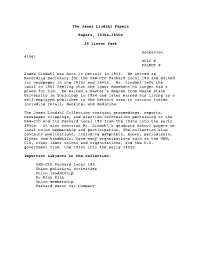
LP001061 0.Pdf
The James Lindahl Papers Papers, 1930s-1950s 29 linear feet Accession #1061 OCLC # DALNET # James Lindahl was born in Detroit in 1911. He served as Recording Secretary for the UAW-CIO Packard Local 190 and edited its newspaper in the 1930s and 1940s. Mr. Lindahl left the local in 1951 feeling that the labor movement no longer had a place for him. He earned a Master's degree from Wayne State University in Sociology in 1954 and later earned his living as a self-employed publisher in the Detroit area in various fields including retail, banking, and medicine. The James Lindahl Collection contains proceedings, reports, newspaper clippings, and election information pertaining to the UAW-CIO and its Packard Local 190 from the 1930s into the early 1950s. It also contains Mr. Lindahl's graduate school papers on local union membership and participation. The collection also contains publications, including pamphlets, books, periodicals, flyers and handbills, from many organizations such as the UAW, CIO, other labor unions and organizations, and the U.S. government from the 1930s into the early 1950s. Important subjects in the collection: UAW-CIO Packard Local 190 Union political activities Union leadership Ku Klux Klan Union membership Packard Motor Car Company 2 James Lindahl Collection CONTENTS 29 Storage Boxes Series I: General files, 1937-1953 (Boxes 1-6) Series II: Publications (Boxes 7-29) NON-MANUSCRIPT MATERIAL Approximately 12 union contracts and by-laws were transferred to the Archives Library. 3 James Lindahl Collection Arrangement The collection is arranged into two series. In Series I (Boxes 1-6), folders are simply listed by location within each box. -

Writing for Dictatorship, Refashioning for Democracy: German Women Journalists in the Nazi and Post-War Press
Writing for Dictatorship, Refashioning for Democracy: German Women Journalists in the Nazi and Post-war Press by Deborah Barton A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by Deborah Barton 2015 Writing for Dictatorship, Refashioning for Democracy: German Women Journalists in the Nazi and Post-war Press Deborah Barton Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2015 Abstract This dissertation investigates how women journalists acted as professional functionaries in support of the National Socialist dictatorship, and later, a democratic West Germany. As a project that examines the intersections between the press, politics and gender, this study makes three contributions to the study of German history. The first is for the understanding the expansiveness and malleability of what constituted politics in the Third Reich and the nature of consensus between the regime and the population. Nazi gender ideology proclaimed that women belonged only in the private sphere. Correspondingly, Nazi press authorities dictated that women write only about topics pertaining to this area. The regime labeled such news apolitical. However, soft news from a cheerful perspective was an indispensible part of Nazi media policy: it provided the façade of normalcy and morale building under Hitler. In return for their support, the state offered women journalists a status not open to most women. The study of women journalists further unravels the draw of National Socialism for those Germans the regime deemed politically, socially and racially acceptable: increased possibilities and social prestige. The second contribution relates to the study of women in the professions, which has often been overlooked. -

„Helle Panke“ E.V. Jahresprogramm 2007 Januar
„Helle Panke“ e.V. Jahresprogramm 2007 Januar Dienstag, 9. Januar 2007, 10 Uhr Seniorenklub Erwin Geschonneck zum 100. Geburtstag Referent: Rudolf Jürschik Moderation: Christian Beyer Ort: Karl‐Liebknecht‐Haus, Kleine Alexanderstr. 28 Dienstag, 9. Januar 2007, 19 Uhr Marzahner Gesellschaftspolitisches Forum LENIN. Träumer und Realist Referent: Dr. Stefan Bollinger Der Referent ist Herausgeber des im Wiener Promedia Verlag 2006 erschienenen gleichnamigen Buches. Moderation: Dr. Wolfgang Girnus Eintritt: 1,50 Euro Ort: Kulturgut, Alt Marzahn 23, 12685 Berlin Mittwoch, 10. Januar 2007, 19 Uhr Literatur und Gesellschaft Vom Ritual zur Revolte – der unbekannte Literatur‐Nobelpreisträger Wole Soyinka (Nigeria) Referent: Johannes Stockmeier Moderation: Uli Weiß Wole Soyinka, der 1986 als erster Afrikaner den Literaturnobelpreis erhielt, ist ein Mittler zwischen afrikanischem und westlichem Denken, zwischen kultureller Tradition und Moderne in Nigeria. Sein lebenslanges bürgerrechtliches Engagement, das ihn zu einer der wichtigsten unabhängigen Stimmen innerhalb und außerhalb des Landes gemacht hat, speist sich aus einer langen Widerstandstradition gegen koloniale Unterdrückung. Soyinka muss dabei die Früchte der Aufklärung nicht verwerfen, um einen eigenen, afrikanischen Weg der Emanzipation finden zu können. So sieht er anarchische und autonomistische Elemente in religiösen Mythen und Kulten vermittelt, deren säkulares Fortwirken er in sozialen Bewegungen nicht nur Afrikas, sondern auch Lateinamerikas bestätigt findet. Seiner besonderen Lesart