Radverkehrskonzept Als
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Frankfurter Norden: Mehr Als Nur Stadtrand
Arbeitskreis Nord der Frankfurter SPD Der Frankfurter Norden: Mehr als nur Stadtrand. Heimat für Frankfurterinnen und Frankfurter 14. November 2015 Positionspapier zur Weiterentwicklung der nördlichen Stadtteile zur Kommunalwahl 2016 Fortschreibung der Position der nördlichen Ortsvereine (Erstfassung 1993) Beschluss der gemeinsamen Mitgliederversammlung der nördlichen Ortsvereine vom 14.11.2015 1.Vorwort Frankfurt und sein Magistrat setzen sich endlich mit der Problematik des fehlenden und bezahlbaren Wohnraums auseinander. Nachdem die Stadtregierung dieses Problem über Jahre verschlafen und vernachlässigt hat, hat die SPD dieses offensichtliche Problem auf die Tagesordnung gesetzt. In Frankfurt fehlen ca. 25.000 Wohnungen – Tendenz steigend. Dies ist mitverursacht durch Schwarz- Grün z.B. wegen der Reduzierung der Zahl der Wohnungen am Riedberg und der Verhinderung von innerstädtischem Wohnungsbau am Osthafen. Dieser Druck auf den Wohnungsmarkt führt zu höheren Mieten und in seiner Folge zu Gentrifizierung. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum ist derzeit das drängendste Problem für das Rhein- Main-Gebiet und für eine Metropole wie Frankfurt. Der nationale und internationale Zuzug hält weiterhin an. Allerdings ist nicht nur die Anzahl der fehlenden Wohnungen zu betrachten, sondern auch die Bezahlbarkeit der Wohnungen für alle Menschen und ihre Familien, die in dieser Stadt einen Arbeitsplatz haben. Dieses Problem ist den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch im Frankfurter Norden sehr bewusst. Der überraschende Vorstoß -

Inattention in the Rental Housing Market: Evidence from a Natural Experiment
Gutenberg School of Management and Economics & Research Unit “Interdisciplinary Public Policy” Discussion Paper Series Inattention in the Rental Housing Market: Evidence from a Natural Experiment Eva M. Berger and Felix Schmidt September 6, 2019 Discussion paper number 1716 Johannes Gutenberg University Mainz Gutenberg School of Management and Economics Jakob-Welder-Weg 9 55128 Mainz Germany https://wiwi.uni-mainz.de/ Contact Details: Eva M. Berger Chair of Public Economics Johannes Gutenberg University Mainz Jakob-Welder-Weg 4 55128 Mainz Germany [email protected] Felix Schmidt Chair of Public Economics Johannes Gutenberg University Mainz Jakob-Welder-Weg 4 55128 Mainz Germany [email protected] All discussion papers can be downloaded from http://wiwi.uni-mainz.de/DP Inattention in the Rental Housing Market: Evidence from a Natural Experiment Eva M. Berger∗ and Felix Schmidty September 6, 2019 Abstract We investigate the question of whether agents on the rental housing market are inat- tentive to sizeable side costs of renting, namely commissions payable by renters to real estate agents appointed by landlords. We exploit a natural experiment created by a policy reform in Germany that shifted the payment liability for commissions from renters to land- lords. Based on panel data on offers for apartments to rent, we find evidence for substantial inattention. This has allocative as well as distributional consequences as it implies an inef- ficiently high demand for real estate agent services at the expense of renters. Acknowledgments: First of all, the authors would like to thank Immobilienscout24 for providing the main data used in this paper. -

Degussa-Areal Taunusturm/Bankenviertel
1 Innenstadtkonzept 2 Dom-Römer-Areal 3 Degussa-Areal 4 Taunusturm/Bankenviertel 5 Stadtumbau Bahnhofsviertel 6 Campus Westend 7 Senckenberganlage/Bockenheimer Warte 9 Europaviertel/Messeerweiterung Rahmenplan für die Entwicklung der Innenstadt Neubebauung eines kleinteiligen Altstadtquartiers nach Zukünftiges „MainTor-Quartier“ wird im Zuge der Stadträumliche Verdichtung und Bündelung von Hoch- Neues Wohnen & Entwicklung einer Campus-Universität „im Park“ Wandel des ehemaligen Universitätsquartiers zum Immenses Potential für die Innenentwicklung dem Abriss des Technisches Rathauses Neubebauung öffentlich zugänglich und aufgewertet häusern im traditionellen Bankenviertel Leben im Bahnhofsviertel urbanen „Kultur Campus Bockenheim“ Zukünftiger Boulevard Berliner Straße, Perspektive: Büro raumwerk Städtebauliches Modell des Dom-Römerberg-Areals Panorama „MainTor-Quartier“ (KSP Architekten) © DIC Projektentwicklung GmbH & Co.KG Taunusturm (Bildmitte) von der Neuen Mainzer Straße © Gruber + Kleine-Kraneburg Architekten „1000 Balkone“ auf den Hofseiten der Gebäude: Idee des Büros bb22 Blick auf den zentralen Campusplatz und das neue Hörsaalgebäude Modell zur überarbeiteten Rahmenplanung Sommer 2010, Entwurf: K9 Architekten Blick in das Areal „Helenenhöfe“, Visualisierung: aurealis Real Estate GmbH& Co.KG Planungsanlass: Die Frankfurter Innenstadt ist Wohn- und Arbeitsort und Planungsanlass: Nach Abriss des Technischen Rathauses soll das Areal Planungsanlass: Die als Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt Planungsanlass: Der geplante Taunusturm -
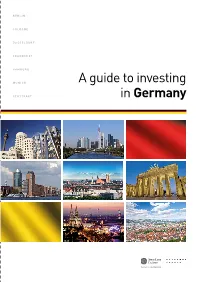
A Guide to Investing in Germany Introduction | 3
BERLIN COLOGNE DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG MUNICH A guide to investing STUTTGART in Germany ísafördur Saudharkrokur Akureyri Borgarnes Keflavik Reykjavik Selfoss ICELAND Egilsstadir A guide to investing in Germany Introduction | 3 BERLIN FINLAND ME TI HT NORWAY IG HELSINKI FL COLOGNE R 2H SWEDEN TALLINN OSLO INTRODUCTION ESTONIA STOCKHOLM IME T T GH LI DUSSELDORF F IN 0M 3 RIGA INVESTING IN GERMANY R 1H LATVIA E FRANKFURT EDINBURGH IM T T LITHUANIA GH DENMARK LI F R COPENHAGEN VILNIUS BELFAST 1H MINSK IRELAND HAMBURG DUBLIN BELARUS IME HT T LIG F IN HAMBURG M 0 UNITED KINGDOM 3 WARSAW Germany is one of the largest Investment Markets in Europe, with an average commercial AMSTERDAM BERLIN KIEV MUNICH NETHERLANDS POLAND transaction volume of more than €25 bn (2007-2012). It is a safe haven for global capital and LONDON BRUSSELS DÜSSELDORF COLOGNE UKRAINE offers investors a stable financial, political and legal environment that is highly attractive to both BELGIUM PRAGUE STUTTGART FRANKFURT CZECH REPUBLIC domestic and international groups. LUXEMBOURG PARIS SLOVAKIA STUTTGART BRATISLAVA VIENNA MUNICH BUDAPEST This brochure provides an introduction to investing in German real estate. Jones Lang LaSalle FRANCE AUSTRIA HUNGARY BERN ROMANIA has 40 years experience in Germany and today has ten offices covering all of the major German SWITZERLAND SLOVENIA markets. Our full-service real estate offering is unrivalled in Germany and we look forward to LJUBLJANA CROATIA BUCHAREST ZAGREB BELGRADE sharing our in-depth market knowledge with you. BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA SARAJEVO BULGARIA ITALY SOFIA PRESTINA KOSOVO Timo Tschammler MSc FRICS SKOPJE HAMBURG MACEDONIA International Director ROME TIRANA MADRID ALBANIA Management Board Germany PORTUGAL Lisboa (Lisbon) SPAIN GREECE Office and Industrial, Jones Lang LaSalle Setúbal ATHENS BERLIN Germany enjoys a thriving, robust and mature real estate market which is one of the DÜSSELDORF cornerstones of the German economy. -

Und Bodenschutzalarmplan
Gewässer- und Bodenschutzalarmplan für die Stadt Frankfurt am Main Stand 10/17 Herausgeber: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main Umweltamt Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde Galvanistraße 28 60486 Frankfurt am Main 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeines 1.1 Gültigkeitsbereich mit Übersichtsplan 3 1.2 Alarmschema 4 1.3 Meldebogen 5 2. Zweck des Gewässerschutzalarmplanes 2.1 Geltungsbereich 7 2.2 Umweltgefährdende/wassergefährdende Stoffe 7 2.3 Meldepflicht und Meldung 7 2.4 Zuständigkeiten 8 3. Gebiete von besonderer wasserwirtschaftlicher Bedeutung 3.1 Trinkwasserschutzgebiete 10 3.1.1 Auflistung der festgesetzten und beantragten Trinkwasserschutzgebiete 10 3.1.2 Kartenausschnitte der festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete 11 3.2 Heilquellenschutzgebiete (Auflistung) 14 3.3 Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (Auflistung) 15 3.4 Gebiete mit Trennkanalisation (Auflistung) 16 4. Verzeichnis der Meldestellen 4.1 Meldestellen in besonderen Fällen 17 4.2 Weitere in Anspruch zu nehmende Stellen 26 Stand 05/13 2 1. Allgemeines 1.1 Gültigkeitsbereich mit Übersichtsplan 1.1.1 Der Gewässerschutz-und Bodenschutzalarmplan gilt für das Stadtgebiet Frankfurt am Main 1.1.2 Stadtgebietsgrenze Main: Linkes Ufer: Main-Kilometer 22,445 - 38,385 Rechtes Ufer: Main-Kilometer 19,685 - 46,445 1.1.3 Übersichtskarte mit angrenzenden Landkreisen und Stadtgebiet Offenbach geänderter Auszug aus: Hessen 1 : 200 000 Verwaltungsgrenzenausgabe mit Gemarkung. Hrsg.: Hessisches Landesvermessungsamt 1992 Zuständige Wasser- und Bodenschutzbehörde für die jeweiligen -

RE98 RE99 Frankfurt(Main)Hbf
Fahrgastinformation RE98 Frankfurt(Main)Hbf – Kassel Hbf RE99 Frankfurt(Main)Hbf – Siegen Hbf Teilausfälle zwischen Bad Vilbel und Frankfurt Hbf im Januar 2021 Sehr geehrte Reisende, aufgrund von einem Dammrutsch zwischen Frankfurter Berg und Frankfurt West ist die Strecke in diesem Bereich bis auf Weiteres gesperrt. Die Züge der Linie RE98/99 enden/beginnen vorzeitig in Bad Vilbel. In Bad Vilbel besteht die Anschlussmöglichkeit an die S-Bahn-Linie S6. Vereinzelte Züge werden über Hanau umgeleitet, bitte beachten Sie hier die Fahrzeitverlängerung. Der geänderte Fahrplan kann in der DB-Reiseauskunft (DB Navigator, www.bahn.de, DB-Reisezentren ect.) sowie beim RMV (RMV-App, www.rmv.de, RMV-Servicetelefon ect.) und in der NVV-Fahr- planauskunft unter www.nvv.de abgerufen werden. Wir danken für Ihr Verständnis, Ihre Hessische Landesbahn Frankfurt Hbf → Kassel Hbf/Siegen Hbf Verkehrstag 05.-08.01. 05.-08.01. 09.-10.01. 09.-10.01. 05.-08.01. 05.-08.01. 09.-10.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-08.01. 05.-17.01. 05.-08.01. 05.-08.01. 05.-17.01. 05.-17.01. 05.-08.01. 11.-15.01. 11.-15.01. 16.-17.01. 16.-17.01. 11.-15.01. 11.-15.01. 16.-17.01. 11.-15.01. 11.-15.01. 11.-15.01. 11.-15.01. Zugnummer 24406 24406 24436 24436 24408 24908 24438 24410 24910 24412 24912 24414 24914 24416 24426 24916 24930 24930 24418 24918 29430 Frankfurt(M) Hbf ab 6:16 6:16 6:21 6:21 8:15 8:15 8:21 10:21 10:21 12:21 12:21 14:21 14:21 16:20 16:20 16:20 17:31 17:31 18:20 18:20 18:44 Ffm West ab | | | | | | | | | | | | | -

Projektziele Und Verkehrlicher Nutzen
Foto: Deutsche Bahn AG / Lothar Mantel Foto: Deutsche Bahn AG / Jürgen Hörstel Eigene Gleise für die S6 Projektziele und verkehrlicher Nutzen DB Netz AG | Großprojekte Mitte | Mai 2017 Für einen besseren Personennahverkehr: 1. Baustufe: Frankfurt West – Eigene Gleise für die S6 Bad Vilbel (12,6 km) ° Baurecht vorhanden ° Vorabmaßnahmen abgeschlossen ° Realisierung: 2017-2022 2. Baustufe: Bad Vilbel – Friedberg (16,9 km) ° Planfeststellungsverfahren läuft noch ° Realisierung: 2023-2028 Baukosten: 550 Mio. Euro Preisstand 2014 (1. Baustufe) bzw. 2015 (2. Baustufe) DB Netz AG | Großprojekte Mitte | 20.07.2016 Projektpartner 3 DB Netz AG | Großprojekte Mitte | Mai 2017 Das verkehrliche Problem: Zwei Gleise, zu viele Züge – und das in einer wachsenden Region ° Angebot im Regionalverkehr hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen (Vorteil für die Fahrgäste) ° Zu viele Züge in der Hauptverkehrszeit , dadurch planmäßige Warte- und Standzeiten entlang der Strecke durch Überholungen (Nieder-Wöllstadt, Bad Vilbel, Frankfurter Berg, Frankfurt West) ° Stark abweichende Fahrzeiten zwischen Frankfurt Hbf und Bad Vilbel je nach Uhrzeit und Richtung (zwischen 18 und 27 Minuten ) gemäß Fahrplan ° Kein einheitlicher 15-Minuten-Takt ° Kritische Abhängigkeiten im Personenverkehr mit gegenseitigen Behinderungen und Verspätungen Kapazitätsgrenzen der bestehenden zweigleisigen Strecke sind erreicht 4 DB Netz AG | Großprojekte Mitte | Mai 2017 So „pünktlich“ ist die S6 heute Pünktlichkeit der S6 von Friedberg Richtung Frankfurt (bis max. 2:59 Min. Verspätung) -

Bahn Linie RB40 Fahrpläne & Netzkarten
Bahn Linie RB40 Fahrpläne & Netzkarten RB40 Dillenburg Bahnhof Im Website-Modus Anzeigen Die Bahn Linie RB40 (Dillenburg Bahnhof) hat 5 Routen (1) Dillenburg Bahnhof: 02:22 - 22:31 (2) Frankfurt (main) hauptbahnhof: 04:24 - 23:38 (3) Gießen Bahnhof: 00:39 - 21:33 (4) Hanau Hauptbahnhof: 05:10 (5) Wetzlar Bahnhof: 08:40 - 10:40 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bahn Linie RB40 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bahn Linie RB40 kommt. Richtung: Dillenburg Bahnhof Bahn Linie RB40 Fahrpläne 23 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Dillenburg Bahnhof LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 02:22 - 22:31 Dienstag 02:22 - 22:31 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof Mittwoch 02:22 - 22:31 Frankfurt (Main) Westbahnhof Kasseler Straße 7, Frankfurt am Main Donnerstag 02:22 - 22:31 Bad Vilbel Bahnhof Freitag 02:22 - 22:31 Bahnhofsplatz, Germany Samstag 02:22 - 22:31 Friedberg (Hessen) Bahnhof Sonntag 08:31 - 22:31 Hanauer Straße 44, Friedberg (Hessen) Bad Nauheim Bahnhof Bahnhof Bussteig 1, Bad Nauheim Bahn Linie RB40 Info Butzbach-Ostheim Bahnhof Richtung: Dillenburg Bahnhof Stationen: 23 Butzbach Bahnhof Fahrtdauer: 91 Min Bahnhofsplatz 9, Butzbach Linien Informationen: Frankfurt (Main) Hauptbahnhof, Frankfurt (Main) Westbahnhof, Bad Butzbach-Kirch-Göns Bahnhof Vilbel Bahnhof, Friedberg (Hessen) Bahnhof, Bad Nauheim Bahnhof, Butzbach-Ostheim Bahnhof, Langgöns Bahnhof Butzbach Bahnhof, Butzbach-Kirch-Göns Bahnhof, Holzheimer Straße, Langgöns Langgöns Bahnhof, Linden-Großen-Linden Bahnhof, Gießen Bahnhof, Wetzlar-Dutenhofen Bahnhof, Linden-Großen-Linden -

C 315 Official Journal
ISSN 1977-091X Official Journal C 315 of the European Union Volume 56 English edition Information and Notices 29 October 2013 Notice No Contents Page IV Notices NOTICES FROM MEMBER STATES 2013/C 315/01 List of natural mineral waters recognised by Member States ( 1 ) . 1 2013/C 315/02 Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regu lation (EC) No 1857/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regu lation (EC) No 70/2001 . 74 2013/C 315/03 Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regu lation (EC) No 800/2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General Block Exemption Regulation) ( 1) . 76 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2013/C 315/04 State aid — Germany — State aid No SA.29338 (2013/C-30) (ex 2013N-504) — Increase of the second-loss guarantee for HSH Nordbank AG — Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) TFEU ( 1 ) . 81 Price: 1 EN EUR 4 ( ) Text with EEA relevance 29.10.2013 EN Official Journal of the European Union C 315/1 IV (Notices) NOTICES FROM MEMBER STATES LIST OF NATURAL MINERAL WATERS RECOGNISED BY MEMBER STATES (Text with EEA relevance) (2013/C 315/01) List of natural mineral waters recognised by Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, -

Nord | Grün | Frankfurt Harheim - Nieder-Erlenbach - Nieder-Eschbach Lebensqualitität Im Frankfurter Norden
Erlenbacher Grüne für den Ortsbeirat: zukunftsorientiert - weltoffen - fair Kommunalwahl 2021 14. MärzNord | Grün | Frankfurt Harheim - Nieder-Erlenbach - Nieder-Eschbach Lebensqualitität im Frankfurter Norden Natur und Grünflächen erhalten. Klimawandel stoppen. Grünzüge im Frankfurter Norden schützen wir. Sie fördern die Entstehung von Kaltluft und halten das Regenwasser zurück. Bauen intelligent, ökologisch und sozial. Entsiegeln ist besser als Versiegeln. Klimaschutz und sparsamer Umgang mit Flächen sind Pflicht beim Bauen, nicht Kür. Leerstehender Wohnraum muss schnell und flexibel wieder genutzt werden. Nachhaltige ökologische Landwirtschaft. Artenvielfalt erhalten. Treffen Sie uns: Gesunde regionale Produkte umweltschonend und nachhaltig erzeugt: das schützt die Böden, die Natur und erhält die Artenvielfalt. Samstag, 20. Februar 2021, 11:00 - 12:00 Uhr: digitaler Wahlstand Wir stellen uns und unsere Ziele für Nieder-Erlenbach vor. Vorfahrt für emissionsfreie Mobilität. Sichere und schnelle Sie stellen Ihre Fragen! Einwahllink ab 19.2. auf unserer Internetseite (s.u.) Radwege. Infrastruktur für E-Autos und Carsharing. Alle Stadtteile müssen untereinander, in die Stadtmitte und ins Umland Samstag, 06. März 2021, 09:00 - 12:00 Uhr: Wahlstand mit sicheren und schnellen Radwegen vernetzt sein. Mehr Ladestationen, live, mit Abstand und Maske Alt-Erlenbach 35 Car-Sharing-Angebote und Verleih von Lastenrädern. Hier gibts Samen für Bienenweide-Aussaat und vieles mehr! 11:00 - 12:00 Uhr: Thomas Odemer und Julia Frank Wo Busse, Bahnen, Rad- und Fußverkehr sich kreuzen... (Vorsitzende des Stadtelternbeirats), unsere nord-grünen Die Omega-Brücke in Berkersheim ist dringend, damit nach Wegfall der Kandidat*innen für die Stadtverordnetenversammlung und Bahnschranke 2022 der Norden nicht von der City abgeschnitten wird. Expert*innen zum Thema Schule und Digitalisierung. -

Official Journal C 225 Volume 40 of the European Communities 24Juiyl »»7
ISSN 0378-6986 Official Journal C 225 Volume 40 of the European Communities 24juiyl »»7 English edition Information and Notices Notice No Contents page I Information Commission 97/C 225 / 01 Ecu 1 97 /C 225 /02 Average prices and representative prices for table wines at the various marketing centres 2 97/C 225 /03 Prior notification of a notified concentration (Case No IV/M.927 — Stet/ Get/Union Fenosa) ( l ) 3 97/C 225 /04 Forward programme for steel for the second half of 1997 and for 1997 as a whole (') 4 97/C 225 /05 Invitation for the submission of applications for an exploration licence for hydro carbons in block A10 (') 17 97/C 225/06 Invitation for the submission of applications for an exploration licence for hydro carbons in block Q4 (') 17 97/C 225/07 Invitation for the submission of applications for an exploration licence for hydro carbons in block A13 (') 18 97/C 225 / 08 Invitation for the submission of applications for an exploration licence for hydro carbons in block G7 (') 18 97/C 225 /09 State aid — C 37/97 (ex NN 34/97) — Greece 19 97/C 225 / 10 List of natural mineral waters recognized by Germany ( 4 ) 22 97/C 225 / 1 1 List of natural mineral waters recognized by the United Kingdom (*) 33 97/C 225 / 12 List of natural mineral waters recognized by Greece ( x ) 35 EN I 2 (') Text with EEA relevance (Continued overleaf) Notice No Contents (continued) page 97/C 225 / 13 List of natural mineral waters recognized by Italy (') 37 97/C 225 / 14 List of natural mineral waters recognized by Spain (') 39 97/C 225 / 15 List of natural mineral waters recognized by Belgium (') 39 97/C 225/ 16 List of natural mineral waters recognized by Portugal (') 40 EN (*) Text with EEA relevance 24 . -

Wetteraukreis | 10E Teilausgabe
Fahrplan Gültig ab 13. Dezember 2020 2021 Wetteraukreis | 10E Teilausgabe A Schienenverkehr D Busverkehr R Bedarfsverkehr (ALT) Preis: 0,50 € Preis: 2,50 € Gesamtausgabe 10A – E Preis: 1 Rhein-Main-Verkehrsverbund Vorspann, Service und Informationen 4 Gesamtlinienverzeichnis Wetteraukreis 8 Vorwort des RMV 9 Vorwort der VGO 10 Neuigkeiten • Änderungen zum 13.12.2020 12 Adressen • Ansprechpartner 14 RMV-Fahrkarten 18 RMV-Preislisten 26 Anruf-Linien-Taxi (ALT), Anruf-Sammel-Taxi (AST) & Kleinbus (KB) – Beförderungs- & Tarifbestimmungen 27 Barrierefrei reisen 28 Fahrplanmedien und ihre Benutzung 132 Kalender • Bestellservice • Inserentenverzeichnis Fahrpläne 32 RB34 Glauburg-Stockheim – Nidderau – Bad Vilbel – Frankfurt („Niddertalbahn“) 40 RB46 Gießen – Nidda – Glauburg-Stockheim – Gelnhausen („Lahn-Kinzig-Bahn“) 50 RB49 Gießen – Friedberg – Nidderau – Hanau 60 FB-01 Altenstadt – Florstadt – Friedberg 62 FB-20 Wenings – Ortenberg – Stockheim ( – Büdingen) 66 FB-21 Gedern – Hirzenhain – Ortenberg – Stockheim – Büdingen (Anruf-Linien-Taxi) 68 FB-22 Gedern – Hirzenhain – Ortenberg – Stockheim – Büdingen 72 FB-23 Büdingen – Wolf – Kefenrod – Wenings – Gedern 76 FB-24 Büdingen – Kefenrod – Böß-Gesäß – Gedern 84 FB-40 Büdingen – Friedberg – Bad Nauheim 86 FB-41 (Höchst – ) Altenstadt – Düdelsheim – Büdingen 90 FB-42 Altenstadt – Limeshain – Büdingen 96 FB-43 (Hammersbach – ) Limeshain – Lindheim – Büdingen 98 FB-44 (Ronneburg – ) Diebach a.H. – Büdingen Der Gesamtlinienplan für die Landkreise Gießen, Vogelsberg und Wetterau ist bei der VGO kostenlos