Rassismus Als Leichenschändung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
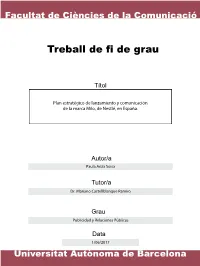
Treball De Fi De Grau
Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor/a Tutor/a Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi de Grau: Autor/a: Tutor/a: Any: Titulació: Paraules clau (mínim 3) Català: Castellà: Anglès: Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules) Català: Castellà: Anglès Universitat Autònoma de Barcelona TRABAJO DE FIN DE GRADO Plan estratégico de lanzamiento y comunicación de la marca Milo, de Nestlé, en España. Autora: Paula Ariza Soisa Tutor: Dr. Mariano Castellblanque Ramiro Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Autónoma de Barcelona 1 de junio de 2018 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. Pág.1 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................ Pág.2 2.1. Justificación ........................................................................................................................ Pág.2 2.2. Objetivos ........................................................................................................................... Pág.2 2.3. Metodología ....................................................................................................................... Pág.3 3. CONTEXTO GENERAL ....................................................................................................................... -

El Cacao Venezolano En El Mercado Mundial: Situación Actual Y Perspectivas
EL CACAO VENEZOLANO EN EL MERCADO MUNDIAL: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS Rafael Cartay "Elaborar un gran producto no es cosa fácil: he sacrificado mucho para privilegiar todas las calidades posibles, puesto que lo bueno no acepta la mediocridad" "La enología y el arte del chocolate poseen más afinidades de lo que uno pudiera creer. ¿No habla uno, acaso de crudos de cacao como si se tratara de cepas cuya mejor mezcla producirá el buen vino? Vea esos Venezuela, Ecuador y Trinidad, esos Sumatra, Madagascar o Côte d'Ivoire. Los unos son refinados, elegantes, perfumados, los otros son más fuertes, más ácidos, más amargos. Todo buen chocolate es una mezcla de cacaos diferentes, con una base generalmente africana para afinar el producto final, todo, al fin de cuenta, es una cuestión de dosificación". "No es por el azar que florecen sobre los mostradores de las chocolaterias y sobre los estuches tabletas de nombres con resonancias exóticas, Quito, Caracas y Guayaquil, Caribes y Guanaja. Es como un retorno de las fuentes del verdadero Chocolate". Citas de: Robert Linxe (1992) 1 EL CACAO VENEZOLANO EN EL MERCADO MUNDIAL: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS RAFAEL CARTAY INFORME FINAL PROYECTO CONICIT 96001539 AGENDA CACAO OCTUBRE, 1999 2 PRIMERA PARTE........................................................................................................................................... 7 I.1 LA PLANTA DEL CACAO........................................................................................................................ 8 I.2. ORÍGENES -

Picking Over the Bones. Amalie Dietrich and Colonial Queensland
DOI: 10.35515/zfa/asj.3334/201920.14 Australian Studies Journal Comments (online only) Zeitschrift für Australienstudien 33/34 — 2019/2020 Raymond Evans Picking Over the Bones Amalie Dietrich and Colonial Queensland [Comment on Stefanie Affeldt and Wulf D. Hund: From ‘Plant Hunter’ to ‘Tomb Raider’. The Changing Image of Amalie Dietrich] Amalie Dietrich was clearly an outstanding pioneer naturalist-collector of plants, corals, shells, insects, spiders, fish, reptiles, birds, mammals and so on, contin- ually lighting, as she wrote, ‘upon treasures that no-one has secured before me’ along the colonial Queensland coastal stretch from Brisbane to Bowen.1 This is beyond dispute. During her nine year sojourn from August 1863 until February 1872, she collected possibly 20-25 000 species of flora and fauna new to Western science and had plants, moss, algae, wasps and a butterfly named after her.2 It is also beyond dispute that she assembled a small array of photographs, material possessions and human remains (specifically skeletons and skulls) of Queensland Aboriginal people. Her ethnographic efforts were comparatively modest though significant and enduringly controversial. In Brisbane, from 1863 to 1865 and Rockhampton from 1866 to 1867, she obtained and dispatched ‘some of Queensland’s first extant [...] photographs’ of Aborigines to the Museum Godeffroy in Hamburg – fifteen studio portraits taken in Brisbane and four in Rockhampton.3 Later, mainly while in Bowen, North Queensland from 1869 to 1872, she sequestered more than 130 items of former Aboriginal ownership, mostly weapons, tools and implements, which were then consigned to Germany as artefacts.4 It was here in tropical Bowen, however, that she first alluded to obtaining the bones of deceased Aboriginal people in a letter to her daughter, Charitas, written on 20 September 1869. -

Reflections on Borneo Studies, Anthropology and the Social Sciences
Borneo and Beyond: Reflections on Borneo Studies, Anthropology and the Social Sciences Victor T. King Working Paper Series 3 Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam Gadong 2013 1 Editor-in-chief, Working Paper Series Prof. Dr. Victor T. King, Eminent Visiting Professor, Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam Editorial Board, Working Paper Series Prof. Dr. Lian Kwen Fee, Professor Sociology/Anthropology, Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam. Dr. Paul Carnegie, Senior Lecturer, Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam. Dr. Robina Mohammad, Senior Lecturer, Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam. Author Prof. Dr. Victor T. King, Eminent Visiting Professor, Institute of Asian Studies, Universiti of Brunei Darussalam. Contact: [email protected]; [email protected] List of IAS Working Papers Working Paper No 1 King, Victor T., Culture and Identity: Some Borneo Comparisons. Gadong: Institute of Asian Studies-Universiti Brunei Darussalam 2013 Working Paper No 2 Evers, Hans-Dieter and Solvay Gerke: Local Knowledge and the Digital Divide: Focus on Southeast Asia. Gadong: Institute of Asian Studies-Universiti Brunei Darussalam 2013 Working Paper No 3 King, Victor T., Borneo and Beyond: Reflections on Borneo Studies, Anthropology and the Social Sciences. Gadong: Institute of Asian Studies-Universiti Brunei Darussalam 2013 The views expressed in this paper are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Institute of Asian Studies or the Universiti Brunei Darussalam. © Copyright is held by the author(s) of each working paper; no part of this publication may be republished, reprinted or reproduced in any form without permission of the paper’s author(s). -

The Evolution of Conguitos: Changing the Face of Race in Spanish Advertising
The Evolution of Conguitos: Changing the Face of Race in Spanish Advertising ___________________________________ DIANA Q. PALARDY YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY Conguitos, which are chocolate-covered peanuts that are wildly popular in Spain, derive their namesake from citizens of the Congo, who should officially be called congoleños in Spanish. The name Conguitos has remained the same for more than five decades; however, its advertising campaign has undergone substantial changes. Whereas the original Conguitos were caricatures of spear-wielding African natives, modern-day Conguitos are anthropomorphic blobs that lounge around swimming pools in an atmosphere of fun and leisure. Even though the advertisers have gradually disassociated the product from its “primitive”1 origins, they continue to benefit from the nostalgia generated by the original name and logo. In fact, in 2010 the marketing director of this product stated: “el negrito del Congo histórico . es algo que está intrínsincamente dentro de los españoles” (“Puro chocolate” n.p.). The purpose of this investigation is to analyze how the marketing of Conguitos has evolved from its inception in 1961 until the present and to gauge the degree to which this reflects changes in Spaniards’ perceptions of African identities. This study also raises a number of other questions that will be touched upon: Why would something so incredibly foreign like the icon of the Conguitos be considered intrinsically Spanish? What are the roles of post-colonialism and the cultural politics of consumption in these advertisements? Are acts of cultural cannibalism, or assimilating icons associated with foreign cultures, driven by an underlying imperialistic impulse? In recent decades, the increase in the number of articles that examine representations of race and immigration in Spanish cinema and literature reflects the growing interest in this field.2 This critical attention has even extended to alternate forms of media such as news reports and posters for cultural festivals, as found respectively in studies by Teun A. -

A Fiji Bibliography (Including Rotuma and Rabi)
A Fiji Bibliography (including Rotuma and Rabi) © 2016-2021 Roderick Ewins PhD Last updated 2 September 2021 This list of over 4,500 entries is built on the base of my research bibliography developed over 40 years. I make no claim that it contains everything ever written concerning Fiji—such a task must rest with tools like Google and Ecosia. This should be used in conjunction with the Contents Lists for the Fijian Society and Domodomo, as well as the Fiji Tourism Bibliography, all on this website. They contain references not in this bibliography. I am happy to receive suggestions about important works (particularly books) that have been omitted. Please contact me with details. This work is copyright and as an entity it MAY NOT BE PUBLISHED ELSEWHERE in any form in whole or in part without explicit written permission from Rod Ewins. 1843-1898. "Fiji articles/illustrations." In The European Mail: a monthly summary of news for Australia and New Zealand. London: Monthly, but between 1880-83 fortnightly. 1845. "Feejee section of a book review of Wilkes: United States Exploring Expedition”. The Times, London. May 15. p.7 (of 12). 1875. "Introduction [and other notes on Fiji]". In The Argus, Melbourne. Wed.27 Jan. 1,2,3,4. http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/11511222/239693 1876. "Our Land Law". In The Fiji Argus, Levuka. 10 Jun. (Reprinted from London Daily News, 9 April.) 1877a. "Editorial [comments on Fijian labour, Governor Gordon's policies, removal of capital from Levuka to Suva, etc.]". In The Fiji Argus, Levuka. Fri 6 Jul. -
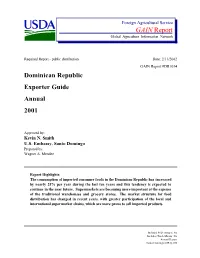
GAIN Report Global Agriculture Information Network
Foreign Agricultural Service GAIN Report Global Agriculture Information Network Required Report - public distribution Date: 2/11/2002 GAIN Report #DR1034 Dominican Republic Exporter Guide Annual 2001 Approved by: Kevin N. Smith U.S. Embassy, Santo Domingo Prepared by: Wagner A. Mendez Report Highlights: The consumption of imported consumer foods in the Dominican Republic has increased by nearly 25% per year during the last ten years and this tendency is expected to continue in the near future. Supermarkets are becoming more important at the expense of the traditional warehouses and grocery stores. The market structure for food distribution has changed in recent years, with greater participation of the local and international supermarket chains, which are more prone to sell imported products. Includes PSD changes: No Includes Trade Matrix: No Annual Report Santo Domingo [DR1], DR GAIN Report #DR1034 Page 1 of 21 EXPORTER GUIDE TO THE CONSUMER FOOD MARKET IN THE DOMINICAN REPUBLIC 1. MARKET OVERVIEW The sustained economic growth of the Dominican Republic has brought about a substantial growth in food demand in recent years, resulting in greater opportunities for US suppliers. Imports from the United States represented 50% to 56% of food imports. The consumption of imported consumer foods has increased by nearly 25% per year during the last ten years and this tendency is expected to continue in the near future. North American culture has significantly influenced the Dominican consumer habits both because more than one million Dominicans live in New York City and other locations, and the influence from cable TV, music, movies and other American traditions that have been incorporated, such as Thanksgiving and Halloween. -

A Contrapuntal Reading of Doctor Wooreddy's Prescription for Enduri
“Num come; they see what they want; they take it.” – A Contrapuntal Reading of Doctor Wooreddy’s Prescription for Enduring the Ending of the World Sari Lilja University of Tampere Faculty of Communication Sciences Master’s Programme in English Language, Literature and Translation Master’s thesis August 2017 Tampereen yliopisto Viestintätieteiden laitos Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot LILJA, SARI: “Num come; they see what they want; they take it.” – A Contrapuntal Reading of Doctor Wooreddy’s Prescription for Enduring the Ending of the World Pro gradu –tutkielma, 67 sivua Elokuu, 2017 Tutkielmassani tarkastelen Mudrooroo Naroginin kirjaa Doctor Wooreddy´s Prescription for Enduring the Ending of the World. Kirja kuvaa Tasmanian aboriginaalien joukkotuhoa vuosien 1829 ja 1842 välisenä aikana keskittyen erityisesti yhden aboriginaalimiehen, Wooreddyn kokemuksiin. Tarkastelen kirjaa jälkikoloniaalisten teorioiden näkökulmasta. Lähtökohtana ovat erityisesti Edward Saidin teoriat, joista keskeisin on kontrapuntaaliluenta. Kontrapuntaaliluenta tarkoittaa, että lukija ottaa yhtäaikaisesti huomioon sekä imperialismin vaikutukset, että imperialismin vastustuksen vaikutukset. Lukijan on siis pidettävä mielessä myös ne hiljaiset ryhmät, kuten alkuperäisasukkaat, jotka ovat perinteisesti jääneet marginaaliin. Koska väitän, että kirja on tarkoitettu vastakertomukseksi perinteiselle, länsimaiselle historialle, ja että se pyrkii antamaan äänen niille, jotka ovat jääneet traditionaalisessa historiassa pimentoon, olen peilannut kirjan -
Stingray in the Sky
Stingray in the sky Astronomy in Tasmanian Aboriginal Culture and Heritage Michelle Kathryn Holly Kendall Gantevoort A thesis submitted to the Nura Gili Indigenous Programs Unit at the University of New South Wales in partial fulfilment of the requirements for the Honours degree of Bachelor of Arts October 2015 Word Count: 24,667 Originality Statement I hereby declare that this submission is my own work and, to the best of my knowledge, it contains no material previously published or written by another person, nor material which to a substantial extent has been accepted for the award of any other degree or diploma at UNSW or any other educational institution, except where due acknowledgment is made in the thesis. Any contribution made to the research by others, with whom I have worked at UNSW or elsewhere, is explicitly acknowledged in the thesis. I also declare that the intellectual content of this thesis is the product of my own work, even though I may have received assistance from others on style, presentation and linguistic expression. Signed: Date: 2 Abstract Aboriginal peoples of Tasmania lived in isolation with the environment for thousands of years, the canopy of stars a central presence on the daily and spiritual lives of Tasmania. With the arrival of European settlers, the (astronomical) cultures of Tasmanian Aboriginal people were interrupted and dispersed. Fragments can be found scattered in the ethnographic record throughout the nineteenth century. This thesis uses historical textual analysis to draw these fragments from the record and organize into a database. The interrogation of this data through linguistics, comparative research and Stellairum reveal a complexity of sky knowledge evident between the nine language groups of Tasmania. -
2Nd Collection Individuals and Institutions
People and institutions that contributed to Pitt-Rivers' private collection after 1880 Surnames N-Z Note that this list is much longer than that that pertains to the founding collection although it was amasses over a slightly shorter amount of time (around 20 years). This is entirely due to the improved record-keeping that Pitt-Rivers instituted for this collection, that which is contained in his catalogue now held by the Cambridge University Library. Note that any individual or instituion that also contributed to the founding collection of the Pitt Rivers Museum is listed in a separate file. [See other files for surnames A-M] NAME SHORT BIOGRAPHY DATES Pottery in Staffordshire, famous for its porcelain. Worked by several New Hall pottery c.1781-1835 partners at Shelton from c.1781-1835 de Nadaillac, Jean François Albert Marquis de Nadaillac, French archaeologist 1818-1904 Du Pouget Noble and Dealers of 4 Cullum Street, London, nothing further is known Unknown company Dealer, based in Oxford. Born in Bettow, Rutland and aged 70 in Ogden, William ?1831-? 1901. He is described in the 1901 census as 'dealer in works of art'. Nothing is known of this Japanese carver whose name might not be Oka accurately given. According to the catalogue his dates were 1760- 1760-1830 1830 Enamel manufacturer and creator, based in Moscow. His firm was founded in Moscow in 1853. '. He was the first Russian silver maker Ovchinnikov, to embrace the pan-Slavic revival style, and in 1868 nearly two Firm 1853-1916 Pavel Akimovich decades before Fabergé, the firm received the title of court supplier, allowing it to incorporate the imperial double eagle in its trademark.' Ovonramwen Ovonramwen Nogbaisi was the Oba of the Kingdom of Benin before 1888-1914 Nogbaisi the British Punitive Expedition, which sent him into exile Dealer of 11 Elizabeth Street, Eaton Square, London; nothing known Owen, W. -

Estudio Desde Una Perspectiva Lingüística Y Sociocultural Para La Traducción De Marcas Comerciales a La Lengua China
DOCTORADO EN TEORIA DE LA TRADUCCIÓN DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA Y SOCIOCULTURAL PARA LA TRADUCCIÓN DE MARCAS COMERCIALES A LA LENGUA CHINA TESIS DOCTORAL DE HUANG, TSUI-LING DIRECTOR: Dr. SEÁN GOLDEN A mis padres y familia 1 “La marca comercial ha demostrado ser una potente herramienta para aumentar el beneficio o el mercado a menudo para ambas partes. Sin embargo, en China se debe reflexionar por lo menos tres o cuatro veces antes de incorporar la marca comercial.” “Al traducir se debe considerar el nombre internacional y el contenido básico de la marca. Para ello es importante trabajar con profesionales que estén capacitados y conozcan ambas lenguas locales.” Stefan Ronnquist (2005) Determinar el nombre comercial de Tu Marca en China—Director de Operaciones/Director Creativo de la Agencia de Marketing y Publicidad The Tomorrow Group con sede en Hong Kong 2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN................................................................................... 7 PROPÓSITOS ......................................................................................... 7 METODOLOGÍA ................................................................................... 9 AGRADECIMIENTOS......................................................................... 12 1. Aspectos generales de la traducción al idioma chino.................... 15 2. Los principios básicos de la traducción......................................... 19 2.1 Los tres principios de Yan Fu: -

2,95 Herbal Teas & Co the Coffee Shop Funcional Juices Smooth & Shake Drinks Sandwiches & Rolls More Eggs English Br
SANDWICHES & ROLLS HUEVOS & Co. 10-13 17-20 vg THE COFFEE SHOP CHURROS WITH We have Non fat, lactose free and soy milk BUTTER & JAM 1,95€ gf vg BENEDICT EGG à la PASAPALO gf CHOCOLATE or NUTELLA ESPRESSO, SMALL BLACK OR CORTADO 1,60€ TOMATO & OLIVE OIL 2,50€ gf vg lf 2 poached eggs with warm hollandaise sauce, 2,95€ HAM & CHEESE gf spinach, chia seeds and brioche bread.. WHITE COFFEE / AMERICANO 1,80€ Extra shot +0,75€ with turkey and Edam 3,50€ GO WITH YOUR DESIRE gf CARAMEL FRAPPE TUNA & TOMATO lf AVOCADO: full 9,95€ - half portion 5,95€ vg Tuna, tomate slices, lettuce and a biiit of mayo 3,95€ With homemade toffee and whipped cream 4,50€ BACON Halal beef: full 9,95€ - half portion 5,95€ VEGGIE gf vg lf DECAF 1,85€ Spinach, tomato, boiled egg & mayo 3,95€ TURKEY: full: 8,95€ - half portion 4,95€ XL MUG 2,95€ Gluten free bread +1,35€ gf ENGLISH BREAKFASTS CAPPUCCINO 2,35€. Whipped cream + 0,50€ FUNCIONAL JUICES KIDS lf LATTE 2,85€ 2,85€ English sausage, hash brown, baked beans 4,95€ FRESH ORANGE JUICE gf vg lf CARAMEL OR NUTELLA LATTE 3,50€ VEGGIE BREAKFAST vg lf FRESH ORANGE JUICE XL 3,95€ gf vg lf 2 eggs, hash brown, mushrooms, tomato, spinach, GLASS OF MILK 1,50€ baked beans & toast 7,95€ FRESH SUMMER gf vg lf Orange, lemon, fresh mint & brown sugar 4,60€ COLA CAO (chocolate milk) 1,80€ SMALL lf English bacon, fried egg, english sausage, baked PURPLE POWER gf vg lf Fresh beetroot, carrot, orange, lemon, apple HERBAL TEAS & CO beans and toast 5,95€ & ginger 4,60€ PASAPALO TEA MEDIUM lf GREEN LOVE DETOX gf vg lf Green tea, fresh mint,