Regierungsbezirk Detmold. Band
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stadt Und Dorf Im L(Reis Lippe in Landesforschung, Landespflege
28 In F :l v2 E H E E Stadt und Dorf im l(reis Lippe E & in Landesforschung, ts Landespflege und Landesplanung z ts Vorträge auf der Jahrestagung 0Fr 6 der Geographischen Kommission N ts in Lemgo 19t0 ts E td aI LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen Schriftenreihe der Geographischen Kommission im Provinzialinstitut ftir Westfälische Landes- und Volksforschung Landschaf tsverband Westf alen-Lippe SPIEKER LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen durch Wi Ihe lm MüIl e r - WilI e und E Ii s a b e t h B e rt e ls m e i e r 28 Stadt und Dorf im Kreis Lippe in Landesforschung, Landespflege und Landesplanung Vorträge auf der Jahrestagung der Geographischen Kommission in Lemgo 19E0 l9t1 Im Selbstverlag der Geographischen Kommission für Westfalen, Münster Bezug durch den Selbstverlag Geographische Kommission, Robert-Koch- Str. 26, 4400 Münster (Westf.). Schrifileitung: Dr. Elisabeth Bertelsmeier Erscheint gleichzeitig als Sonderveröffentlichung des Lippischen Heimatbundes e.V. Anschriften: OSt.-Dir. Dr. Fr. Brand : Birkenkampstraße fB, 4920 Lemgo . Stellvertr. Stadtdirektor Dipl.-Ing. U. F a ß h a u e r : Stadtbauamt, 4g2O Lemgo . prof. Dr. H. F. Gorki : Abt. 16 - Geographie - der Universität, 4600 Dortmund 50 . Oberkonservator Dr. U. K o r n : * Westfälisches Amt für Denkmalpflege Landschaftsverband Westfalen-Lippe -, 4400 Münster prof. Dr. W. Müller-Wille em.: Vorsitzender der Geographischen Kommission für Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 4400 Münster Druck: C. J. Fahle GmbH, 4400 Münster (Westf.), Neubrückenstraße B-ll INHALT Seite MüLLer-WiLLe, W.: Begrüßung und Eröffnung . 7 Fa$hauer, U.: Grußwort der Stadtverwaltung Lemgo I Gorkt,Ii. -

Cornelia Müller-Hisje Aus Der Kinderstube Und Wie Es Dazu Kam
Ausgabe Nr. 13 Cornelia Müller-Hisje Aus der Kinderstube und wie es dazu kam... des "Herrenmenschen" Ulrike von der Linden Dipl. Psychologin „Three Times Blue(s)“ Bettina von Uechtritz und Steinkirch www.reporter-lippe.de Anzeigen 2 Anzeigen Einigen geht es offenbar zu gut... Zugegebener Maßen war das Leben früher aufregender. Es war einmal ein Hirtenjunge. Jeden Tag aufs Gleiche brachte Früher, als man auch in Deutschland noch die Folgen eines er seine Schafe auf die saftigen Wiesen hinter dem Dorf. Krieges spüren konnte. Früher, als man noch jederzeit an Und jeden Tag langweilte er sich. „Wolf!“brüllte er einmal. einer Grippe sterben konnte. Früher, als das Fernsehen noch Dorfbewohner eilten ihm zu Hilfe. Doch sie fanden heraus, schwarz-weiß war und man auch im Winter zu Fuß zur Schule dass es ein falscher Alarm war und es keinen Wolf in der oder zur Arbeit gehen musste. Früher, als man sich darüber Nähe gab. Kurz danach überraschte der Wolf den Jungen freute, wenn es zum Geburtstag einen neuen Pullover gab, wirklich. Diesmal nahmen die Dorfbewohner die Rufe nicht der nicht bereits von 3 älteren Geschwistern getragen wurde. mehr ernst und der Wolf fraß die ganze Herde und auch den Hirtenjungen. (Diese Fabel stammt aus dem 6 Jh.v.Chr.) Und heute? Heute ist das Leben langweilig. Für viele Jungendliche liegt das größte existenzbedrohende Wollen wir alle so abstumpfen und verrohen, dass wir echte Problem darin, dass sie noch nicht das allerneuste Smartphone Hilferufe nicht mehr wahrnehmen? Ich will das nicht. Ich werde besitzen, um ein Selfie von sich und ihrem veganen Low- weiterhin einschreiten, wenn ich ein Verbrechen vermute. -

Radflyer Geschichten Ansicht.Pdf
Radtour Waldrand steht eine Schutzhütte, gegenüber ein Bauernhof. Hier biegen wir rechts ab. Kurz danach kommen wir nach Hiddesen hinein und auf den Cheruskerweg, der später zum Germanenweg wird. An der Kreu- zung mit dem Hünenweg biegen wir links ab und erklimmen den Berg bis zum Maiweg, an dem wir rechts müssen. Hier geht es flach weiter, bis wir am Ende der Straße auf die Straße zum Hermannsdenkmal treffen. Nun müssen wir uns nach links wenden und wieder kräftig in die Pedale treten, um zum Denkmal zu gelangen. Oben angekommen, ist eine Pause in der Gastronomie sicher angebracht (wie das Hermanns- denkmal über den Parkplatz erreichbar). Danach wartet auf der Denkmalstraße Richtung Vogelpark und Heiligen- kirchen eine wunderschöne Abfahrt. Aber Achtung: Hier fahren auch Autos! An der Kreuzung Denkmalstraße/Paderborner Str. (mit Ampel) geht es rechts weiter auf dem Europaradweg R1 und der BahnRadRoute nach Berlebeck. 2. Wer den Aufstieg meiden möchte, fährt nach der Kreuzung Fried- rich-Ebert-Straße links in den Unteren Weg und folgt somit der weiteren Ausschilderung R1 und der BahnRadRoute. In Heiligenkirchen biegen Anfahrt: wir nach links auf die Denkmalstraße ab und an der folgenden großen Mit dem Auto: Über die Autobahnen A 2 Ruhrgebiet – Hannover (Aus- Ampelkreuzung rechts wie unter Punkt 1 beschrieben. fahrt Bielefeld Zentrum, B 66 Richtung Oerlinghausen/Detmold und über Geschichte und In Berlebeck geht es an der Einmündung Fromhauser Straße über die A 33 (Ausfahrt Paderborn Elsen, B 1 Richtung Detmold/Hameln) die Fußgängerampel weiter auf dem R1 und der BahnRadRoute zu kommt man einfach und bequem nach Detmold. Aus allen Richtungen Geschichten den Externsteinen. -
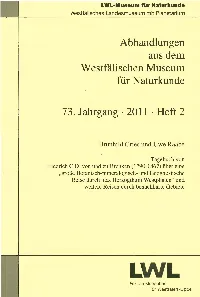
2011 ·Heft 2
LWL-Museum für Naturkunde Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 73. Jahrgang· 2011 ·Heft 2 Brunhild Gries und Uwe Raabe Tagebuch von Friedrich C.D. von und zu Brenken (1790-1867) über eine „große Botanisch-mineralogisch- und Geognostische Reise durch das Herzogthum Westphalen" und weitere Reisen durch benachbarte Gebiete LWL Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe. Hinweise für Autoren In der Zeitschrift Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde werden naturwissen schaftliche Beiträge veröffentlicht, die den Raum Westfalen betreffen. Druckfertige Manuskripte sind an die Schriftleitung zu senden. Aufbau und Form des Manuskriptes: 1. Das Manuskript soll folgenden Aufbau haben: Überschrift, darunter Name (ausgeschrieben) und Wohn ort des Autors, Inhaltsverzeichnis, kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache, klar gegliederter Haupt teil, Literaturverzeichnis (Autoren alphabetisch geordnet), Anschrift des Verfassers. 2. Manuskript auf Diskette oder CD (gängiges Programm, etwa WORD) und einseitig ausgedruckt. 3. Die Literaturzitate sollen enthalten: Autor, Erscheinungsjahr, Titel der Arbeit, Name der Zeitschrift in den. üblichen Kürzeln, Band, Seiten; bei Büchern sind Verlag und Erscheinungsort anzugeben. Beispiele: KRAMER, H. (1962): Zum Vorkommen des Fischreihers in der Bundesrepublik Deutschland. - J. Orn. 103.: 401 - 417. RUNGE, F. (1992): Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirks Osnabrück. 4. Aufl. - Aschendorff, Münster. Bei mehreren Autoren sind die Namen wie folgt zu nennen: MEYER, H„ HUBER, A. & F. BAUER (1984):„. 4. Besondere Schrifttypen im Text: fett, gesperrt, kursiv (wissenschaftliche Art- und Gattungsnamen sowie Namen von Pflanzengesellschaften), Kapitälchen (Autorennamen). Abschnitte, die in Kleindruck gebracht werden können, am linken Rand mit „petit" kennzeiclmen. 5. Die Abbildungsvorlagen (Fotos, Zeichnungen, grafische Darstellungen) müssen bei Verk!leinerung auf Satzspiegelgröße ( 12,6 x 19 ,8 cm) gut lesbar sein. -

Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße
Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße Inhaltsübersicht Tagesordnung Deckblatt und Tagesordnung 10:00 1. Begrüßung und Einführung (Birgit Rehsies, BezReg) Einblicke in das biologische Monitoring pro Planungseinheit (Ulrich Volkening, BezReg) Planungseinheitensteckbrief 2. Situation in den Planungseinheiten Defizitanalyse Istzustand (Andrea Püschel, BezReg) Karte: Ökologischer Zustand Stand der Umsetzung im Kreis Lippe (Jürgen Benning, Kreis Lippe) Karte: Gewässerstrukturgüte Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Beratungskonzepts zur Sicherung/Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer (Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle für Agrarstruktur) 3. Handlungsbedarf Übersicht Monitoringkomponenten (Birgit Rehsies, BezReg) 4. Diskussion 16:00 5. Abschluss (Birgit Rehsies, BezReg) einschließlich Kaffee- und Mittagspause 4.4 PE_WES_1300: Werre Monitoring-Komponenten nach OGewV 4.4.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit weitere gesetzlich nicht verbindlich Stoffe (D4- Liste) Hydromorphologie (Anlage 3) Gebietsbeschreibung (Wasserhaushalt, Im Werregebiet leben ca. (z.B.Mikroschadstoffe, Biozide, PSM) Durchgängigkeit, Morphologie) 279.000 Einwohner. Es ist Flussgebiet Weser etwa 437 km² groß und Bearbeitungsgebiet Ober-/Mittelweser erstreckt sich vom Teuto- Teileinzugsgebiet Weser NRW burger Wald, zwischen Planungseinheit PE_WES_1300 den Städten Oerlinghau- Bezeichnung Werre Biologie (Anlage 3, 4) ACP (Anlage 3, 6) Chemie (Anlage 7) sen und Horn Bad- Geschäftsstelle Weser NRW Fläche 437 -

Surname List
GERMANS IN ST. LOUIS SURNAME LIST Surname Hometown or Area Contact Name *Alternate Spelling Agene Quirnbach, Kusel, Rheinland-Pfalz Fred & Lois Wessel Albers Lengerich, Lingen, Hanover David Bruemmer Albrecht* Alan R. Trodus Albright Albright* Karen Pratt Albrecht Allgaier Waldkirch, Baden Darlene O'Neal Altenbrand Dave Benne Althoff Dave Benne Amrein Lucerne, Switzerland Doris Witte Eschbach Angert Biblis Elmer Borgmeyer Ankeny Lambsborn, Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate, Germany Andrew Trevor Smith Anton ? unknown Nancy Von Behren Arnecke Dave Benne Aubuchon Alan R. Trodus Auer Roβtal Wallace A. Kern Auf dem Kampe Dave Benne Augustin ? Germany Randy & Pat Baehr Austerjost Delbrück, Westphalia Karen Osborne Averbeck Mari, Recklinghausen, NordRhein-Westfalen Fred & Lois Wessel Bach Niederhone(now Eschwege),Werra-Meissner, Hesse Bonnie Schmidt Backers Bobbie Laury Backhaus* Preussen, Hannover – Hoyel Ralph Weiland Brockhaus Badde Dave Benne Baehr New Baden, IL – Mussbach Rheinpfalz Randy & Pat Baehr Baier Darmstadt, Hesse Dianne Benz Baldauf Rebecca Splain Ballaseus* Gai(t)zuhnen, Insterburg, Ostpreussen Gordon Seyffert Ballaseyus, Ballasejus Ballaseux Marienwerder, W. Preußen Gordon Seyffert Bank Adensen, Springe, Hannover Julie Briscoe Bar Dave Benne Bar vom Hassebrock Dave Benne Baral Dave Benne Barbyer Calbe, Sachsen-Anhalt Karen Goode Barlag Hanover Judith B. O'Donnell Bartels Germany Robert Remmert Bartig Netzwalde bei Bromberg, Posen, Prueßen Gordon Seyffert Bauer Bob Bauer Baumer ? Switzerland Nancy Von Behren Baumer Spenge, -

Horn-Bad Meinberg Stand März 2021
Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Horn-Bad Meinberg Stand März 2021 Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Horn-Bad Meinberg Die Karte zeigt die Risikogewässer und die Ausdehnung der Überflutung für das extreme Hochwasserereignis (HQextrem) im 2.Umsetzungszyklus 2016-2021 der HWRM-RL. Bezirksregierung Detmold Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Horn-Bad Meinberg Stand März 2021 Der Kommunensteckbrief stellt die Maßnahmenplanung zur Verminderung von Hochwasserrisiken in Ihrer Kommune dar. Die Maßnahmenplanung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der europäischen Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) in Ihrer Region. Sie wurde auf der Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziellem signi- fikantem Hochwasserrisiko, die sogenannten Risikogewässer, erarbeitet. Mithilfe der Karten erkennen Sie, wo in Ihrer Region oder Ihrer Stadt konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. Die aktuellen Gefahren- und Risikokarten und viele weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW finden Sie auf der Inter- netseite flussgebiete.nrw.de oder in den Kartendiensten elwasweb.nrw.de bzw. uvo.nrw.de. Von welchen Risikogewässern ist Ihre Kommune betroffen? Teileinzugsgebiet (TEG) Weser Flussgebiete NRW > TEG Weser Werre Wiembecke / Knochenbach Hinweis: Eine Hochwassergefährdung kann sich auch durch Gewässer ergeben, die hier nicht aufgeführt sind. Diese können in Ihrer Kommune liegen oder außerhalb. -

Erlebniskarte - Die Schönsten Ecken Im Kulturland Kreis Höxter
Erlebniskarte - Die schönsten Ecken im Kulturland Kreis Höxter Piktogramme: Klöster 13 5 Highland Games Steinheim Natur Bauernmarkt 6 Landschaftspark Kultur Emmerauen Besucher- 7 3 zentrum Abtei Städte 3 Köterberg 3 2 4 Lattbergturm Wandern Eggeturm Entrup Velmerstot 6 5 2 Hungerberg 1 Genuss Telegrafen-Tour Tonenburg 1 Westfalen 4 Culinarium 3 Sackmuseum 6 5 Kloster 5 Rad fahren Hist. Ortskern 3 1 Käsemarkt 3 Räuschenberg Schaukäserei Altenberger Höhenweg Corveyer 6 Kunstpfad Corveyer Weinberg 4 Weinhaus Echte Originale 1 3 Gut Holzhausen 4 Freilichtbühne 2 2 Motorrad Welterbe 1 Schloss Bökerhof Hist. Stadtkern 1 Corvey 5 Forum Jacob Pins Gärten und Parks 4 Park Bad Hermannsborn Rodeneckturm 8 6 Godelheimer See Weitere Tipps Driburg Therme 2 Diotima- gesellschaft 4 1 Gräflicher Park 3 2 Kaiser-Karls-Turm 2 Arboretum Hinnenburg 9 Stadt- 7 Gourmet-Tour Iburg rundfahrt 1 4 Hist. Stadtkern 5 Kletterzentrum Naturparkquellen 11 Stadtmuseum Schlosspark 10 Wehrden 5 Gierseilfähre 14 Landschaftsliege Landschaftspark/ Weidenpalais 2 Brauerei Rheder 2 62 1 Ortskern 8 Stadtkern 7 Burg Dringenberg Agathenberg 4 Weser-Skywalk Schlosspark 12 3 3 4 „Lieblingsplätze“ Würgassen Wir sind stolz auf unsere Heimat. Und weil das so ist, 7 Wildgehege 8 Schmetterlingspfad 8 möchten wir Sie gerne mit auf Entdeckungsreise zu Korbmacher- 8 Burg Herstelle 1 unseren Lieblingsplätzen im Kulturland Kreis Höxter Die HEGGE Museum 9 Abtei 9 Kloster Herstelle nehmen. Weite Flusslandschaften, tiefe Laubwälder, sanfte Hügel, imposante Klöster und historische Städte – das alles prägt die Region. Idyllisch einge- bettet zwischen Weserbergland, Eggegebirge und Teutoburger Wald, erwartet Sie ein großer Schatz an Lieblingsplätzen. Nicht immer sind dies die großen Sehenswürdigkeiten, sondern manchmal auch die kleinen und leisen Orte, die einen ganz besonderen Zauber ausüben. -

Battle for the Ruhr: the German Army's Final Defeat in the West" (2006)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2006 Battle for the Ruhr: The rGe man Army's Final Defeat in the West Derek Stephen Zumbro Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the History Commons Recommended Citation Zumbro, Derek Stephen, "Battle for the Ruhr: The German Army's Final Defeat in the West" (2006). LSU Doctoral Dissertations. 2507. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2507 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. BATTLE FOR THE RUHR: THE GERMAN ARMY’S FINAL DEFEAT IN THE WEST A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Derek S. Zumbro B.A., University of Southern Mississippi, 1980 M.S., University of Southern Mississippi, 2001 August 2006 Table of Contents ABSTRACT...............................................................................................................................iv INTRODUCTION.......................................................................................................................1 -

Aufforderung Zur Einreichung Von Wahlvorschlägen
Wahlbekanntmachung Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Landrätin/des Landrates, für die Wahlen der Mitglieder des Kreistages und für die Wahlen aus den Reservelisten am 13.09.2020 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 27.09.2020 Gemäß §§ 24 und 75 b der Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602) - SGV. NRW. 1112 - fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Unter Berücksichtigung der Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 13.03.2020 zur Durchführung von Veranstaltungen und vom 15.03.2020 zur weiteren kontaktredu- zierenden Maßnahmen sowie vom 17.03.2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 18.03.2020 hält es der Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen für dringend ge- boten, die Durchführung der Aufstellungsversammlungen bis zum Ende der Osterferien auszuset- zen. Da die Wahlvorschläge bis zum 16.07.2020 eingereicht werden könnten, bliebe für Aufstel- lungsversammlungen auch dann noch ausreichend Zeit, wenn auf eine Terminierung in den nächs- ten 4 Wochen bis zum 19.04.2020 verzichtet werde. Das Zeitfenster würde sich von jetzt 4 auf knapp 3 Monate verkürzen. Das Ministerium weist in seinem Erlass vom 19.03.2020 ausdrücklich darauf hin, dass die Durchführung von Versammlungen zur Aufstellung der Bewerber gesetzlich vorgeschrieben bleibe. Sofern sich die Corana-Krise bis zum 19.04.2020 nicht entspannen sollte, wird das Ministerum über weitere Maßnahmen informieren. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen weise ich auf Folgendes hin: 1. Einreichungsfrist Die Wahlvorschläge sind spätestens bis zum 16. -

Präsentienbuch Des Adligen Damenstifts Heerse
176 5. Index Namensverzeichnis zum Präsentienbuch (mit biographischen Angaben zu den Personen, soweit sie bisher erforscht werden konnten, und mit der topographischen Be- stimmung kleinerer Orte) und Liste einiger häufig begegnender Begriffe und Ämter. Es sind in der Internet-Übersetzung die Lemmata leicht mit dem Befehl „Suchen“ zu finden. Hillen, Joannes; Benefiziat am Paderborner Dom; einst Rektor von St. Lambertus in NH; zu seiner Memorie am 8. Okt. wird von Henr. Wippermann aus Brakel 1 rh. Gulden gegeben; (evtl. * Münster; Pfr. in Eissen 1643; immatrik. 1642 in Pb; Kat; WBM 119) 129 Krull, Henricus; geb. in NH; al. Crull; 1653 in Matrikel der Univ. Paderb.; R. von St. Dionysius, 1654 von St. Lambertus; auch B. zu Peckelsheim; schreibt 'Buch der Präsentien'; + 26.9.1687; seit 1655 Kalandsbr., Nr. 345; GKa S. 239; G S. 336, 408 126 Kapelle des hl. Laurentius; oströmische, sc. byzantinische Kapelle zu Paderborn 116 Abdes, Joannes; 1393 Viceplebanus in Buer (bei Wetter); 1406 Benefiziat des Fronleichnam-Altars; Rektor von St. Laurentius; stiftet am 5.2.1427 (NKM Nr 180), nicht 1472 (NK S. 224) sein Gedächtnis; G S. 109, 131, 142, (170) 82 Aebtissin; 0868 - c. 900; Walburgis 72 Aebtissin; 1205 - c. 1236; Gertrud 61 Altenheerse; siehe Altenherse 59, 60 Altenherse; alias Altinherise 1066 (G S. 25); 4 km nördl. Willebadessen; im Territorium des damaligen 'Herisi' wird 868 an der Nethequelle das Stift 'Herisia' gegründet, um das herum 'Neuenheerse' entsteht; G S. 9, u. a. oft 54 Herse; alias Herisi, Heresi, Herise; Herisum, Heerse, Hersse, Herze; Heese, Heze, Hirze, am meisten Herisia; Name des 868 im Gebiet 'Herisi' 177 von Bischof Luthard und seiner Schwester Walburg gegründeten adeligen Damenstifts; G S. -

Schulen Mit Einem Angebot Des Gemeinsamen Lernens Im Regierungsbezirk Detmold
Schulen mit einem Angebot des Gemeinsamen Lernens im Regierungsbezirk Detmold Schule Straße PLZ Ort Telefon E-mail GS Martinschule Deckertstr. 1 33617 Bielefeld 0521 / 557999311 [email protected] GS Grundschule Am Homersen Rüggesiek 11 33719 Bielefeld 0521 / 557995511 [email protected] GS Eichendorffschule Weihestr. 4 33613 Bielefeld 0521 / 557990411 [email protected] GS Vogelruthschule Wikingerstr. 15 33647 Bielefeld 0521 / 557994211 [email protected] GS Volkeningschule Petristr. 58 33609 Bielefeld 0521 / 557991611 [email protected] GS Sudbrackschule Klarhorststr. 8 33613 Bielefeld 0521 / 557991511 [email protected] GS Astrid-Lindgren-Schule Werraweg 54 33689 Bielefeld 05205 / 87967011 [email protected] GS Hellingkampschule Herforder Straße 33609 Bielefeld 0521 / 55799060 [email protected] GS Grundschule Ubbedissen Detmolder Str. 697 33699 Bielefeld 05202 / 15066211 [email protected] GS Grundschule Bültmannshof Kurt-Schumacher-Str. 45 33615 Bielefeld 0521 / 557990211 [email protected] GS Rußheideschule Spindelstraße 119 33604 Bielefeld 0521 / 557991111 [email protected] GS Bahnhofschule Buschkampstr. 134 33659 Bielefeld 0521 / 557997611 [email protected] GS Grundschule Dreekerheide Bargholzstr. 32 33739 Bielefeld 05206 / 96958711 [email protected] GS Hans-Christian-Andersen-GS Vennhofallee 85 33689 Bielefeld 05205 / 87967111 [email protected] GS Grundschule Quelle Carl-Severing-Str. 165 33649 Bielefeld 0521 / 557994311 [email protected] GS Plaßschule Meyer-zu-Eissen-Weg 4 33611 Bielefeld 0521 / 557991011 [email protected] GS Grundschule Stieghorst Detmolder Str. 415 33605 Bielefeld 0521 / 557991311 [email protected] GS Grundschule Brake Am Bohnenkamp 15 33729 Bielefeld 0521 / 557995611 [email protected] GS Grundschule Milse Elverdisser Str.