Amazonasbilder 1868
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aqui Se Verá, Se Dispuserem a Refletir Sobre O Que Somos, Seremos E Deixamos De Ser
PRESIDENTA DA REPÚBLICA Dilma Rousseff MINISTRO DA CULTURA Juca Ferreira FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL PRESIDENTE DA FBN Renato Lessa DIRETORA EXECUTIVA Myriam Lewin CHEFE DE GABINETE Ângela Fatorelli COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Tania Pacheco CENTRO DE COOPERAÇÃO E DIFUSÃO Moema Salgado CENTRO DE PESQUISA E EDITORAÇÃO Marcus Venicio Toledo Ribeiro CCP – CENTRO DE PROCESSAMENTO E PRESERVAÇÃO Liana Gomes Amadeo CCSL – CENTRO DE COLEÇÕES E SERVIÇOS AOS LEITORES Maria José da Silva Fernandes apoio: realização: rio de janeiro 450 anos UMA HISTÓRIA DO FUTURO BIBLIOTECA NACIONAL ficha técnica CURADORIA CENTRO DE CONSERVAÇÃO E Marco Lucchesi ENCADERNAÇÃO – CCE Gilvânia Lima COORDENAÇÃO GERAL Suely Dias REPRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS Laboratório de Digitalização | Otávio COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Alexandre Oliveira Verônica Lessa PROJETO EXPOGRÁFICO PESQUISA Leila Scaf Iuri Lapa Lia Jordão PROJETO GRÁFICO Rafaela Bettamio Tecnopop ACERVOS | CENTRO DE COLEÇÕES PRODUÇÃO Letra e Imagem E SERVIÇOS AOS LEITORES ILUMINAÇÃO COORDENADORIA DE ACERVO ESPECIAL Atelier da Luz Divisão de Cartografia Ivo Fernandes Lattuca Junior COORDENAÇÃO DE MONTAGEM Maria Dulce de Faria Lucas Rodrigues Divisão de Iconografia CENOTÉCNICA Diana dos Santos Ramos Buritis Design Luciana de Fátima Muniz Mônica Carneiro Alves PINTURA ARTÍSTICA Sônia Alice Monteiro Caldas Elisio Filho e Paulo Santos Tatiane Paiva Cova Divisão de Manuscritos MOLDURAS Eliane Perez Metara Arte e Molduras Maria de Fátima da Silva Morado Vera Lúcia Miranda Faillace AMPLIAÇÕES FOTOGRÁFICAS Fine Art Photo Print Divisão de Música e Arquivo Sonoro Elizete Higino LOGÍSTICA Sérgio Duayer Hosken Equipe Coordenadoria de Promoção Divisão de Obras Raras e Difusão Cultural | Januária Teive, Paula Ana Virgínia Teixeira da Paz Pinheiro Machado e Paulo Jorge José Henrique Monteiro Equipe CGPA/DMA Leila Marzullo de Almeida Maria do Rosário de F. -
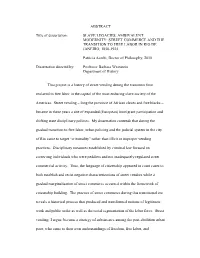
ABSTRACT Title of Dissertation: SLAVE LEGACIES, AMBIVALENT
ABSTRACT Title of dissertation: SLAVE LEGACIES, AMBIVALENT MODERNITY: STREET COMMERCE AND THE TRANSITION TO FREE LABOR IN RIO DE JANEIRO, 1850-1925 Patricia Acerbi, Doctor of Philosophy, 2010 Dissertation directed by: Professor Barbara Weinstein Department of History This project is a history of street vending during the transition from enslaved to free labor in the capital of the most enduring slave society of the Americas. Street vending – long the province of African slaves and free blacks – became in these years a site of expanded (European) immigrant participation and shifting state disciplinary policies. My dissertation contends that during the gradual transition to free labor, urban policing and the judicial system in the city of Rio came to target “criminality” rather than illicit or improper vending practices. Disciplinary measures established by criminal law focused on correcting individuals who were peddlers and not inadequately regulated street commercial activity. Thus, the language of citizenship appeared in court cases to both establish and resist negative characterizations of street vendors while a gradual marginalization of street commerce occurred within the framework of citizenship building. The practice of street commerce during this transitional era reveals a historical process that produced and transformed notions of legitimate work and public order as well as the racial segmentation of the labor force. Street vending, I argue, became a strategy of subsistence among the post-abolition urban poor, who came to their own understandings of freedom, free labor, and citizenship. Elite and popular attitudes toward street vending reflected the post- abolition political economy of exclusion and inclusion, which peddlers did not experience as mutually exclusive but rather as a dialectic of an ambivalent modernity. -

Post-Abolition in the Atlantic World
Revista Brasileira de História ISSN 1806-9347 Post-Abolition in the Atlantic World The Revista Brasileira de História integrates the portals SciELO, Redalyc and Periódicos Capes, accessible through the following URLs: http://www.scielo.br/rbh • http://redalyc.uaemex.mx • HTTP://www.periodicos.capes.gov.br Indexing data bases: Scopus, ISI Web of Knowledge, ABC-CLIO, Hispanic American Periodicals Index (HAPI) Revista Brasileira de História – Official Organ of the National Association of History. São Paulo, AN PUH, vol. 35, no 69, Jan.-June 2015. Semiannual ISSN: 1806-9347 CO DEN: 0151/RBHIEL Correspondence: ANPUH – Av. Prof. Lineu Prestes, 338 Cidade Universitária. CEP 05508-000 – São Paulo – SP Phone/Fax: (11) 3091-3047 – e-mail: [email protected] Revision (Portuguese): Armando Olivetti Desktop publishing: Flavio Peralta (Estúdio O.L.M.) Revista Brasileira de História Post-Abolition in the Atlantic World ANPUH Revista Brasileira de História no 69 Founder: Alice P. Canabrava August 2013 – July 2015 Editor in charge Alexandre Fortes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, RJ – Brasil. E-mail: [email protected] Editorial committee (RBH) Alexandre Fortes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, RJ – Brasil Ana Teresa Marques Gonçalves, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO – Brasil Carla Simone Rodeghero, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS – Brasil Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG – Brasil Fátima Martins Lopes, Universidade -

Universidade De São Paulo Escola De Comunicações E Artes MUSEUS E COLEÇÕES UNIVERSITÁRIOS
Universidade de São Paulo Escola de Comunicações e Artes MUSEUS E COLEÇÕES UNIVERSITÁRIOS: POR QUE MUSEUS DE ARTE NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO? Adriana Mortara Almeida Tese apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo como exigência parcial para obtenção do grau de Doutor em Ciências da Informação e Documentação Orientadora: Maria Helena Pires Martins São Paulo 2001 Universidade de São Paulo Escola de Comunicações e Artes MUSEUS E COLEÇÕES UNIVERSITÁRIOS: POR QUE MUSEUS DE ARTE NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO? Adriana Mortara Almeida Tese apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo como exigência parcial para obtenção do grau de Doutor em Ciências da Informação e Documentação Orientadora: Maria Helena Pires Martins São Paulo 2001 Comissão Julgadora Dedico essa tese ao Rodrigo, que trouxe uma imensa felicidade para minha vida, ao Cláudio, que me alimenta com seu amor e aos meus pais. Agradecimentos Esta tese não poderia ter sido realizada sem o apoio financeiro da FAPESP e sem o apoio, direto ou indireto, de todos os colegas profissionais, amigos e familiares. Agradeço a Maria Helena, que sempre acreditou em meu trabalho e me deu força quando precisava, enriquecendo e aperfeiçoando-o. E também ao seu carinho como “avó” do Rodrigo. Gostaria de agradecer a todos os profissionais de museus que dedicaram seu tempo a responder minhas perguntas, seja por escrito, por telefone, pessoalmente, enfim, a vocês que tornaram possível recolher informações sobre os inúmeros museus universitários do Brasil e de fora do Brasil. Alguns ainda me forneceram fotografias, catálogos e publicações que alimentaram nosso “banco de dados” sobre museus universitários de arte. -

Photojournalism in Nineteenth Century Brazil
PHOTOJOURNALISM IN NINETEENTH CENTURY BRAZIL: A METHODOLOGICAL APPROACH BEATRIZ MAROCCO 92 - Abstract The essay focuses on the work of two German photog- Beatriz Marocco is professor raphers, Augusto Stahl and Revert Henrique Klumb, whose of journalism at the Univer- work predates the journalistic genre of photojournalism in sidade do Vale do Rio dos nineteenth century Brazil. The author proposes the use of Sinos; e-mail: bmarocco@ a Foucaultian archaeology as a method of exploring and unisinos.br. analysing the contributions of these photographers to the journalistic discourse, and to reporting in particular. Vol.14 (2007), No. 3, pp. 79 3, pp. (2007), No. Vol.14 79 German photographers Augusto Stahl and Revert Henrique Klumb become central to discussions concerning early Brazilian photojournalism. Their contribu- tions, however, are missing from the study of photography. This essay explores this epistemological gap and proposes a Foucaultian archaeology for bringing to light their proximity to a journalistic order of discourse and their critical att itude towards its subjects proclaimed later by industrial journalism. Stahl arrived in Recife in 1853, on board of the Thames of the English Royal Mail. It is assumed that he was a young German, between 20 and 30 years of age, who had improved his training possibly in England, where there were remarkable advances in photographic techniques. Although several foreign photographers had worked in the province before him, Stahl was the only one to sett le there, opening a studio on Crespo Street, at the corner of the Cadeic Street. Klumb is reported to have arrived in Brazil as a German mercenary, fl eeing from the French government that constituted the Second Empire in 1852. -

Maria Inez Turazzimaria
Maria Inez Turazzi Maria Inez Turazzi ormar os brasileiros. Permitir a cada um dos súditos-cidadãos imperiais construir imagens do Brasil, no mesmo movimento em que, por meio Fdelas, cada um daqueles brasileiros era constituído. Outra não era a tarefa que os dirigentes imperiais haviam se imposto, a qual sempre se apresentaria I sob uma dupla face: a da recorrente inscrição do Império do Brasil no conjunto CONOGRAFIA das “Nações civilizadas” e aquela que se realizava por meio de uma expansão diferente – uma expansão para dentro – , que distinguia o Império do Brasil de outras experiências imperiais. No mês de dezembro de 1881, a Exposição de História do Brasil era um indício e um fator daquela tarefa em ambas as faces. Quase 130 anos depois, as páginas deste ICONOGRAFIA E ATRIMÔNIO E P . O Catálogo P da Exposição de História do Brasil e a fisionomia da nação, de Maria Inez Turazzi, ATRIMÔNIO se apresentam ao leitor-visitante como a possibilidade de ser tanto o expectador de tudo aquilo que uma exposição e seu catálogo ainda despertam, quanto o ICONOGRAFIA E PATRIMÔNIO espectador que testemunha como as exposições são eternas, ainda que apenas enquanto dure o prazer da leitura de um texto luminoso. O Catálogo da Exposição de História do Brasil e a fisionomia da nação ILMAR ROHLOFF DE MATTOS ICONOGRAF I A E PATR I MÔN I O O Catálogo da Exposição de História do Brasil e a fisionomia da nação InezTurazzi.indd 1 6/10/2009 19:23:59 Coleção Rodolfo Garcia Vol. 33 REPÚBLICA FEDE R ATIVA DO BR ASIL Presidente da República / Luiz Inácio Lula da Silva -
Gravura Perdida Que Retrata a Igreja Da Sé É Encontrada Em Lisboa
Diogo e Maurício duelam em Arte contemporânea em cena no em paredão duplo do BBB 11 espetáculo ‘O corpo descartável’ Programa vai ao ar hoje, às 22h, na Globo P. 3 Em cartaz na Sala de Dança da UFMA P. 4 e 5 “Esse bicentenário, não só queremos festejar com as honrarias devidas. Queremos, sim senhor, provocar altas Alternativo discussões, bons debates” [email protected] O ESTADO DO MARANHAO · SAO LUIS, 25 de janeiro de 2011 - Terça-feira Sálvio Dino, na coluna Hoje É Dia de em crônica sobre os 200 anos de Grajáu pesquisador maranhense pesquisador Luiz de Mello, está- João Carlos Pimentel Can- se diante de três anunciadas lito- O tanhede, autor do livro gravuras de Hagedorn, cuja au- Gravura perdida que “Veredas Estéticas – Fragmento toria é desconhecida até mesmo para uma história social das artes pela Biblioteca Nacional de Lis- visuais no Maranhão”, localizou boa, que, na referência à da nos- recentemente a terceira gravura sa catedral, omite o nome do de- com paisagens de São Luís pro- senhista e autor alemão Friedrich duzida pelo pintor e desenhista Hagedorn. retrata a Igreja da Sé alemão Friedrich Hagedorn (1814-1889), que segundo regis- O pintor - Segundo o Dicionário tros da época, teria passado pela Brasileiro de Artistas Plásticos, de cidade por volta de 1855. Cláudio Calvacanti, de 1973, Frie- A comercialização de algumas drich Hagedorn foi um pintor ati- das obras desse artista plástico foi vo no Rio de Janeiro, onde se ins- é encontrada em Lisboa noticiada no jornal Diário do Ma- talou ao vir para o Brasil. -

Da Manchete À Notinha De Canto: Os Furtos Do Patrimônio Público, a Privatização Dos Acervos Do Cidadão1
Artigo Da manchete à notinha de canto: os furtos do patrimônio público, a privatização dos acervos do cidadão1 Beatriz Kushnir* As notícias sobre os numerosos furtos de bens culturais, na cidade do Rio, ocorridos entre 2001 e 2008, vêm impondo a perplexidade aos pesquisadores e à sociedade. A divulgação destas informações cria uma imagem, falseada, de que vivemos algo novo. Certamente, nas proporções experimentadas e anunciadas, é inusitado. Foram subtraídas as fotos da Coleção Thereza Christina Maria, doada pelo imperador D. Pedro II à Biblioteca Nacional2, os quadros de Matisse, Monet e Dalí do Museu da Chácara do Céu; as medalhas do Museu Histórico da Cidade do RJ; as fotos de Augusto Malta, as revistas semanais, e as gravuras de Debret do Arquivo Geral da Cidade do RJ; os quadros e dois castiçais de madeira folheados a ouro do século 17 da capela da Colônia Juliano Moreira; cinco peças históricas do Mosteiro de São Bento3, numa lista que parece interminável. Em 2003, segundo um balanço parcial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN)4, órgão do Ministério da Cultura (MinC), pelo menos 83 peças desapareceram – 78 em Minas Gerais e cinco no Rio. Tal estatística superava os fatos ocorridos em 1994, mas o ápice parece ter ocorrido um ano antes, em 1993, quando 247 peças foram registradas como furtadas. Em 2001 e 2002, há o registro de dezenove casos (ESCOSSIA, 2003). Esses dados são pouco confiáveis. Nem todos os furtos são notados, registrados pela polícia e chegam ao IPHAN. Mesmo assim, o cadastro de bens furtados daquele órgão lista cerca de novecentas peças do patrimônio procuradas. -

Catalogo Olhar Viajante.Pdf
Exposição de 22 de outubro a 18 de dezembro de 2008 Casa Fiat de Cultura Rua Jornalista Djalma de Andrade, 1250 Belvedere - Nova Lima/MG www.casafiatdecultura.com.br Realização Patrocínio Parceria Parceria Institucional Apoio Cultural 2 3 ara além das belas imagens desta exposição, busquemos o olhar de quem as fixou. Para Fernando Pessoa, “as viagens não são o que vemos, mas o que so- Pmos”. Se é assim, e creio que assim seja, esse Brasil que nos é revelado, o Brasil dos viajantes, é um Brasil, não o único Brasil. Importa-nos saber que Brasil fomos à luz desse olhar alheio, comparando-o com o nosso próprio Brasil, o de nosso olhar, seja o do século XIX, seja o do presente século? Também acredito que sim. Se naquele tempo um desses viajantes podia dizer, como o fez, que, “até agora, a natureza tem feito mais para o Brasil do que o homem”, o que poderia ser dito, hoje, pelo viajante e por nós? Viajemos nessa viagem e lancemos sempre o nosso olhar sobre o Brasil, o de ontem e o de hoje. É o que propõe a Casa Fiat de Cultura, ao oferecer esta exposição. J E de Lima Pereira Presidente da Casa Fiat de Cultura 4 5 APPA, parceira da Casa Fiat de Cultura desde a sua implantação em 2006, se sente orgulhosa e grata pela oportunidade de integrar o grande grupo A de parceiros desta importantíssima exposição Olhar Viajante, ao lado do Ministério da Cultura, da Pinacoteca, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e da Expomus. -

Casa Carioca | Museu De Arte Do
1 IMAGEM DA CAPA DANIEL LANNES, Young canibals, 2018. Acrílica e óleo sobre linho (Acrylic and oil painting on canvas). Coleção particular (Private collection) ROMMULO CONCEIÇÃO, A fragilidade dos negócios humanos pode ser um limite espacial incontestável (The fragility of human affairs can be an indisputable spatial limit), 2015 Vidro, metal, cerâmica e pintura automotiva (Glass, metal, ceramics and automotive paint) MAR - Museu de Arte do Rio | Secretaria Municipal de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro | Doação Rommulo Conceição (Rio de Janeiro City Culture Office | Donation by Rommulo Conceição) CASA CARIOCA 4 5 Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura apresentam Curadoria (curatorship) Marcelo Campos Joice Berth Agosto de 2020 August, 2020 CASA CARIOCA Mais tarde, quando tudo não passar de memória no nosso imaginário cansado, 2020 talvez seja lembrado como o ano em que ficamos em casa. Para alguns o recolhimento obrigatório significou uma chan- ce de redescobrir e reinventar os usos práticos e afetivos de suas moradias. Para outros, o isolamento social é uma realidade aquém da própria pandemia. Estou falando de quem vive sem a infraestrutura mínima necessária para se esconder da morte e da infâmia causadas pelo vírus e pelos vermes que parecem querer dizimar a parte mais sofrida, exatamente a parte mais sofrida, do nosso povo. Meses antes de o coronavírus chegar ao país, a equipe do Institu- to Odeon, responsável pela gestão do MAR, já se debruçava sobre questões relacionadas aos modos de viver e morar das gentes desta cidade. Casa Carioca, exposição pensada para integrar o Congresso Mundial de Arquitetos (UIA 2020), adiado para o próximo ano em função da pandemia, convida todos a entrar e ficar à vontade. -

Landscapes of the South New York 30/01 2020 – 15/02 2020 Lucas
Landscapes of the South New York 30/01 2020 – 15/02 2020 Lucas Arruda, Miguel Bakun, Giovanni Battista Castagneto, Daniel Correa Mejía, Adriano Costa, Alberto da Veiga Guignard, Tarsila do Amaral, Nicolau Antonio Facchinetti, Friedrich Hagedorn, Federico Herrero, Patricia Leite, Amadeo Luciano Lorenzato, Hélio Melo, José Pancetti, Marina Perez Simão, Frans Post, Henri Nicolas Vinet, Alfredo Volpi Mendes Wood DM is pleased to present Landscapes of the South, a group exhibition themed around the representation of landscapes in South America. Comprised of works made between 1659 and 2019, the works on view were made by early European colonizers in Brazil, modernist Brazilian masters who sought to subvert the vision of said colonizers by building a national artistic language, and contemporary South American artists who reflect on the notion of landscape itself, beyond its political referents. The exhibition features works by Frans Post (Netherlands, 1612-1680), Friedrich Hagedorn (Poland, 1814-1889), Henri Nicolas Vinet (France, 1817-1876), Nicolau Antonio Facchinetti (Italy, 1824-1900), Giovanni Battista Castagneto (Italy, 1851-1900), Tarsila do Amaral (Brazil, 1886-1973), Alberto da Veiga Guignard (Brazil, 1896-1962), Alfredo Volpi (Italy, 1896-1988), Amadeo Luciano Lorenzato (Brazil, 1900-1995), José Pancetti (Brazil, 1902-1958), Miguel Bakun (Brazil, 1909-1963), and Hélio Melo (Brazil, 1926-2001). In addition, the exhibition includes works by the contemporary Latin American artists Patricia Leite (Brazil, 1955), Federico Herrero (Costa Rica, 1978), Daniel Correa Mejía (Colombia, 1986), Adriano Costa (Brazil, 1975), Marina Perez Simão (Brazil, 1981), and Lucas Arruda (Brazil, 1983). The older among these artists guided the emergence of a national artistic practice, some of them teaching at recently established Brazilian academies. -

Renata Conceicao Nobrega Santos.Pdf
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA RENATA CONCEIÇÃO NÓBREGA SANTOS AÇO E SUOR PELO AÇÚCAR E EM NOME DO PROGRESSO: 1ª SEÇÃO DA RECIFE SÃO FRANCISCO RAILWAY (Pernambuco, 1852-1859). RECIFE/PE 2017 RENATA CONCEIÇÃO NÓBREGA SANTOS AÇO E SUOR PELO AÇÚCAR E EM NOME DO PROGRESSO: 1ª SEÇÃO DA RECIFE SÃO FRANCISCO RAILWAY (Pernambuco, 1852-1859). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco como um dos requisitos para a obtenção do grau de Mestra.. Orientadora: Prof. Dr.ª Vicentina Maria Ramires Borba RECIFE/PE 2017 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE Nome da Biblioteca, Recife-PE, Brasil S237a Santos, Renata Conceição Nóbrega Aço e suor pelo açúcar e em nome do progresso: 1ª Seção da Recife São Francisco Railway (Pernambuco, 1852-1859) / Renata Conceição Nóbrega Santos. – 2017. 205 f. : il. Orientador: Vicentina Maria Ramires Borba. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em História, Recife, BR-PE, 2017. Inclui referências e anexo(s). 1. Escravidão 2. Ferrovia 3. Progresso 4. Trabalho I. Borba, Vicentina Maria Ramires, orient. II. Título CDD 981.34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA REGIONAL BANCA EXAMINADORA Profª Drª Vicentina Maria Ramires Borba Orientadora- Programa de Pós-Graduação em História – UFRPE Profª Drª Christine Paulette Yves Rufino Dabat Examinadora externa - Programa de Pós-Graduação em História – UFPE Prof Dr Humberto da Silva Miranda Examinador interno – Programa de Pós-Graduação em História – UFRPE RESUMO: Através do Decreto n.