Roman Grafe Deutsche Gerechtigkeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schießbefehl and the Issues of Retroactivity Within the East German Border Guard Trials Keegan Mcmurry Western Oregon University, [email protected]
Western Oregon University Digital Commons@WOU Student Theses, Papers and Projects (History) Department of History 2018 Schießbefehl and the Issues of Retroactivity Within the East German Border Guard Trials Keegan McMurry Western Oregon University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wou.edu/his Part of the Diplomatic History Commons, European History Commons, Legal Commons, and the Political History Commons Recommended Citation McMurry, Keegan, "Schießbefehl and the Issues of Retroactivity Within the East German Border Guard Trials" (2018). Student Theses, Papers and Projects (History). 264. https://digitalcommons.wou.edu/his/264 This Paper is brought to you for free and open access by the Department of History at Digital Commons@WOU. It has been accepted for inclusion in Student Theses, Papers and Projects (History) by an authorized administrator of Digital Commons@WOU. For more information, please contact [email protected]. Schießbefehl1 and the Issues of Retroactivity Within the East German Border Guard Trials Keegan J. McMurry History 499: Senior Seminar June 5, 2018 1 On February 5th, 1989, 20-year old Chris Gueffroy and his companion, Christian Gaudin, were running for their lives. Tired of the poor conditions in the German Democratic Republic and hoping to find better in West Germany, they intended to climb the Berlin Wall that separated East and West Berlin using a ladder. A newspaper account states that despite both verbal warnings and warning shots, both young men continued to try and climb the wall until the border guards opened fire directly at them. Mr. Gaudin survived the experience after being shot, however, Mr. -

HAVE GERMAN WILL TRAVEL FAMOUS EVENTS: What Happened
HAVE GERMAN WILL TRAVEL This week in Histor FAMOUS EVENTS: What happened on ... ? Was ist am 13. August 1961 geschehen? Building of the Berlin Wall Runners brave 160km marathon to mark fall of Berlin Wall "You have to accept that you will be moving for 24 hours," says west Berlin runner Nina Blisse, who finished both the 2014 and 2015 editions in under 26 hours and is race treasurer. The Wall's history is entwined in the race's DNA. Registration for the following year's race always opens at 18:57 (1657 GMT) on November 9 - marking the exact moment in 1989 when East Germany lifted its travel ban, triggering the Wall's demise. Each year, one Wall victim is chosen for a special tribute, their face featuring on start numbers and finisher medals, while a ceremony is held at the spot where they died. For the first race in 2011, Chris Gueffroy, the last person shot dead on the Berlin Wall, was honoured. He was killed in February 1989, eight months before the Wall fell, and on Sunday, Gueffroy's mother Karin will present medals at the finishers' ceremony. Political prisoners Last year, the Wall's youngest victim, Joerg Hartmann, a 10-year-old boy shot dead by East German border guards in 1966 while trying to visit his father in the west, was honoured. Having each been asked to carry a gift for him, last year's runners piled cuddly toys at the spot he was killed. "I still get goosebumps thinking about it," admits Ilk. For the organisers and 400 helpers, all volunteers, a sleepless night is par for the course. -

H-Diplo ROUNDTABLE XXII-10
H-Diplo ROUNDTABLE XXII-10 Hope M. Harrison. After the Berlin War: Memory and the Making of the New Germany, 1989 to the Present. New York: Cambridge University Press, 2019. ISBN: 9781107049314 (hardback, $34.99). 26 October 2020 | https://hdiplo.org/to/RT22-10 Roundtable Editors: Thomas Maddux and Diane Labrosse | Production Editor: George Fujii Contents Introduction by Charles Maier, Harvard University ............................................................................................................................. 2 Review by Pertti Ahonen, University of Jyvaskyla, Finland .............................................................................................................. 6 Review by Mark Fenemore, Manchester Metropolitan University ................................................................................................ 8 Review by Mary Fulbrook, University College London .................................................................................................................... 15 Review by William Glenn Gray, Purdue University ............................................................................................................................ 17 Review by Stephan Kieninger, Independent Historian ................................................................................................................... 20 Response by Hope M. Harrison, the George Washington University ......................................................................................... 23 H-Diplo Roundtable XXII-10 -

Michael Cramer This Year, We Remember the 30Th Anniversary Of
Brolly. Journal of Social Sciences 2 (3) 2019 EDITORIAL THE BERLIN WALL Michael Cramer Member of the German Green Party in the Berlin City-State Parliament (1989-2004) and in the European Parliament (2004-2019). He is the initiator of the “Berlin Wall Trail”, the “Iron Curtain Trail” and the author of these books. [email protected] This year, we remember the 30th anniversary of the fall of the Wall in Berlin and of the Iron Curtain in Europe. “Where was the Wall?" is a question that many visitors of Berlin still ask today. Many teenagers know about the years before 1989 only from their history books. Today, the former course of the 40-kilometre inner-city border is marked by a double row of cobblestones, with metal plaques at regular intervals on the West Berlin side, bearing the words “Berliner Mauer 1961-1989”. The Wall around West Berlin was 3.60 m high and 160 km long. Its appearance and location changed over the course of time. The barbed-wire fencing was replaced by pre-manufactured Wall segments, which were in some parts reinforced with metal grid fences. Between the “outer border wall” facing West and the “inner border wall” facing East was the brightly lit notorious “death strip” with the “patrol path”, on which GDR border troops guarded the frontier. On the GDR-side, only selected people were allowed to live in the neighbourhoods directly behind the Wall. Their friends and relatives had to be registered before any visits and needed to obtain a special permit. More than 300 guard towers, 30 headquarters, 20 bunkers, floodlight systems, signal and alarm fences, as well as dog running areas and tank traps were installed to prevent people from escaping to West Berlin. -
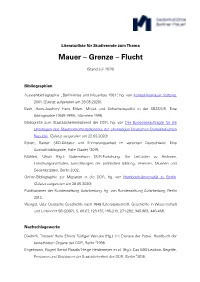
Mauer – Grenze – Flucht
Literaturliste für Studierende zum Thema Mauer – Grenze – Flucht (Stand Juli 2020) Bibliographien Auswahlbibliographie „Berlin-Krise und Mauerbau 1961“, hg. von Konrad-Adenauer Stiftung, 2001. (Zuletzt aufgerufen am 28.05.2020). Beth, Hans-Joachim/ Hans Ehlert: Militär- und Sicherheitspolitik in der SBZ/DDR. Eine Bibliographie (1945-1995), München 1996. Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR, hg. von Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. (Zuletzt aufgerufen am 22.05.2020). Eckert, Rainer: SED-Diktatur und Erinnerungsarbeit im vereinten Deutschland. Eine Auswahlbibliografie, Halle (Saale) 22019. Mählert, Ulrich (Hg.): Vademekum DDR-Forschung. Ein Leitfaden zu Archiven, Forschungsinstituten, Einrichtungen der politischen Bildung, Vereinen, Museen und Gedenkstätten, Berlin 2002. Online-Bibliographie zur Migration in die DDR, hg. von Humboldt-Universität zu Berlin. (Zuletzt aufgerufen am 28.05.2020). Publikationen der Bundesstiftung Aufarbeitung, hg. von Bundesstiftung Aufarbeitung, Berlin 2012. Wengst, Udo: Deutsche Geschichte nach 1945 (Literaturbericht), Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 58 (2007), S. 60-67, 123-137, 195-210, 271-282, 345-363, 446-468. Nachschlagewerke Diedrich, Torsten/ Hans Ehlert/ Rüdiger Wenzke (Hg.): Im Dienste der Partei. Handbuch der bewaffneten Organe der DDR, Berlin 21998. Engelmann, Roger/ Bernd Florath/ Helge Heidemeyer et al. (Hg.): Das MfS-Lexikon. Begriffe, Personen und Strukturen der Staatssicherheit der DDR, Berlin 32016. Herbst, Andreas/ Marion Niemann (Hg.): SED-Kader: Die mittlere Ebene. Biografisches Lexikon der Sekretäre der Landes- und Bezirksleitungen, der Ministerpräsidenten und der Vorsitzenden der Räte der Bezirke 1946 bis 1989, Paderborn 2010. Hermann, Ingolf: Deutsch-deutsches Grenzlexikon. Der eiserne Vorhang und die Mauer in Stichworten, Zella-Mehlis 2005. Leffler, Melvyn P./ Odd Arne Westad (Hg.): The Cambridge History of the Cold War, 3 Bde., Cambridge 2010. -

Berliner Mauer Und Innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis Aus Der Bibliothek Der Bundesstiftung Aufarbeitung
Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis aus der Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung In der Nacht zum 13. August 1961 begann die Abriegelung der Grenze zu den Berliner Westsektoren durch das SED-Regime. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Volks- und Grenzpolizei sowie Betriebskampfgruppen der SED wurden Verbindungs- straßen aufgerissen, Spanische Reiter und Stacheldrahtverhaue errichtet und der öffentliche Nahverkehr zwischen den beiden Stadtteilen dauerhaft unterbrochen. In den folgenden Tagen und Wochen wurden die provisorischen Stacheldrahtsperren unter scharfer Bewachung durch DDR-Grenzposten mit einer Mauer aus Hohlblock- steinen und Betonplatten ersetzt. Walter Ulbricht hatte sein Ziel erreicht. Der letzte noch offene Fluchtweg in den Westen war geschlossen und die bis dahin stetig wachsende Fluchtbewegung aus der DDR gestoppt. Die Berliner Mauer existierte über 28 Jahre lang und wurde zum Symbol für das menschenverachtende Regime in der DDR-Diktatur und zum Symbol der Deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Die Mauer stand zudem für die Unerbittlichkeit eines Regimes, das auch vor Todesschüssen auf Flüchtlinge nicht zurückschreckte. Die vorliegende Bibliographie umfasst sämtliche Monographien, Broschüren und audiovisuellen Medien aus dem Bestand der Stiftungsbibliothek, die sich dem Themenkomplex Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze widmen. Das Verzeichnis ist in folgende Rubriken gegliedert: Mauerbau und Vorgeschichte ● Leben mit der Mauer ● Innerdeutsche Grenze ● Flucht und Opfer der Mauer/innerdeutschen Grenze ● Grenze und Fluchtbewegung vor 1961 ● Gedenkstätten und Erinnerung ● Ausreise Mauerbau und Vorgeschichte 3 x durch den Zaun. Bonn: Büro Bonner Berichte, 1963. Signatur: F 9591 13. August 1961. Bonn: Kuratorium Unteilbares Deutschland, 1961. Signatur: F 9963 13. August 1961. 2., überarb. Aufl. Bonn: Gesamtdt. Inst., 1986. (Seminarmaterial des Gesamtdeutschen Instituts). -

Behind the Berlin Wall.Pdf
BEHIND THE BERLIN WALL This page intentionally left blank Behind the Berlin Wall East Germany and the Frontiers of Power PATRICK MAJOR 1 1 Great Clarendon Street, Oxford Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Patrick Major 2010 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Major, Patrick. -

140 Victims at the Berlin Wall, 1961 – 1989
August 2017 Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke 140 Victims at the Berlin Wall, 1961 – 1989 Fugitives who were either shot, suffered a fatal accident or took their own lives at the Berlin Wall between 1961 and 1989; individuals from the East and the West who did not intend to flee but were killed or suffered a fatal accident on the border grounds Name Born Died Circumstances of death 1961 Ida Siekmann 23.08.1902 22.08.1961 Killed in an accident while trying to escape. Günter Litfin 19.01.1937 24.08.1961 Shot dead while trying to escape Roland Hoff 19.03.1934 29.08.1961 Shot dead while trying to escape Rudolf Urban 06.06.1914 17.09.1961 Died as a result of injuries incurred while trying to escape Olga Segler 31.07.1881 26.09.1961 Died as a result of injuries incurred while trying to escape Bernd Lünser 11.03.1939 04.10.1961 Fatally wounded under fire while trying to escape Udo Düllick 03.08.1936 05.10.1961 Drowned under fire while trying to escape Werner Probst 18.06.1936 14.10.1961 Shot dead while trying to escape Lothar Lehmann 28.01.1942 26.11.1961 Drowned while trying to escape Dieter Wohlfahrt 27.05.1941 09.12.1961 Shot as an escape helper while supporting others in their escape attempts Ingo Krüger 31.01.1940 11.12.1961 Drowned while trying to escape Georg Feldhahn 12.08.1941 19.12.1961 Drowned while trying to escape 1962 Dorit Schmiel 25.04.1941 19.02.1962 Shot dead while trying to escape. -

50 Jahre Mauerbau MIT KOPIERVORLAGEN FÜR DEN HANDLUNGSORIENTIERTEN UNTERRICHT INHALT
August 2011 53. Jahrgang 50 Jahre mauerBAU MIT KOPIERVORLAGEN FÜR DEN HANDLUNGSORIENTIERTEN UNTERRICHT INHALT 03 04 06 Vorwort »Drüben« ist Chronologie: auf beiden Seiten Die Geschichte der deutschen Teilung 10 14 16 Essay: Didaktische Hinweise Arbeitsblätter Vom Bau der Mauer und und Übersicht der der zeitweiligen Teilung Arbeitsblätter Deutschlands 31 32 Service und Gedenkstätten und Lösungshinweise Gedenkinstallationen zur deutschen Teilung 2 Zeitbild Wissen LIEBE LEHRERINNEN UND LEHRER, LIEBE SCHÜLERINNEN die Grundidee zu diesem Bild entstand eher aus persönlichen Gründen. Da UND SCHÜLER, meine damalige Freundin gerade schwanger war, kam mir die Idee der Verbundenheit. Eine Verbundenheit, die es ohne die Wiedervereinigung nie gegeben hätte — und ohne die unser Kind nicht existieren würde. Ich komme aus Westdeutschland, sie aus Ostdeutschland, unser Kind ist also ein »Gesamtdeutscher«. Während wir in unserer Kindheit noch »Westen« und »Osten« erlebten, ist uns die Teilung heute kaum noch bewusst. Meine Eltern zeigten mir als Kind einen Zaun in einer Landschaft und meinten, da drüben ist die DDR, meiner Freundin wurde nur erzählt, dass es einen »Westen« gab. Bei ihr war die DDR auf der Karte grün und Westdeutschland rot, meine Karte war genau umge- kehrt. Ihr Vater wurde als Schriftsteller von einem Stasi-Spitzel aus der Nach- barschaft überwacht, durch mein Dorf fuhren amerikanische Panzer zum Manöver als Probe für den Ernstfall. Unser Kind wurde 16 Jahre nach dem- Mauerfall geboren. Für ihn sind all diese Ereignisse nur noch Geschichte. Die Spuren der »Teilung« werden vergehen, aber unsere Erinnerungen werden eine neue Generation prägen. Dieses Bild steht also für drei Genera- tionen: die der Getrennten hinter Mauern, die der Vereinten voller Hoffnung und die der neuen Gesamtdeutschen — in all ihrer Verantwortung aus unseren Vergangenheiten. -
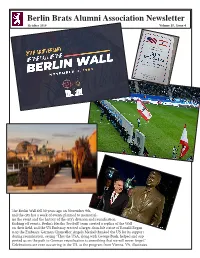
Berlin Brats Alumni Association Newsletter 1 Berlin Brats Alumni Association Newsletter October 2019 Volume 15, Issue 4
Berlin Brats Alumni Association Newsletter 1 Berlin Brats Alumni Association Newsletter October 2019 Volume 15, Issue 4 The Berlin Wall fell 30 years ago on November 9th, and the city has a week of events planned to memorial- ize the event and the history of the city’s division and reunification. Kicking off events, Berlin’s Hertha ‘football’ team created a replica of the Wall on their field, and the US Embassy erected a larger-than-life statue of Ronald Regan atop the Embassy. German Chancellor Angela Merkel thanked the US for its support during reunification, saying “That the USA, along with George Bush, helped and sup- ported us on the path to German reunification is something that we will never forget.” Celebrations are even occurring in the US, as the program from Vienna, VA, illustrates. 2 Berlin Brats Alumni Association Newsletter Berlin Brats Alumni Association Newsletter 3 On SeptemberColumbus, 21st, 2019, about 15 Brats, faculty, andOhio Museum -- andregional a personal tour by the Museum’s Presi- spouses gathered in Columbus, OH, for a regional that dent/CEO, Lt. Gen. (Ret) Mike Ferriter ‘75. included a visit to the new Veterans Memorial and From L to R: Kathleen Hildenbrand ‘91, Joel Koffley ‘75, Liz Cleve- land-spouse, Mike Cleveland ‘61, Mike Ferriter ‘75, Margie Ferriter- spouse, Jeri (Polansky) Glass ‘72, DeeDee Whitney-spouse, David Whitney ‘85, Mr. Adam Hildenbrand FAC ‘69-’94, Patty (Frey) Borja ‘68, and Contance (Frey) Chappelear TAR Brat. Not pictured: Sean O’Day ‘76 and Kelly O’Day ‘78. Top center and right: The General - Lt. -

The Fall of the Berlin Wall the Fall of the Berlin Wall
Kathleen Tracy Kathleen Kathleen Tracy Kathleen The Fall of The Fall of And the walls came tumbling down. the Berlin Wall the Berlin Wall 3/2/07, 2:59 PM MMMONUMENTAL MILESTONES THE FALL OF THE BERLIN WALL Mitchell Lane HE HE OF OF B B M M ALL ALLTHE THE WALL W ALL ERLIN ERLIN 90000 ISBN 1-58415-405-5 781584 154051 9 The Fall of The Fall of oppression and the Berlin Wall the Berlin Wall 1 In the end, the Wall fell without a shot being Wall In the end, the There is perhaps no greater symbol of both political the human spirit in the 20th century than the Built dur- Wall. Berlin ing the height of the in 1961, the War Cold was meant to both stop the number of citizens Wall trying to leave East Germany for the freedoms and and to prevent people West opportunities of the spreading the ideals of democracy from coming in. stood, it is estimated over Wall In the 28 years the West 1,000 people were killed trying to escape into Berlin. As Mikhail Gorbachev was laying the founda- fired. tions for the peaceful dismantling of the Soviet Union, the people of East Berlin and East Germany began demanding their city and country be freed in November 1989, from Soviet occupation. Finally, was torn down and Germany was once Wall the This is the story of the dark rise and again reunited. that split Wall the eventual uplifting triumph over the not only a city and nation, but friends and families. -

Sofid - Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst
soFid - Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst 02/2005 Kriminalsoziologie + Rechtssoziologie GESIS-IZ Bonn 2005 Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst soFid Kriminalsoziologie + Rechtssoziologie Band 2005/2 bearbeitet von Gisela Ross-Strajhar Mit einem Beitrag von Thomas Görgen und Arnd Hüneke Informationszentrum Sozialwissenschaften Bonn 2005 ISSN: 0176-4411 Herausgeber Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V., Bonn bearbeitet von: Gisela Ross-Strajhar Programmierung: Udo Riege, Siegfried Schomisch Druck u. Vertrieb: Informationszentrum Sozialwissenschaften Lennéstr. 30, 53113 Bonn, Tel.: (0228)2281-0 Printed in Germany Die Mittel für diese Veröffentlichung wurden im Rahmen der institutionellen Förderung der Ge- sellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS) vom Bund und den Ländern gemeinsam bereitgestellt. Das IZ ist Mitglied der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS). Die GESIS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. © 2005 Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere ist die Überführung in maschinenlesbare Form sowie das Speichern in Informationssystemen, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Einwilligung des Herausgebers gestattet. Inhalt Vorwort .............................................................................................................................................7 Thomas Görgen, Arnd Hüneke "Ältere Menschen als Opfer