Umstrittene Sammlungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dueling, Honor and Sensibility in Eighteenth-Century Spanish Sentimental Comedies
University of Kentucky UKnowledge University of Kentucky Doctoral Dissertations Graduate School 2010 DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES Kristie Bulleit Niemeier University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Niemeier, Kristie Bulleit, "DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES" (2010). University of Kentucky Doctoral Dissertations. 12. https://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/12 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in University of Kentucky Doctoral Dissertations by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACT OF DISSERTATION Kristie Bulleit Niemeier The Graduate School University of Kentucky 2010 DUELING, HONOR AND SENSIBILITY IN EIGHTEENTH-CENTURY SPANISH SENTIMENTAL COMEDIES _________________________________________________ ABSTRACT OF DISSERTATION _________________________________________________ A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the University of Kentucky By Kristie Bulleit Niemeier Lexington, Kentucky Director: Dr. Ana Rueda, Professor of Spanish Literature Lexington, Kentucky 2010 Copyright © Kristie Bulleit Niemeier 2010 ABSTRACT OF DISSERTATION DUELING, HONOR AND -

Saraband for Dead Lovers
Saraband for Dead Lovers By Helen de Guerry Simpson Saraband for Dead Lovers I - DUCHESS SOPHIA "I send with all speed," wrote Elizabeth-Charlotte, Duchesse d'Orléans, tucked away in her little room surrounded by portraits of ancestors, "to wish you, my dearest aunt and Serene Highness, joy of the recent betrothal. It will redound to the happiness of Hanover and Zelle. It links two dominions which have long possessed for each other the affection natural to neighbours, but which now may justly embrace as allies. It appears to me that no arrangement could well be more suitable, and I offer to the high contracting parties my sincerest wishes for a continuance of their happiness." The Duchess smiled grimly, dashed her quill into the ink, and proceeded in a more homely manner. "Civilities apart, What in heaven's name is the Duke of Hanover about? This little Sophie-Dorothée will never do; she is not even legitimate, and as for her mother, you know as well as I do that Eléonore d'Olbreuse is nothing better than a French she-poodle to whom uncle George William of Zelle treated himself when he was younger, I will not say more foolish, and has never been able to get rid of since. What, with all respect, was your husband thinking of to bring French blood into a decent German family, and connected with the English throne, too! In brief, my dearest aunt, all this is a mystery to me. I can only presume that it was concluded over your head, and that money played the chief role. -

Speech by HIH the Prince Napoleon Governor
Speech by HIH The Prince Napoleon Governor-General, Your Imperial and Royal Highness, Your Royal Highnesses, Your Grand Ducal Highnesses, Your Serene Highnesses, Your Illustrious Highness, Your Excellencies, Your Grace, My Lords, Reverend Fathers, Ladies and Gentlemen I am truly delighted to Be here this evening in the heart of this ancient city of London. May I Begin By expressing my sincere thanks to the Lord Mayor and Court of Common Council for electing me to the freedom of this ancient city of London and to the ChamBerlain of London and his Clerk for presiding at the ceremony earlier this evening. I would also like to thank my proposer and good friend Sir Anthony Bailey and the 675th Lord Mayor of this city Sir Gavyn Arthur for proposing me for this singular honour. Thank you too for your kind words, dear Anthony, and to all those who have organised this celebration which touches me deeply. This gathering takes place at a moment of exceptional communion between our two great cities and countries much like ten years ago when London suffered the same terrorist aggressions. I was very moved when last week all British and French supporters and players at WemBley stadium, sang together the God Save the Queen and La Marseillaise. As a descendant of "Bony", "l'ennemi juré", I would like to express my deepest gratitude. I have lived for 3 years so far in London, a city I learned to love and admire, and where I learned the world and its complexities. I rememBer my first arrival By Eurostar at Waterloo station. -

1822: Cain; Conflict with Canning; Plot to Make Burdett the Whig Leader
1 1822 1822: Cain ; conflict with Canning; plot to make Burdett the Whig leader; Isaac sent down from Oxford, but gets into Cambridge. Trip to Europe; the battlefield of Waterloo; journey down the Rhine; crossing the Alps; the Italian lakes; Milan; Castlereagh’s suicide; Genoa; with Byron at Pisa; Florence; Siena, Rome; Ferrara; Bologna; Venice; Congress of Verona; back across the Alps; Paris, Benjamin Constant. [Edited from B.L.Add.Mss. 56544/5/6/7.] Tuesday January 1st 1822: Left two horses at the White Horse, Southill (the sign of which, by the way, was painted by Gilpin),* took leave of the good Whitbread, and at one o’clock (about) rode my old horse to Welwyn. Then [I] mounted Tommy and rode to London, where I arrived a little after five. Put up at Douglas Kinnaird’s. Called in the evening on David Baillie, who has not been long returned from nearly a nine years’ tour – he was not at home. Wednesday January 2nd 1822: Walked about London. Called on Place, who congratulated me on my good looks. Dined at Douglas Kinnaird’s. Byng [was] with us – Baillie came in during the course of the evening. I think 1 my old friend had a little reserve about him, and he gave a sharp answer or two to Byng, who good-naturedly asked him where he came from last – “From Calais!” said Baillie. He says he begins to find some of the warnings of age – deafness, and blindness, and weakness of teeth. I can match him in the first. This is rather premature for thirty-five years of age. -
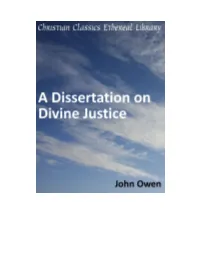
A Dissertation on Divine Justice
A Dissertation on Divine Justice Author(s): Owen, John (1616-1683) Publisher: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library Description: In A Dissertation on Divine Justice, John Owen provides his refutation of the teaching that God could pardon sin by a mere act of will, and without any satisfaction to his justice, that is, without any atonement. Owen has written extensively on the atonement before and, once again, his keen intellect and impressive argumentation can be seen here. Although A Dissertation on Divine Justice was originally a response to a theological movement called "Socinianism," it remains interesting today for its fascinating treatment of divine justice and the atonement. Tim Perrine CCEL Staff Writer i Contents A Dissertation on Divine Justice 1 Title page. 1 Prefatory note. 2 To the public. 4 To his illustrious highness Lord Oliver Cromwell. 5 The preface to the reader. 7 Title. 20 Part I. 21 Chapter I. 22 Chapter II. 28 Chapter III. 39 Chapter IV. 53 Chapter V. 70 Chapter VI. 78 Chapter VII. 83 Part II. 90 Chapter VIII. 91 Chapter IX. 95 Chapter X. 100 Chapter XI. 105 Chapter XII. 114 Chapter XIII. 117 Chapter XIV. 123 Chapter XV. 126 Chapter XVI. 134 Chapter XVII. 139 ii Chapter XVIII. 150 Indexes 157 Index of Scripture References 158 Index of Citations 161 Index of Names 164 Greek Words and Phrases 168 Latin Words and Phrases 169 Index of Pages of the Print Edition 172 iii This PDF file is from the Christian Classics Ethereal Library, www.ccel.org. The mission of the CCEL is to make classic Christian books available to the world. -
Black Germany: the Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884–1960 Robbie Aitken and Eve Rosenhaft Index More Information
Cambridge University Press 978-1-107-04136-3 - Black Germany: The Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884–1960 Robbie Aitken and Eve Rosenhaft Index More information Index Abbott, Robert S., 111, 145, 216 Antelmann, Bruno, 56–7, 59–60 Abyssinia, 207 Anumu, (Heinrich Ernst) Wilhelm, 105, Adam, Ahmed, 129 129, 134, 158 Adenauer, Konrad, 185 Aqua-Kaufmann, Zoya, 261, 270, 276, 278, African American (See also Robert 321, 324–6 S. Abbott, James Ford, Roi Ottley, Askari see military service Joel Augustus Rogers, Edward asocial, internment as, 274, 325 B. Toles, Scottsboro campaign) Association for German Settlement and experience of community, 5 Migration see Vereinigung für individuals in Nazi Germany, 253, 273–4 deutsche Siedlung und Wanderung interactions with Afro-Germans, 4, 153, Association France-Cameroun, 289–91 212, 216 Association of German-Spirited Cameroon press, reporting on Germany, 111, 114, Natives see Kamerun Eingeborenen 145, 154, 234, 248, 265, 273, 294–5 Deutsch Gesinnten Verein troops in Germany, 322, 327 Atangana, Karl, 81, 132, 172–3, 182–5 visitors to Germany, 111, 123, 163, 314, Atangana, Katharina, 177, 182–5, 319 319, 322 Atemengue, Joseph, 185 African Fruit Company, 227 Atoy, Thomas see Thoy Esomber African Training Institute, Wales, 42 Attang, Julius, 56 African Welfare Association Austerlitz, Gare d’, 314 see Afrikanischer Hilfsverein Auvergne, 307 Afrikanischer Hilfsverein, 129–31, 135, Awoudi, 84 203, 205, 209 Ayim, May see May Opitz Ahlert (Berlin butcher), 56 Akwa, Betote, 226 Bakari, Mtoro bin Mwinyi, -

The Lives of the Chief Justices of England
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com I . i /9& \ H -4 3 V THE LIVES OF THE CHIEF JUSTICES .OF ENGLAND. FROM THE NORMAN CONQUEST TILL THE DEATH OF LORD TENTERDEN. By JOHN LOKD CAMPBELL, LL.D., F.E.S.E., AUTHOR OF 'THE LIVES OF THE LORd CHANCELLORS OF ENGL AMd.' THIRD EDITION. IN FOUE VOLUMES.— Vol. IT;; ; , . : % > LONDON: JOHN MUEEAY, ALBEMAELE STEEET. 1874. The right of Translation is reserved. THE NEW YORK (PUBLIC LIBRARY 150146 A8TOB, LENOX AND TILBEN FOUNDATIONS. 1899. Uniform with the present Worh. LIVES OF THE LOED CHANCELLOKS, AND Keepers of the Great Seal of England, from the Earliest Times till the Reign of George the Fourth. By John Lord Campbell, LL.D. Fourth Edition. 10 vols. Crown 8vo. 6s each. " A work of sterling merit — one of very great labour, of richly diversified interest, and, we are satisfied, of lasting value and estimation. We doubt if there be half-a-dozen living men who could produce a Biographical Series' on such a scale, at all likely to command so much applause from the candid among the learned as well as from the curious of the laity." — Quarterly Beview. LONDON: PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, STAMFORD STREET AND CHARINg CROSS. CONTENTS OF THE FOURTH VOLUME. CHAPTER XL. CONCLUSION OF THE LIFE OF LOKd MANSFIELd. Lord Mansfield in retirement, 1. His opinion upon the introduction of jury trial in civil cases in Scotland, 3. -

Cornelius O'dowd Her Bridesmaids." Charles Lever, 207 Box for the Season 230 Bernard Marsh Author Of" Charlie Thornhill." I G, P, R, James
ORNEU 0 m> MR. - l.MtfS^ «JPPN MEN AND WOMEN AND i OTHER THINGS IN GEMrRAI THE SELECT LIBRARY OF FICTION. The best, cheapest, and most POPULAR WORKS published, well printed in clear, readable type, on good paper, and strongly bound. Containing the ivritings of the most popular Authors of the day. TWO SHILLING VOLUMES. When ordering, the Numbers only need be giuen. VOL. VOL. I Agatha's Husband 76 Beppo the Conscript Author of " John Halifax. T. A. 'froUope. a Head of the Family 77 Woman's Ransom Author of " John Halifax. F. W. Robinson. 78 Deep Waters Anna H. Drury, 5 The Ogilvles Author of " fob atlon Anna H. Drury, 7 Olive : a Novel a Whyte Melville, Author of "1 oh HDBERT W WOODRUFF e a Gentleman 17 Jack Hinton, the Gi LIBRARY Samuel Lover, Ch ray 22 Harry Lorrequei's C( '" Otuen ; a Waif." Ch notsof Ballycloran 27 The O'Donoghue Ch Anthony Trollope, Xt Fortunes of Glencote :iase T, A, Trollope. Ch Anthony Trollope. 35 One of Them Ch .rran Charles Lever, 48 Sir Jasper Carew Ch F W. Robinson, 53 A Day's Ride: a Life and Legends a. Samuel Lover. 55 Constable of the Tc ind the O'Kellys fV. H, Aiiisworth. Anthony Trollope. 58 Master of the Hounds"5'i:r«fa/or.'' 94 Married Beneath Him Author of " Found Dead.'" 63 The Hunchback of Notre-Dame 95 Tales of all Countries Victor Hugo, Anthony Trollope. 65 Lord Mayor of London 96 Castle Richmond W, H. Aimiuorth. Anthony Trollope. 66 Elsie Venner 0. -

Don Juan Study Guide
Don Juan Study Guide © 2017 eNotes.com, Inc. or its Licensors. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution or information storage retrieval systems without the written permission of the publisher. Summary Don Juan is a unique approach to the already popular legend of the philandering womanizer immortalized in literary and operatic works. Byron’s Don Juan, the name comically anglicized to rhyme with “new one” and “true one,” is a passive character, in many ways a victim of predatory women, and more of a picaresque hero in his unwitting roguishness. Not only is he not the seductive, ruthless Don Juan of legend, he is also not a Byronic hero. That role falls more to the narrator of the comic epic, the two characters being more clearly distinguished than in Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage. In Beppo: A Venetian Story, Byron discovered the appropriateness of ottava rima to his own particular style and literary needs. This Italian stanzaic form had been exploited in the burlesque tales of Luigi Pulci, Francesco Berni, and Giovanni Battista Casti, but it was John Hookham Frere’s (1817-1818) that revealed to Byron the seriocomic potential for this flexible form in the satirical piece he was planning. The colloquial, conversational style of ottava rima worked well with both the narrative line of Byron’s mock epic and the serious digressions in which Byron rails against tyranny, hypocrisy, cant, sexual repression, and literary mercenaries. -

The Ginger Fox's Two Crowns Central Administration and Government in Sigismund of Luxembourg's Realms
Doctoral Dissertation THE GINGER FOX’S TWO CROWNS CENTRAL ADMINISTRATION AND GOVERNMENT IN SIGISMUND OF LUXEMBOURG’S REALMS 1410–1419 By Márta Kondor Supervisor: Katalin Szende Submitted to the Medieval Studies Department, Central European University, Budapest in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies, CEU eTD Collection Budapest 2017 Table of Contents I. INTRODUCTION 6 I.1. Sigismund and His First Crowns in a Historical Perspective 6 I.1.1. Historiography and Present State of Research 6 I.1.2. Research Questions and Methodology 13 I.2. The Luxembourg Lion and its Share in Late-Medieval Europe (A Historical Introduction) 16 I.2.1. The Luxembourg Dynasty and East-Central-Europe 16 I.2.2. Sigismund’s Election as King of the Romans in 1410/1411 21 II. THE PERSONAL UNION IN CHARTERS 28 II.1. One King – One Land: Chancery Practice in the Kingdom of Hungary 28 II.2. Wearing Two Crowns: the First Years (1411–1414) 33 II.2.1. New Phenomena in the Hungarian Chancery Practice after 1411 33 II.2.1.1. Rex Romanorum: New Title, New Seal 33 II.2.1.2. Imperial Issues – Non-Imperial Chanceries 42 II.2.2. Beginnings of Sigismund’s Imperial Chancery 46 III. THE ADMINISTRATION: MOBILE AND RESIDENT 59 III.1. The Actors 62 III.1.1. At the Travelling King’s Court 62 III.1.1.1. High Dignitaries at the Travelling Court 63 III.1.1.1.1. Hungarian Notables 63 III.1.1.1.2. Imperial Court Dignitaries and the Imperial Elite 68 III.1.1.2. -

Dynamics of Indigenous Socialization Strategies and Emotion Regulation Adjustment Among Nso Early Adolescents, North West Region of Cameroon
International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) Volume 3, Issue 8, August 2016, PP 86-124 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0308009 www.arcjournals.org Dynamics of Indigenous Socialization Strategies and Emotion Regulation Adjustment among Nso Early Adolescents, North West Region of Cameroon Therese Mungah Shalo Tchombe Ph.D. Emeritus Professor of Applied Cognitive Developmental Psychology, UNESCO Chair for Special Needs Education, University of Buea, Cameroon P.O. Box 63 Director, Centre for Research in Child and Family Development & Education (CRCFDE) P.O. Box 901, Limbe, Cameroon Tani Emmanuel Lukong, Ph.D. Lecturer, University of Buea, Founder, “Foundation of ScientificResearch, Community Based Rehabilitation and Advocacy on Inclusive Education” (FORCAIE-CAMEROON) [email protected] Abstract: Cultural values vary across cultures and social ecologies. Cultural communities define and endorse human abilities they perceive to give expression to their core values. This study aimed to examine the interaction among specific indigenous strategies of socialization such as indigenous proverbs, and indigenous games) within an eco-cultural setting which dictate a more cultural specific dimension on emotion regulation adjustment with keen attention on social competence skills and problem solving skills through an indigenized conceptual model of the Nso people of Cameroon. The study had three objectives; the study had a sample of 272. Results indicate that, proverbs -

The Nerevarine Chronicles
The Nerevarine Chronicles Peace and Prosperity The kingdom of Avalon had existed for nearly a millennium, enjoying peace and prosperity for many of those centuries. In the ebb and flow of time, the races of Avalon united when necessary to converge on a common foe. For the most part, however the dwarves and elves tended to themselves and let the humans, with their shorter life spans, micro-manage the kingdom. As was the custom among humans at the time, people were addressed first by their surname and then their given name. The family name had taken precedence some generations prior, when the Great Houses of Northwind took prominence. Each ruling family was designated as House so-and-so. It did not take long for the custom to trickle out to the human rulers in Dai-Rynn and Dormack. The Great Houses were sometimes referenced by the family crest. House Dagoth, who were worshippers of Pelor, sported a rising sun above a sword, and was commonly called the Sun-and-Sword. House Indoril was called the Moon-and-Star, after their crest, which resembled a tiny slice of the night sky. House Indoril followed Heironeous and the origin of their crest remains a mystery. After the events surrounding the Nerevarine Prophecies, however, this all but ended. Family names were held with honor and pride, but took no more importance over the individual than they had prior. The Great Houses stopped referring to each other as such and that era was left in the wake of these unfortunate events to fade only into the annals of history.