Jahrbuch Diakonie Schweiz (JDS)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MEDICA Management & Spezial Krankenhaus Zeitung Für Entscheider Im Gesundheitswesen
MEDICA Management & Spezial Krankenhaus Zeitung für Entscheider im Gesundheitswesen Oktober · 10/2011 · 30. Jahrgang Twittern und Co. für mehr Patienten „Time is brain“ Marktübersicht POCT Themen Facebook, Twitter und Google+ sind für Bei ersten Symptomen eines Schlaganfalls Was ist neu, was ist besser? Messtechnisch Gesundheitsökonomie Unternehmen keine Trends, sondern ernst- muss der Patient so schnell wie möglich in ausgereifte, moderne Geräte für die POCT Krankenhaus und Markenimage 5 zunehmenden Marketing-Instrumente. Auch eine spezialisierte Klinik gebracht werden. Diagnostik. Seite 32–34 Eine Klinik zu führen, heißt auch, sie im Kliniken werden kaum noch darauf verzich- Seite 11 Marktumfeld unverwechselbar zu ten können. Seite 4 positionieren. Medizin & Technik Mitarbeiter im Mittelpunkt 9 Initiative will erfahrene Mitarbeiter aus OP und Anästhesie in ihrem Tätigkeitsfeld halten und neue Fachkräfte gewinnen. Gezielte Tumorbestrahlung Hüftprothese - Pro und Contra 10 Ist ein Gelenk erhaltender operativer Eingriff sinnvoll und möglich? Die Stahlentherapie am Koronare Herzerkrankung 12 Universitätsklinikum Die Rolle der Echokardiographie bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung Münster (UKM) erhält durch die Einweihung eines neuen IT & Kommunikation Lückenlose Bewegungsmuster 17 Beschleunigers neue und Energieeffiziente Chip-Technologien, Smartphones und Webplattformen als moderne Behandlungsmög- Basis mobiler Medical Monitoring Systeme FallAkte als Baukasten-System 20 lichkeiten. Dr. Jutta Jessen Der Verein elektronische FallAkte entwickelt mit dem Fraunhofer Institut für sprach mit der Leitenden Software- und Systemtechnik das Konzept „eFA in a box“. Oberärztin der Klinik für Strahlentherapie am UKM, Pharma Kürzere Bestrahlungszeiten, verbesserte Genauigkeit und höchste Leistungsfähigkeit Geschlechtsspezifische Medika- Dr. Iris Ernst. – Anfang August wurde der erste Patient mit dem neuen Gerät bestrahlt. mente 21 Neuste Ergebnisse zeigen einen deutlichen Unterschied im Stoffwechsel M&K: Was sind die besonderen Vorteile von Männern und Frauen. -

KMFDM Kunst Mp3, Flac, Wma
KMFDM Kunst mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Electronic / Rock Album: Kunst Country: Germany Released: 2013 Style: Alternative Rock, Industrial MP3 version RAR size: 1180 mb FLAC version RAR size: 1853 mb WMA version RAR size: 1600 mb Rating: 4.8 Votes: 808 Other Formats: AA AIFF MPC WAV AHX MIDI FLAC Tracklist Hide Credits 1 Kunst 5:01 2 Ave Maria 5:06 3 Quake 4:05 4 Hello 4:24 5 Next Big Thing 4:41 6 Pussy Riot 4:10 7 Pseudocide 3:36 8 Animal Out 5:06 The Mess You Made Feat. Morlocks 9 6:05 Featuring – Morlocks 10 I ♥ Not 4:32 Companies, etc. Licensed From – Metropolis Records – MET 851 Barcode and Other Identifiers Barcode: 4 042564 135480 Label Code: LC 10270 Other versions Category Artist Title (Format) Label Category Country Year MET851D KMFDM Kunst (10xFile, MP3, Album, 320) Metropolis MET851D US 2013 MET851 KMFDM Kunst (LP, Album, Ltd) Metropolis MET851 US 2013 MET851 KMFDM Kunst (CD, Album) Metropolis MET851 US 2013 MET851D KMFDM Kunst (10xFile, FLAC, Album) Metropolis MET851D US 2013 MET 851D KMFDM Kunst (10xFile, ALAC, Album) Metropolis MET 851D US 2013 Comments about Kunst - KMFDM Malann I changed my previous review. Favorites songs are Kunst, Quake, and Next Big Thing. The_NiGGa wtf?! you better listen to Kunst once or twice again a bit more concentrated. KMFDM doesn't deserves a rezension of someone listening to it only once and then keep thinking he understood everything! Kunst has the typical kmfdm trademarks. Jules guitars sounds much more improved than before (if you like to hear Günter Schulz you should listen to slick idiot). -

Presumption of Innocence: Procedural Rights in Criminal Proceedings Social Fieldwork Research (FRANET)
Presumption of Innocence: procedural rights in criminal proceedings Social Fieldwork Research (FRANET) Country: GERMANY Contractor’s name: Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. Authors: Thorben Bredow, Lisa Fischer Reviewer: Petra Follmar-Otto Date: 27 May 2020 (Revised version: 20 August 2020; second revision: 28 August 2020) DISCLAIMER: This document was commissioned under contract as background material for a comparative analysis by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) for the project ‘Presumption of Innocence’. The information and views contained in the document do not necessarily reflect the views or the official position of the FRA. The document is made publicly available for transparency and information purposes only and does not constitute legal advice or legal opinion. Table of Contents PART A. EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... 1 PART B. INTRODUCTION ............................................................................................................... 4 B.1 PREPARATION OF FIELDWORK ........................................................................................... 4 B.2 IDENTIFICATION AND RECRUITMENT OF PARTICIPANTS ................................................... 4 B.3 SAMPLE AND DESCRIPTION OF FIELDWORK ...................................................................... 5 B.4 DATA ANALYSIS ................................................................................................................. -

Project Pitchfork Lacuna Coil Helium Vola Funker Vogt KMFDM Schandmaul Sara Noxx Whispers in the Shadow
APRIL / MAI 09 AUSGABE 19 - JAHRGANG 4 PROJECT PITCHFORK LACUNA COIL HELIUM VOLA FUNKER VOGT KMFDM SCHANDMAUL SARA NOXX WHISPERS IN THE SHADOW TIS ZUM SCHANDMAUL LACUNA COIL HELIUM VOLA GRA MITNEHMEN EDITORIAL INHALT Der Winterschlaf ist nun endlich vorbei und der 5 Tourdaten Frühling lockt auch jeden noch so Tiefschwarzen 5 Kolumne Schementhemen ins Sonnenlicht. Große Events werfen ihre Schat- 7 Soundcheck ....in diesen Läden gibt es das NEGAtief ten, wie z.B. das WGT in Leipzig, in dessen Rah- 8 Festival: Gothika Messe Media Markt: Aschaffenburg, Augsburg, Bad Dürrheim, Bo- men wir auch wieder mit einem Stand vertreten chum, Chemnitz, Dessau, Dresden-Nickern, Duisburg, Flensburg, 9 Club: Dust and Dawn Goslar, Groß Gaglow, Günthersdorf, Heide, Heilbronn, Herzo- sein werden. Übrigens: Wer schnell genug vorbei Wendlingen genrath, Hildesheim, Kaiserslautern, Karlsruhe, Koblenz, Krems, schaut, erhält auch wieder, wie letztes Jahr eine 33 Label: Prussia Records Leoben, Limburg, Linz, Magdeburg, Memmingen, München, Gratiskompilation. Der Dark Alliance Sampler 36 Festival: Rock Area Festival Nürnberg-Kleinreuth, Oldenburg, Pforzheim, Porta Westfalica, enthält Songbeiträge der interessantesten 50 Hörspiel: Sacred 2 Reutlingen, Saarbrücken ,Sindelfingen, Stuttgart, Trier, Viernheim, Newcomer und Neuveröffentlichungen dieser Vössendorf, Weiterstadt, Wien, Wien Hietzing, Wiesbaden Tage. Bereits im letzten Jahr war die Auflage 56 Arts of Erebus Saturn: Augsburg, Bad Oeynhausen, Bergisch Gladbach, von 10000 Umsonstsamplern innerhalb der er- 19 Caisaron Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, sten beiden Tage vergriffen. Wir freuen uns auf 58 Dead Guitars Düsseldorf, Erfurt, Essen, Euskirchen, Frankfurt, Gelsenkirchen, alle Fälle wieder auf Euren Besuch und viele 21 Excubitors Gelsenkirchen, Göttingen, Graz, Hagen, Halle, Hamburg, Hamm, Hanau, Hannover, Ingolstadt, Kaiserslautern, Karls- inspirierende Gespräche. -
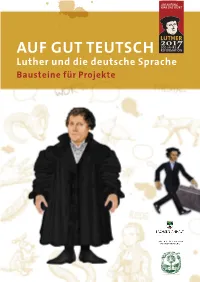
Projektmaterialien PDF-Dokument
r auf gut teutsch Luther und die deutsche Sprache Bausteine für Projekte auf gut teutsch Luther und die deutsche Sprache 1. Vorbemerkung Seite 2 2. Einführungsfilm Seite 3 3. Luthers Fabeln Seite 6 4. Sprichwörter – Redewendungen Seite 17 5. Wortschöpfungen Seite 23 6. Übersetzung Seite 30 7. Luthers Lieder Seite 33 8. Wie sagen wir es heute ? Seite 41 9. Sprechwerkstatt – Anleitung zu den Übungen Seite 52 10. Ein guter Redner – „Speakers' Corner“ Seite 54 11. Die Bedeutung der Sprache in Konflikten Seite 71 12. Schimpfwörter – Was darf man sagen ? Seite 75 13. Unterschiedliche Sprachen – Viele Erfahrungen und Chancen Seite 77 14. Wenn Wörter reisen Seite 79 15. Gutes Benehmen – Wie mache ich es richtig ? Seite 88 16. Richtig oder falsch ? Wortunfälle – Wortspielereien Seite 94 17. Dialekte Seite 97 18. Schreibübung – Die Entwicklung der Schrift Seite0 10 19. Schriftdetektive Seite4 10 20. Alphabete – Alte Schwabacher, Kurrent, Sütterlin Seite4 11 21. Hinweise, Weiterführendes Seite7 11 1 1. Vorbemerkung Luther legte mit seiner Bibelübersetzung die Grundlagen der heutigen deutschen Sprache. Das Ziel, eine für das ganze Volk verständliche Bibelübersetzung zu schaffen, verfolgte er mit großem Einsatz und mit der Unterstützung seines besten Freundes Philipp Melanchthon. Luther wollte keine wörtliche Bibelübersetzung, sondern eine für alle Menschen verständliche Heilige Schrift. Sein großes Verdienst war es, dem Volk aufs Maul zu schauen, dessen Sprechweise für seine Übersetzung zu nutzen und damit der Entwicklung einer einheitlichen deutschen Sprache einen entscheidenden Schub zu geben. Die Sprachgewalt Luthers wird auch in seinen Wortschöpfungen, Sprichwörtern und Redewendungen deutlich. Uns ist oft gar nicht bewusst, dass Wörter wie Feuereifer, Beruf oder Machtwort von Luther stammen. -

Rage in Eden Records, Po Box 17, 78-210 Bialogard 2, Poland [email protected]
RAGE IN EDEN RECORDS, PO BOX 17, 78-210 BIALOGARD 2, POLAND [email protected], WWW.RAGEINEDEN.ORG Artist Title Label HAUSCHKA ROOM TO EXPAND 130701/FAT CAT CD RICHTER, MAX BLUE NOTEBOOKS, THE 130701/FAT CAT CD RICHTER, MAX SONGS FROM BEFORE 130701/FAT CAT CD ASCENSION OF THE WAT NUMINOSUM 13TH PLANET RECORDS CD MINISTRY COVER UP 13TH PLANET RECORDS CD MINISTRY LAST SUCKER, THE 13TH PLANET RECORDS CD MINISTRY LAST SUCKER, THE 13TH PLANET RECORDS LTD MINISTRY RIO GRANDE BLOOD 13TH PLANET RECORDS CD MINISTRY RIO GRANDE DUB YA 13TH PLANET RECORDS CD PRONG POWER OF THE DAMAGER 13TH PLANET RECORDS CD REVOLTING COCKS COCKED AND LOADED 13TH PLANET RECORDS CD REVOLTING COCKS COCKTAIL MIXXX 13TH PLANET RECORDS CD BERNOCCHI, ERALDO/FE MANUAL 21ST RECORDS CD BOTTO & BRUNO/THE FA BOTTO & BRUNO/THE FAMILY 21ST RECORDS CD FLOWERS OF NOW INTUITIVE MUSIC LIVE IN COLOGNE 21ST RECORDS CD LOST SIGNAL EVISCERATE 23DB RECORDS CD SEVENDUST ALPHA 7 BROS RECORDS CD SEVENDUST CHAPTER VII: HOPE & SORROW 7 BROS RECORDS CD A BLUE OCEAN DREAM COLD A DIFFERENT DRUM MCD A BLUE OCEAN DREAM ON THE ROAD TO WISDOM A DIFFERENT DRUM CD B!MACHINE ALTERNATES AND REMIXES A DIFFERENT DRUM CD B!MACHINE EVENING BELL, THE A DIFFERENT DRUM CD B!MACHINE FALLING STAR, THE A DIFFERENT DRUM CD B!MACHINE MACHINE BOX A DIFFERENT DRUM BOX BLUE OCTOBER ONE DAY SILVER, ONE DAY GOLD A DIFFERENT DRUM CD BLUE OCTOBER UK INCOMING 10th A DIFFERENT DRUM 2CD CAPSIZE A PERFECT WRECK A DIFFERENT DRUM CD COSMIC ALLY TWIN SUN A DIFFERENT DRUM CD COSMICITY ESCAPE POD FOR TWO A DIFFERENT DRUM CD DIGNITY -

Mixed Pickles Plate
[Hei tippen] Mixed Pickles von Henri Regenwetter Eingelegte sowie gemischte Elukubrationen, Mit bio – logisch kultiviertem Pep Bebildert * N.B. Der Genuss dieser Ware ist keinesfalls Gesundheitsge- fährdend. * II Plate December 2016 3rd revised version – Jan. 2017 1 [Hei tippen] Inhaltsverzeichnis Ein Karneol, ein Amethyst und ein Smaragd Der verschwundene Galgen Madeira Reisenbericht Toskana Reisebericht Flussschifffahrt auf der Donau Reisebericht Memoiren eines Geldscheines (Essay) Autobiografisches Gegen die Frauen Zoologisch gesteigert, ‚ Den Zongeschlag‘ Der Knadderer Kleingeld Kulinarisch aufgeblättert Small Brothers Das Ei des Kolumbus Federvieh und Hanewacker gefällig Das schwarze Loch der Banken Robbery Im Autorenlexikon? Ausgeschlossen! Das Erwachen im Turm Si tacuisses philosophus mansisses Kontrolle Variationen auf das Thema Der Test Leberwurst Die Irin, Kurzauftritt Es wird persönlicher und religiöser Fischers Fritze fischt frische Fische Der Irin 2ter und letzter Auftritt Unterbrechung, Kulinarisches ist angesagt Und dann endlich - zum Nichtraucher Orakel, ein Debakel Das Placebo Plastik, nicht nur Evolution = Revolution Mimik Ökologisches Gleichgewicht. Plagiat Kunden gesucht Nachtrag Inke Dätsch. De Siegfried an t’Melusina De Porette Jhang Bis dass de „Koll“ Iech platzt Eng Mandarine, waat alles déi ka bewierken. 2 [Hei tippen] Vum Misch a sengem Mupp Mike Vun “ze fill” bis “nett genuch” E ganz klengen Theater Eng Nuecht ennert dem Buedem T’Heckeréischen De Göllenen Regulus Advent Weihnachten in der Pussta Der Blick zurück -
Klaus Eberhartinger
DAS ÖSTERREICHISCHE MÄNNERMAGAZIN Gert Winkler 1942–2016 #W409 Zucchero. Sugar Fornaciari über Miles, Clapton, Pavarotti und die Flüchtlinge. Mia Nova. Sie geigt bei Russkaja, nun startet sie solo durch. Wir gehen mit ihr baden. Es pökelt. Das Comeback der archaischsten Form von Fleischeslust. Werte Männer, MÄNNERWERTE! Gibt's die noch? Hat die wer? Sind die alle gleich? Und die Leiden der jungen Werte? Wieser, Pototschnig, Klimek, Rebhandl, Wemer, Glavinic und Lessing berichten von der Front. 36. Jg. P.b.b., 11Z038942M, Retouren an Postfach 100, 1350 Wien, Josel & Sauer GmbH, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien 4,20 EURO Cover-JungeWerte_bh.indd 1 09.02.2016 14:30:22 Hat doch eh jeder. 0€ 25€ 0€ 35€ Samsung Galaxy A3 (2016) Samsung Galaxy A5 (2016) Nur bei Drei: Das Samsung Galaxy A3 und A5 (2016). Im besten Netz Österreichs. 20 € Servicepauschale /Jahr. Tarif pro Monat. 69 € Aktivierungsentgelt. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Details: www.drei.at H3G16010_3Superphone_Wiener_U2_SG_A3_A5_210x278mm_+4_ISOcoatedV2_300_RZ.indd 1 01.02.16 11:42 EDITORIAL meinen wir eigentlich eh alle nur Geldbe- träge auf Preisschildern an Luxusartikeln Wann ist ein von Rolex über Porsche bis Montblanc? Dann war Köln, und die Werte wurden Mann ein Mann? Causa Prima. Jeder war stante pede Werte-Experte, alle kannten sich plötzlich Unsereins hält es da – um bei den aus. Und noch schlimmer: Alle hatten – Schlagern zu bleiben – sowieso mehr mit zumindest für Facebook – dazu eine „Müllers Büro“ und dem dortigen Ernie- Meinung, die sich freilich im Halbtages- Seuberth-Klassiker „Männer haben Er- rhythmus wandelte. Da kommt man als folg.“ Das ist selbstironischer („Wo ist das Monatsmagazin nicht mit. -

Gesamtinhalt
Das Argument Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften Herausgegeben von Frigga Haug und Wolfgang Fritz Haug 1988/89 schrieben unter anderen Günther Anders, Gerhard Armanski, Etienne Balibar, Theodor Bergmann, Volker Braun, Noam Chomsky, Cynthia Cockburn, Irene Dölling, Helmut Fleischer, Andre Gunder Frank, Donna Haraway, Gerhard Hauck, Karlheinz A. Geißler, Heiner Goebbels, Stuart Hall, CH. Hermansson, Klaus Heinrich, Jutta Held, Eckard Holler, Pietro Ingrao, Mechtild Jansen, Bob Jessop, Heiner Keupp, Helga Königs• dorf, Annette Kuhn, Georges Labica, Eberhard Lämmert, Norman Levine, Claus Leggewie, Sven-Eric Liedman, Alain Lipietz, Utz Maas, Wolfgang Nitsch, Joachim PereIs, Ruth Rehmann, Karen Ruoff, Klaus Segbers, Su Shaozhi, Christian Sigrist, Dorothee Sölle, Peter Paul Zahl, Rainer Zoll Redaktion Volker Gransow, Sibylle Haberditzl, Frigga Haug, Wolfgang Fritz Haug, Peter Jehle, Thomas Laugstien, Nora Räthzel, Jan Rehmann, Jo Rodejohann, Werner van Treeck, Thomas Weber, Frieder O. Wolf, Gerhard Zimmer Autonome Frauenredaktion Sünne Andresen, Frigga Haug, Kornelia Hauser, Barbara Ketelhut, Jutta Meyer Siebert, Eva Stäbler, Ellen Woll Korrespondierende Redaktionsmitglieder Georg Auernheimer, Claudia Gdaniec, Karl-Heinz Götze, Michael Krätke, Dieter Kramer, Hans-Jürgen PandeI , Ulrich Schmitz, Erich Wulff Redaktionsanschrijt: Onkel-Tom-Straße 64a, 1000 Berlin 37, Tel.: (030) 813 50 24 Verlagsleitung: Georg Stenzaly Umschlag: Johannes Nawrath Argument-Verlag, Rentzelstraße 1,2000 Hamburg 13, Tel., : (040) 45 6018 u. 45 36 80 Auslieferung für Buchhandel Rotation, Mehringdamm 5Ic, 1000 Berlin 61, Tel.: (030) 692 79 34 Abonnement-Auslieferung Interabo, Wendenstraße 25, Postfach 103245,2000 Hamburg I, Tel.: (040) 23 09 92 ISSN 0004-1157 Das Argument erscheint 1990 in 6 Heften (alle 2 Monate). lahresumfang 1056 (ca. 980 + LXXVI) Seiten. - Einzelheft 14.- DM; Stud . -
Representations of Law and Justice in the Work of Reinhard Jirgl Juliane
“Dasrecht & Gott sind immer beim=Stärksten, & der – Stärkste hat immer=Recht”: Representations of Law and Justice in the work of Reinhard Jirgl Juliane Horn UCL Doctoral Thesis 1 I, Juliane Horn, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Abstract The dissertation analyses the themes of Law, justice and injustice in the work Reinhard Jirgl. Jirgl, who was born in 1953 in the GDR, has published many works of prose and essays since 1990. With the exception of one novel all novels examined in this thesis are set within the context of events in recent German history. Jirgl’s representations of injustice and violence are thus closely related to or associated with, concrete historical events. The evaluation of the textual material is methodologically grounded in relevant philosophical ideas of justice, some from antiquity and others which originate from more contemporary thinkers, such as Agamben or Derrida. At the height of the Greek civilization, two main traditions of justice develop in parallel: the first, which Alasdair Macintyre calls ‘justice of effectiveness’, is marked by the belief that ‘the strong would do without justice altogether if they could’, whilst the second, which he calls ‘justice of excellence’ values justice as a key virtue which serves the common good of the polis.1 The two traditions can be traced in theory and praxis up to the present. The textual analysis shows that most of Jirgl’s examples of social practices are adequately described by the philosophical tradition which Macintyre calls ‘justice of effectiveness’. -
Künstlerbürgertum
Künstlerbürgertum TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. B OSA - TOM. 354 HUMANIORA Künstlerbürgertum – The Social Spheres of Berliner Actors in the Years 1815–1848 by Akseli Salmi TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURKU 2012 ISBN 978-951-29-5093-5 (PRINT) ISBN 978-951-29-5094-2 (PDF) ISSN 0082-6987 Painosalama – Turku, Finland 2012 To my grandfather Kaaleppi Salmi (1925–1989) who wished to become an archeologist but ended up being an engineer Contents Acknowledgements 8 Dramatis personae 10 Introduction 1. Parades 12 2. Timeframe 16 3. Methodology 21 4. Künstlerbürgertum 39 5. Sources 44 I The Background for Social Positioning 1. Family 51 2. Education 64 3. Careers 77 4. Income 89 II In the Theatre 1. Everyday Work 107 2. Theatre as Part of the Court 128 3. Glimpses of Liberalism, Nationalism and Bürgerlich Traditions in the Theatre 159 III Sphere of Publicity 1. The Cult of Stardom 179 2. Actors and the Mass Media 196 IV Representative Lifestyles 1. Representative Bürgerlich Spheres 219 2. Social Networks and Salons, Private Homes and Associations 237 3. Prominent Homes of Actors 253 V Private Life 1. The Literary Private Sphere 267 2. Family Life 287 3. Female Actors 299 Conclusion 319 Bibliography 325 Illustrations 345 Abbreviations 346 Appendix 1 Appendix 2 Acknowledgements Studying the nineteenth-century social history of Berlin was sometimes a lonely job in Finland. Luckily, I have received great support from my supervisors and peers to persist along this solitary road. I am grateful for the support I have gained from the Department of General History at The University of Turku. -

Nova Acta Paracel Sica
NOVA ACTA PARACEL SICA VI. JAHRBUCH DER SCHWEIZERISCHEN PARACELSUS-GESELLSCHAFT 1952 EINSIEDELN Schweizerische Paracelsus-Gesellschaft NOVA ACTA PARACELSICA VI. JAHRBUCH DER SCHWEIZERISCHEN PARACELSUS-GESELLSCHAFT 1952 EINSIEDELN Schweizerische Paracelsus-Gesellschaft Das Titelblatt ist die Wiedergabe eines Flugblattes auf Paracelsus von Balthasar Jenichen, entstanden vor 1565. Vgl. R. H. Blaser, Die Quelle des paracelsischen «Alterius non sit» S. 1 ff. Alle Rechte Vorbehalten Druck: Gebr. Josef & Karl Eberle, Einsicdeln Printed in Switzerland 195 a Auslieferung: Sekretariat der Schweiz. Paracelsus-Gesellschaft Einsiedeln INHALTSVERZEICHNIS Vorwort von Dr. Linus B irch ler.........................................................VII Die Quelle des paracelsischen «Alterius non sit», von Dr. R. Blaser 1 Paracelsus über Kropf- und Kropfentstehung, von + Dr. J. Strebei . 10 Paracelsus und die Spagyrik, von Dr. E. Helmrich . 1 9 Paracelsus und Rademacher, von + E. Scheidegger .... 34 Zur Geschichte der Albuminurie, sowie des Nachweises von Albumen durch Säurefällung, von + Dr. J. Strebei ..... 47 Der Begriff «Imagination» bei Paracelsus, von Dr. I. Betschart OSB. 52 Paracelsische Eschatologie zum Verständnis der Anthropologie und Kosmologie Hohenheims, von Kurt Goldammer . 68 lieber den Wert des St. Galler Manuskriptes Hohenheims, von t Dr. J. Strebei ......... 103 Paracelsus und der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus, von B. de Telepnef . .. • - • • .113 Die letzte Hohenheimerin, von Dr. J. Strebei . 120 Eine Paracelsus-Biographie aus der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, von B. de Telepnef ...... 129 Ueber den Wert der Synopsis in der Neuedition paracelsischer Werke, von + Dr. J. Strebei . - • • • .131 Paracelsus bei Sir James Jeans, von + Dr. J. Strebei . .137 Hohenheims Würdigung als Chirurg in der Geschichte der Chirurgie, von W. von Brunn . • • • • 144 V VORWORT Das Schicksal des «Magus vom Etzel* scheint oft auch das unserer Gesellschaft zu werden.