Nationalparkprogramm
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
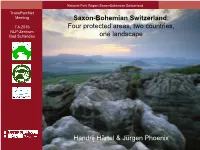
Saxon-Bohemian Switzerland Transparcnet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland
National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Four protected areas, two countries, NLP-Zentrum Bad Schandau one landscape Handrij Härtel & Jürgen Phoenix National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: Discovery by Romantic painters Adrian Zingg (1734-1816) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: One of the oldest European tourist destinations Protected areas in sandstone rock regions across the world National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Singularity in European context: NLP-Zentrum Bad Schandau 3 sandstone rock national parks only National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland 7.6.2016 as part of larger geological unit NLP-Zentrum Bad Schandau Bohemian Cretaceous Basin PL D CZ Marine fossils from Cretaceous sandstones Inoceramus labiatus Natica bulbiformis Pecten Inoceramus lamarcky National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 NLP-Zentrum High diversity of morphologic forms at different Bad Schandau spatial scales Saxon-Bohemian Switzerland: Terciary volcanism Růžovský vrch Zlatý vrch National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 geodiversity-biodiversity relations NLP-Zentrum Bad Schandau Saxon-Bohemian Switzerland: role of microclimate Saxon-Bohemian Switzerland: vertebrates Grasshopper Troglophilus neglectus New for Central Europe (Chládek, Benda & Trýzna 2000) Charissa glaucinaria Extremely rare montane species, within CZ in Bohemian Switzerland only L – Phengaris nausithous R – Phengaris telejus Monitoring of the butterflies from the gen. -

Land Use Effects and Climate Impacts on Evapotranspiration and Catchment Water Balance
Institut für Hydrologie und Meteorologie, Professur für Meteorologie climate impact Q ∆ ∆ E ● p basin impact ∆Qobs − ∆Qclim P ● ● ● P ● ● ● ●● ●● ● ●● ● −0.16 ●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●● ●●●●● ● ●●● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●●●● U −0.08 ● ● ●● ●● ●●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ∆ ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●● ●● ● ● ●●●●●● ● ●●●● ●● ●●●● ●●● ● ●●●● ● ● 0 ● ●● ● ●●●●● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●●●●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ●● ●● ●●● ●●● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● 0.08 ● ● ●●● ●●● ●●● ● ●● ● ●●●● ● ● ● ● ●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0.16 ● ● ●● ●● ● ●●● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● climate impact ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● Q ● ● ● ●● ● ● ● ● ● − ∆ ● ● ● ● ● ●● − ∆ ● ● ● E ● ● p basin impact ● P −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 ∆W Maik Renner● Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandter Klimaprotokolle - Band 18: Renner (2013) Herausgeber Institut für Hydrologie und Meteorologie Professur für Meteorologie Tharandter Klimaprotokolle http://tu-dresden.de/meteorologie Band 18 THARANDTER KLIMAPROTOKOLLE Band 18 Maik Renner Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandt, Januar 2013 ISSN 1436-5235 Tharandter Klimaprotokolle ISBN 978-3-86780-368-7 Eigenverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden Vervielfältigung: reprogress GmbH, Dresden Druck/Umschlag: reprogress GmbH, Dresden Layout/Umschlag: Valeri Goldberg Herausgeber: Christian Bernhofer und Valeri Goldberg Redaktion: Valeri Goldberg Institut für -

Where Steam Engines Meet Sandstone
TIMETABLE 2 01 9 Where steam engines meet sandstone. 1 Experience boat travel Established 1836! Dear Guests, Steamboat 90 years Leipzig With its nine historical paddle steamers, the Sächsische Dampfschif- Put into service: 11.05.1929 fahrt is the oldest and largest steamboat fleet in the world. In excep- tional manner and depth, this service combines riverside experience, Steamboat Dresden technical fascination and culinary delight. While you are amazed by Put into service: 02.07.1926 the incomparable Elbe landscape with the imposing rock formations in Saxon Switzerland, the impressive buildings of Dresden and Meissen, Steamboat Pillnitz and the delightful wine region between Radebeul and Diesbar-Seusslitz Put into service: 16.05.1886 you can also enjoy regional and seasonal food and beverages. Whether travelling with the lovingly restored paddle steamers or with the air- Steamboat Meissen conditioned salon ships, lean back and enjoy the breathtaking views. Put into service: 17.05.1885 We would like to impress you with our comprehensive offer of expe- riences and hope to continually surprise you. With this I would like to Steamboat 140 wish you an all-encompassing, relaxing trip on board. years Stadt Wehlen Put into service: 18.05.1879 Yours, Karin Hildebrand Steamboat Pirna Put into service: 22.05.1898 Steamboat Kurort Rathen contents Put into service: 02.05.1896 En route in Dresden city area 4 Steamboat Our special event trips 8 Krippen Put into service: 05.06.1892 Winter and Christmas Cruises 22 En route in and around Meissen 26 Steamboat En route in Saxon Switzerland 28 Diesbar Put into service: 15.05.1884 Our KombiTickets 32 Dresden’s “Terrassenufer” under steam 40 Motor ship 25 Anniversary ships 42 years August der Starke put into service: 19.05.1994 Historic Calendar 44 Souvenirs & Co. -

Abenteuer Urlaub
2 ABENTEUER URLAUB Alles beginnt mit einer einzigartigen Naturland- Broschüre zahlreiche Anregungen für abwechs- schaft – in die die Natur all ihr Können gelegt lungsreiche Urlaubstage. Von uralten Burgan- hat. Große wie Kleine werden davon magisch lagen und Märchenschlössern über spannende angezogen. Spektakuläre Kletterstiegen, ab- Freizeitwelten bis hin zu Erlebnisausstellungen wechslungsreiche Wanderwege, abenteuerliche und Naturbühnen. Und das Beste daran: Mit der Höhlen und verwinkelte Felslabyrinthe verspre- Gästekarte Sächsische Schweiz können Sie in chen ein Naturerlebnis der Extraklasse. vielen Einrichtungen Vorteile genießen. Alles, Neben Wandern und Klettern hat die Sächsische was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf den Schweiz aber noch viel mehr zu bieten. Egal ob Seiten 21 und 22. Radfahren, Paddeln, Reiten oder Schwimmen: Auf den Seiten 31 -35 finden Sie zahlreiche Vor- Im Elbsandsteingebirge möchte man am liebsten schläge für Restaurants, Gasthäuser und Cafés. den ganzen Tag im Freien verbringen. Lassen Sie sich beim Blättern inspirieren und Doch wie immer macht erst die Abwechslung den gestalten Sie die schönste Zeit des Jahres nach Urlaub so richtig spannend. Wenn das Wetter Ihrem Geschmack. mal nicht so ganz passt oder Sie einfach Lust auf etwas anderes haben, finden Sie in dieser Ihr Tourismusverband Sächsische Schweiz www.sunlight.de FREIHEIT ERLEBEN mit Reisemobilen aus der Sächsischen Schweiz www.saechsische-schweiz.de/region/anreise-mobilitaet Tipps zur Anreise mit Bus und Bahn sowie zur Mobilität vor Ort finden Sie hier. www.carado.de Anzeige Freizeit TVSSW 2019.indd 1 04.10.2018 12:10:49 3 4 INHALT / CONTENT Spielplätze Besonders für Familien mit kleinen Kindern sind Spielplätze ein AUSFLUgsZIELE / DESTINATIONS wichtiges Urlaubselement. -

Wild and Beautiful Freyunger Straße 2 Stubbenkammer 2 a Im Forst 5 94481 Grafenau 18546 Sassnitz 18375 Born Tel
NATIONAL PARKS IN GERMANY Wild and beautiful Freyunger Straße 2 Stubbenkammer 2 a Im Forst 5 94481 Grafenau 18546 Sassnitz 18375 Born Tel. 08552 9600-0, Fax -100 Tel. 038392 350-11, Fax -54 Tel. 038234 502-0, Fax -24 [email protected] [email protected] [email protected] www.nationalpark-bayerischer-wald.de www.nationalpark-jasmund.de www.nationalpark-vorpommersche- boddenlandschaft.de Doktorberg 6 Laustraße 8 83471 Berchtesgaden 34537 Bad Wildungen Schlossgarten 1 Tel. 08652 9686-0, Fax -40 Tel. 05621 75249-0, Fax -19 25832 Tönning [email protected] info@nationalpark- Tel. 04861 616-0, Fax -69 www.nationalpark-berchtesgaden.de kellerwald-edersee.de [email protected] www.nationalpark-kellerwald- www.nationalpark-wattenmeer.de edersee.de Urftseestraße 34 Schloßplatz 3 Stadthausbrücke 8 53937 Schleiden-Gemünd 17237 Hohenzieritz 20355 Hamburg Tel. 02444 9510-0, Fax -85 Tel. 039824 252-0, Fax -50 Tel. 040 42840-3392, Fax -3552 [email protected] [email protected] www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalpark-eifel.de www.mueritz-nationalpark.de Bei der Marktkirche 9 An der Elbe 4 99947 Bad Langensalza 01814 Bad Schandau Virchowstraße 1 Tel. 03603 3907-0, Fax -20 Tel. 035022 900-600, Fax -666 26382 Wilhelmshaven [email protected] poststelle.sbs-nationalparkverwaltung@ Tel. 04421 911-0, Fax -280 www.nationalpark-hainich.de smul.sachsen.de poststelle@nlpv-wattenmeer. www.nationalpark-saechsische- niedersachsen.de schweiz.de www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalpark-wattenmeer- erleben.de Lindenallee 35 Park 2 38855 Wernigerode 16303 Schwedt / Oder, OT Criewen Tel. -

Plan Your Tour Skála Rock @Bohemianswitzerlandguide Vrh, Hřeben Top Pupplet Theather Download: Sebnitz 30
Hohnstein Dictionary: N údolí valley W E Vilémov Free map for travellers rozhledna lookout Vilémov 11. soutězka gorge S Šluknov Nová Víska Bohemian Saxon Switzerland farma farm kozí farma Lipová schody stairs Dolní Poustevna Velký Šenov mlýn mill Schönbach Dolní Poustevna Plan your tour skála rock @bohemianswitzerlandGUIDE vrh, hřeben top pupplet theather Download: www.bohemian-switzerland.cz/map Sebnitz 30. Bastei Imakuláta Tanečnice 10.7. Mikulášovice Ottendorf 211 Waltersdorf Kurort Rathen 8. 26. Lichtenhainer Wasserfall Bohemian Coffee House Dymník 7. Rumburk Ostrau Kopec 7. Staré Křečany Weifberg 6. Dr 277.. Bad Schandau esden Kuhstall 30 min. Brtníky rozhledna Vlčí hora Direct Bus from Rumburk to Prague every 2 hours. Kleine Kirnitzsch Winterberg Ic Elbe Wateref Vlčí Hora 29. Königstein 79.. Hinterhermsdorf 5. Vlčí hora Schraimnstaine 28. all Nobilis Tilia Kyjo vské údo Niedermühle Sněžná Großer Winterberg lí Arboretum Obere Křinice Luční bar Zadní Schleuse 3. Kyjov Schmilka Jetřichovice Bohemian Krasná Lípa 2. Cottage 1. Kurort Mana Falkenštejn Gohrisch Pravčická 434 20. ! radar Varnsdorf brána Atelier Gabriella trail 3030 25. Schona Světlík Kocour Kamenice 434 Mezní Louka Hřensko 438 74.. Doubice 19. Uzké schody Na Tokáni 21. Mezná Šaunštejn Edmundova HorníHoení PPodlužíodluží Galli Destillery Labe Janov Saula Großer Zschirnstein Janov 22. soutěska Divoká soutěska kozí farma golf Rybniště Žofín Rosehill Vysoká Lípa Belvedér Mariina skála Na Stodolci Dolní Žleb 24. 713.. Falkenštejn Jiřetín pod Jedlovou Jetřichovice 714.. Chřibská Ptačinec Růžová 18. Růžová Dolský Rubens 17. mlýn Rynartice Tolštejn 436 432 Všemily Stožecké sedlo 434 Růžovský vrch Luž 438 Pavlinino Jedlová Růžový Arnoltice údolí Maxičky hřeben Biofarma Hampl Studenec 15. Srbská Kamenice vý Bor Cvikov Nový Bor Bynovec 1010 min.min. -

National Parks in Germany: Wild and Beautiful
NATIONAL PARKS IN GERMANY Wild and Beautiful Western-Pomerania Lagoons National Park Bavarian Forest National Park Jasmund National Park Im Forst 5 Freyunger Straße 2 Stubbenkammer 2 a D-18375 Born /Germany D-94481 Grafenau /Germany D-18546 Sassnitz /Germany Phone: +49 (0)38234 502-0, fax -24 Phone +49 (0)8552 9600-0, fax -100 Phone: +49 (0)38392 350-11, fax -54 [email protected] [email protected] [email protected] www.nationalpark-vorpommersche- www.nationalpark-bayerischer-wald.de/english www.nationalpark-jasmund.de boddenlandschaft.de Berchtesgaden National Park Kellerwald-Edersee National Park Doktorberg 6 Laustraße 8 Hamburg Wadden Sea National Park D-83471 Berchtesgaden /Germany D-34537 Bad Wildungen /Germany Neuenfelder Straße 19 Phone: +49 (0)8652 9686-0, fax -40 Phone: +49 (0)5621 75249-0, fax -19 D-21109 Hamburg /Germany [email protected] [email protected] Phone: +49 (0)40 42840-3392, fax -3552 www.nationalpark-berchtesgaden.de www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/en/home/ www.nationalpark-wattenmeer.de Müritz National Park Lower Saxony Wadden Sea National Park Eifel National Park Schloßplatz 3 Virchowstraße 1 Urftseestraße 34 D-17237 Hohenzieritz /Germany D-26382 Wilhelmshaven /Germany D-53937 Schleiden-Gemünd /Germany Phone: +49 (0)39824 252-0, fax -50 Phone: +49 (0)4421 911-0, fax -280 Phone: +49 (0)2444 9510-0, fax -85 [email protected] [email protected] [email protected] www.mueritz-nationalpark.de/cms2/MNP_prod/ www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalpark-eifel.de/go/eifel/english.html MNP/en/Homepage/index.jsp www.nationalpark-wattenmeer-erleben.de Saxon Switzerland National Park Hainich National Park An der Elbe 4 Schleswig-Holstein Wadden Sea National Park Bei der Marktkirche 9 D-01814 Bad Schandau /Germany Schlossgarten 1 D-99947 Bad Langensalza /Germany Phone: +49 (0)35022 900-600, fax -666 D-25832 Tönning /Germany Phone: +49 (0)361 5739140-00, fax -20 poststelle.sbs-nationalparkverwaltung@smul. -

Perspectives of the Green Belt“ Chances for an Ecological Network from the Barents Sea to the Adriatic Sea?
Barbara Engels, Angela Heidrich, Jürgen Nauber, Uwe Riecken, Heinrich Schmauder and Karin Ullrich (Eds.) „Perspectives of the Green Belt“ Chances for an Ecological Network from the Barents Sea to the Adriatic Sea? BfN - Skripten 2004 Perspectives of the Green Belt“ Chances for an Ecological Network from the Barents Sea to the Adriatic Sea? Proceedings of the International Conference 15th of July in Bonn on the Occasion of the 10th Anniversary of the German Federal Agency for Nature Conservation (BfN) Editors: Engels, Barbara Heidrich, Angela Nauber, Jürgen Riecken, Uwe Schmauder Heinrich Ullrich, Karin 2 Cover Picture: The German Green Belt near Pferdsdorf (Uwe Riecken, BfN) Editors: Division II 1.3 Tel: +49-228-8491-242 [email protected] This publication is included in the literature database “DNL-online” (www.dnl-online.de) BfN-Skripten are not available in book trade. Publisher: Bundesamt für Naturschutz (BfN) Federal Agency for Nature Conservation Konstantinstrasse 110 53179 Bonn, Germany Tel.: +49 228/ 8491-0 Fax: +49 228/ 8491-200 URL: http://www.bfn.de All rights reserved by BfN The publisher takes no guarantee for correctness, details and completeness of statements and views in this report as well as no guarantee for respecting private rights of third parties. Views expressed in the papers published in this issue of BfN-Skripten are those of the authors and do not necessarily represent those of the publisher. No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without written permission from the copyright owner. -

The Very Best of Saxony 1 Saxony?
the very best of saxony 1 SAXONY? “Why Saxony?” No one would have But since German reunification more asked this in the time before the and more people are discovering that Second World War, when Saxony the things that attracted people to was the economically strongest and Saxony earlier are still there: specta- most prosperous region in Germany. cular architecture, art collections of Business people came to Chemnitz, world renown, a deeply rooted love of the city with the highest industrial music, living traditions, and locations production in Germany, or to Leipzig, of world history, the strong attachment the center of commerce in Europe, a of the Saxons to their home, precious cosmopolitan city like London and skills and their love for life. But what Paris. And tourists came to Dresden, does Saxony have that other places do the richest and most beautiful city in not have? We will try to explain that Germany. But then Saxony fell behind on the following pages. We will not the Iron Curtain. For many people all present everything, but just the best, over the world, 1000 years of history the unique, the special, the things that fell into oblivion, 829 years of which make a trip to Saxony an authentic and saw Saxony ruled by a single family eye-opening experience. Welcome to and playing a leading role in Europe. the world of Saxony! 2 FIFTEEN REASONS TO VISIT SAXONY: THE GREATEST MUSICIAN OF ALL TIME 17 THE MOST UNUSUAL CAR FACTORY IN THE WORLD 35 THE FIRST PROTESTANT CHURCH BUILDING 50 A Paradise for Music Lovers Adventures on Four Wheels -

Elbe Sandstone Mountains Media Kit 2018
www.saechsische-schweiz.de Rico Richter/Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. Basteibrücke – Foto: Elbe Sandstone Mountains Media kit 2018 Media Kit 2018 Elbe Sandstone Mountains/ Saxon-Bohemian Switzerland The Elbe Sandstone Mountains: a fairy tale in stone. The Elbe Sandstone Mountains – comprising Saxon Switzerland and Bohemian Switzerland – rank among the most spectacular natural and cultural landscapes in Europe. The region straddles two national borders in the extreme south-east of Germany and the north of the Czech Republic and it is only a few kilometres distant from the Saxony state capital of Dresden. The landscape is positively fascinating with its richness of different forms – with table mountains, plateaus, rocky reefs and rock pinnacles, ravines, forests and the Elbe Valley. A large part of the region, which totals some 710 square kilometres (275 square miles) with its abundant flora and fauna is protected on either side of the border as a National Park. Adjoining it to the south are the Bohemian Central Highlands clearly displaying their volcanic origin and characterised by striking conical mountains. Together with the Saxon-Bohemian Switzerland National Park region, they make up a contiguous nature reserve covering 1800 square kilometres (695 square miles). 2 Contents FACTS ................................................................................................................................................................. 4 Tourism Region Elbe Sandstone Mountains / Saxon-Bohemian Switzerland ................................................. -
Informationsbroschüre Sebnitz
Altendorf Landkreis Sächsische Große Kreisstadt Schweiz-Osterzgebirge Sebnitz Hinterhermsdorf Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Lichtenhain Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Mittelndorf Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Ottendorf Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Saupsdorf Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge leben in … Informationsbroschüre für Einwohner und Gäste Sebnitz 2 3 Sebnitz wurde im 12./13. Jahrhundert von fränkischen Bauern prägten das Wirtschaftsleben. Die Leineweberei nahm dabei Vorwort gegründet. Seinen Namen erhielt der Ort von dem gleichnami- eine hervorragende Stellung ein. Noch heute stehen an der gen Bach. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war Sebnitz eine Bergstraße und an der Obergasse einige Umgebindehäuser, die Wir bleiben dran! Sebnitzer Ackerbürgerstadt, d.h. Handel, Handwerk und Landwirtschaft einst von Webern und ihren Familien bewohnt wurden. Mit dieser Broschüre halten Sie aktuelle Informationen, ei- Stadtwappen nen Rückblick auf die vergan- Jahr Ereignis genen Jahre und einen Aus- Ein nach links über drei wiesengrüne Berge schreitender golde- 1223/1241 Erste Erwähnung des Sebnitzbaches in der Oberlausitzer Grenzurkunde. blick bis ins Jahr 2020 in Ihren ner (gelber) Hirsch auf himmelblauen Hintergrund. Das Sebnit- Händen. Seit der letzten Info- zer Stadtwappen wurde von der Sächsischen Regierung im Jahr 1359 Bei der Berufung des Pfarrers Nicolaus an die Kirche zu Jedlka (Höflitz) bei Benesöw (Bensen) wird Sebnitz das Broschüre sind wiederVorwort einige 1898 / bestätigt. Wappen / Inhaltsverzeichnis Zeittafelerste Mal urkundlich erwähnt. Jahre vergangen – und so war 1451 Sebnitz kommt zusammen mit der Herrschaft Wildenstein aus böhmischem Besitz an die Wettiner. es an der Zeit, die zahlreichen 1539 Einführung der Reformation Veränderungen darzustellen. Ich freue mich deshalb, Ihnen einen aktuellen Gesamtüberblick 1618/1648 Der Dreißigjährige Krieg fügt der Stadt und ihrer Bevölkerung großen Schaden zu. -

The Elbe Sandstone Mountains: a Fairy Tale in Stone
The Elbe Sandstone Mountains: a fairy tale in stone. The Elbe Sandstone Mountains – comprising Saxon Switzerland and Bohemian Switzerland – offer some of the most spectacular natural and cultural landscapes in Europe. The region straddles two national borders in the extreme south-east of Germany and the north of the Czech Republic and it is only a few kilometres distant from the Saxony state capital of Dresden. The landscape is positively fascinating with its richness of different forms – with table mountains, plateaus, rocky reefs and rock pinnacles, ravines, forests and the Elbe Valley. A large part of the region, which totals some 710 square kilometres (275 square miles) with its abundant flora and fauna is protected on either side of the border as a National Park. Adjoining it to the south are the Bohemian Central Highlands, clearly displaying their volcanic origin and characterised by striking conical mountains. Together with the Saxon-Bohemian Switzerland National Park region, they make up a contiguous nature reserve covering 1800 square kilometres (695 square miles). 2 Contents FACTS .........................................................................................................................................4 Tourism Region Elbe Sandstone Mountains ....................................................................................4 National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland ........................................................................5 Origin and discovery ..................................................................................................................6