Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Berlin Olympics: Sports, Anti-Semitism, and Propaganda in Nazi Germany Nathan W
Student Publications Student Scholarship Spring 2016 The Berlin Olympics: Sports, Anti-Semitism, and Propaganda in Nazi Germany Nathan W. Cody Gettysburg College Follow this and additional works at: https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship Part of the European History Commons, Political History Commons, Social History Commons, and the Sports Studies Commons Share feedback about the accessibility of this item. Cody, Nathan W., "The Berlin Olympics: Sports, Anti-Semitism, and Propaganda in Nazi Germany" (2016). Student Publications. 434. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/434 This is the author's version of the work. This publication appears in Gettysburg College's institutional repository by permission of the copyright owner for personal use, not for redistribution. Cupola permanent link: https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/ 434 This open access student research paper is brought to you by The uC pola: Scholarship at Gettysburg College. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator of The uC pola. For more information, please contact [email protected]. The Berlin Olympics: Sports, Anti-Semitism, and Propaganda in Nazi Germany Abstract The aN zis utilized the Berlin Olympics of 1936 as anti-Semitic propaganda within their racial ideology. When the Nazis took power in 1933 they immediately sought to coordinate all aspects of German life, including sports. The process of coordination was designed to Aryanize sport by excluding non-Aryans and promoting sport as a means to prepare for military training. The 1936 Olympic Games in Berlin became the ideal platform for Hitler and the Nazis to display the physical superiority of the Aryan race. However, the exclusion of non-Aryans prompted a boycott debate that threatened Berlin’s position as host. -

The Story of the Olympic Hymn: the Poet and His Composer
The Story of the Olympic Hymn: the poet and his composer By Volker Kluge The Olympic Hymn by Thereafter a jury made up of IOC and US representatives Richard Strauss was would choose the winner. In fact, the prize jury consisted recognised by the only of Americans. Their countryman, pianist Walter IOC in 1936 as official. Bradley Keeler 4 was awarded first prize.5 As the Organising Bradley Keeler’s work, written in the style of an Anglo- Committee of the American church hymn, was played on 30th July 1932 at XI Olympiad was not the opening ceremony of the Games of the Xth Olympiad, in the position of as the Olympic flag rose to the top of the mast. For this the paying Strauss the Organising Committee had assembled a band with 300 10,000 marks he musicians: the Olympic choir – 1200 women and men demanded, it had the – sang the lyrics composed by Louis F. Benson. The text, score printed in large which called on the athletes no longer to fear the hand quantities and sold of the tyrant and to keep faith with liberty, was printed them for one mark. in the day’s programme so many spectators sang along.6 The profit benefited The hymn proved popular, which is why the poet the composer, but Alfred von Kessel translated it into German.7 The the lyricist was left translation was probably intended for the IOC Session empty-handed. in Vienna, but when this was opened on 7th June 1933 in the Academy of Sciences, the choir did not perform Photos: Deutsches Literatur- archiv Marbach, Volker Kluge Kessel’s text but a revised version which was one verse Archive shorter. -

78-5890 MECHIKOFF, Robert Alan, 1949- the POLITICALIZATION of the XXI OLYMPIAD
78-5890 MECHIKOFF, Robert Alan, 1949- THE POLITICALIZATION OF THE XXI OLYMPIAD. The Ohio State University, Ph.D., 1977 Education, physical University Microfilms International,Ann Arbor, Michigan 48106 © Copyright by Robert Alan Mechikoff 1977 THE POLITICALIZATION OF THE XXI OLYMPIAD DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Robert Alan Mechikoff, B.A., M.A. The Ohio State University 1977 Reading Committee Approved By Seymour Kleinman, Ph.D. Barbara Nelson, Ph.D. Lewis Hess, Ph.D. / Adviser / Schoc/l of Health, Physical Education, and Recreation This study is dedicated to Angela and Kelly Mechikoff; Alex and Aileen Mechikoff; Frank, Theresa, and Anthony Riforgiate; and Bob and Rosemary Steinbauer. Without their help, understanding and encouragement, the completion of this dissertation would not be possible. VITA November 7, 1949........... Born— Whittier, California 1971......................... B.A. , California State University, Long Beach, Long Beach California 1972-1974....................Teacher, Whittier Union High School District, Whittier, California 1975......................... M.A. , California State University, Long Beach, Long Beach, California 1975-197 6 ....................Research Assistant, School of Health, Physical Education, and Recreation, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1976-197 7....................Instructor, Department of Physical Education, University of Minnesota, Duluth, Duluth, Minnesota FIELDS OF STUDY Major Field: Physical Education Studies in Philosophy of Sport and Physical Education. Professor Seymour Kleinman Studies in History of Sport and Physical Education. Professor Bruce L. Bennett Studies in Administration of Physical Education. Professor Lewis A. Hess TABLE OF CONTENTS Page DEDICATION................................................. ii ACKNOWLEDGEMENTS.......................................... iii VITA........................................................ iv Chapter I. -

Vom Erscheinungsbild Zum „Corporate Design“: Beiträge Zum Entwicklungsprozess Von Otl Aicher
Vom Erscheinungsbild zum „Corporate Design“: Beiträge zum Entwicklungsprozess von Otl Aicher Nadine Schreiner Als Dissertation eingereicht bei der Bergischen Universität Wuppertal Fachbereich F: Architektur-Design-Kunst Wuppertal, im Juni 2005 Die Dissertation kann wie folgt zitiert werden: urn:nbn:de:hbz:468-20050270 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Ahbz%3A468-20050270] Mein ausdrücklicher Dank gilt, Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Siegfried Maser und Prof. Dr. phil. Burghart Schmidt, für die äußerst wertvolle Unterstützung und Zusammenarbeit. Inhalt Einleitung 1 1. Kapitel Frühe Projekte 1.0 Frühe Projekte 4 1.1 Plakate Ulmer Volkshochschule 1945-62 4 1.2 Firma Max Braun, (Elektrogeräte) 1954-62 12 1.3 Deutsche Lufthansa 1962-64 21 1.4 Resümee 39 2. Kapitel XX. Olympische Spiele 1972 in München 2.0 Einleitung 40 2.1 Farbkodierung 43 2.2 Emblem 48 2.3 Eine humane Schrift – die Univers 54 2.4 Münchner Verkehrsschrift – Traffic 56 2.5 Typografisches System – Ordnungsprinzipien 60 2.6 Plakate 64 2.7 Piktogramme 67 2. 8 Urbanes Gestaltungskonzept – Fahnen 74 2. 9 Einkleidung 77 2.10 Olympia-Souvenirs 78 2.11 Architektur 84 2.12 Resümee 86 3. Kapitel Die Zeit nach Olympia – die 70er Jahre 3.0 Einleitung 89 3.1 Zweites Deutsches Fernsehen 95 3.2 Studioausstattung 95 3.3 Visuelle Konstanten und Elemente – Farbkodierung 98 3.4 Hausschrift und Logogramm 100 3.5 Senderkennzeichen 101 3.6 Bildschirm – Raster und Anwendungen 103 3.7 ZDF-Uhr – analog oder digital 104 3.8 Satzspiegel und Typografie 104 3.9 Beschilderung und Information 106 3.10 Objekte und Fahrzeuge 108 3.11 Resümee über ein neues Selbstverständnis 109 3.12 Re-Design Stufen im Erscheinungsbild ZDF 110 3.13 Zum Vergleich: 112 Das visuelle Erscheinungsbild des Südwestfunks von Herbert W. -

By Thomas Zawadzki* 1
by Thomas Zawadzki* 1. Literature of Germany after World War Two, far more inter- ntil now only a few attempts at research esting is the study of the time before the founding have been made to analyse the biography of of the German Empire as LEWALD was born 12 years UTheodor LEWALD. The first one to be mentioned is after the Revolution of 1848. Further viewpoints to Arnd KRÜGER who in 1975 issued the work Theodor be taken into consideration are LEWALD'S activities Lewald. Sportführer ins Dritte Reich [Sports Leader in German Sports (Con-) Federations, in interna- into the Third Reich]. It was published as the third tional umbrella organisations, and especially his volume of the series entitled 'Turn und Sportfuhrer efforts for the genesis of the Olympic Movement. im Dritten Reich" [Gymnastics and Sports Leaders For this purpose LEWALD'S official functions in the in the Third Reich] which was published by the IOC have to be studied, starting with his election German publishing house Bartels & Wernitz from into the IOC by postal vote in 1924 and his "with- 1970 till 1976. On 144 pages KRÜGER described drawal" after the Olympic Games of Berlin. the familiar life and career of the half-Jew. Other All this research leads to the inclusion of several personalities treated in this series are Edmund aspects, namely sports, politics, culture, media and NEUENDORFF1, Youth Leader of the Deutsche society, in combination with the name of Theodor Turnerschaft, Hans von TSCHAMMER und OSTEN2, LEWALD. The last point to mention but one of the 3 "Reichssportführer", Carl KRÜMMEL , President of first to study are the networks created and used by the Reichsakademie für Leibesübungen, and Guido LEWALD, maybe one of the most important ones: the 4 von MENGDEN , publicist and spokesman of the close collaboration and relation with Carl DIEM.9 Reichssportfuhrer.5 KRÜGER up-dated some of the results of the research together with Rolf PFEIFFER 2.2. -

German Historical Institute London Bulletin Vol 29 (2007), No. 1
German Historical Institute London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007 CONTENTS Seminars 3 Articles Hitler’s Games: Race Relations in the 1936 Olympics (David Clay Large) 5 The Long Shadows of the Second World War: The Impact of Experiences and Memories of War on West German Society (Axel Schildt) 28 Review Articles Prussian Junkers (William W. Hagen) 50 Flirting with Hitler: Biographies of the German and British Nobility in the Interwar Years (Karina Urbach) 64 Book Reviews Dieter Berg, Die Anjou-Plantagenets: Die englischen Könige im Europa des Mittelalters (1100–1400) (Karsten Plöger) 75 Lyndal Roper, Witch Craze: Terror and Fantasy in Baroque Germany (Johannes Dillinger) 79 Helke Rausch, Kultfigur und Nation: Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London 1848–1914 (Matthew Jefferies) 85 Sonja Levsen, Elite, Männlichkeit und Krieg: Tübinger und Cambridger Studenten 1900–1929 (Thomas Weber) 89 Zara Steiner, The Lights that Failed: European International History 1919–1933 (Eckart Conze) 97 (cont.) Contents Michael Kater, Hitler Youth (Sybille Steinbacher) 101 James J. Barnes and Patience P. Barnes, Nazis in Pre-War London, 1930–1939: The Fate and Role of German Party Members and British Sympathizers (Lothar Kettenacker) 107 Dieter Kuntz and Susan Bachrach (eds.), Deadly Medicine: Creating the Master Race (Winfried Süß) 112 Kazimierz Sakowicz, Ponary Diary, 1941–1943: A Bystander’s Account of a Mass Murder; Rachel Margolis and Jim G. Tobias (eds.), Die geheimen Notizen des K. Sakowicz: Doku- mente zur Judenvernichtung in Ponary (Helmut Walser Smith) 115 Bastian Hein, Die Westdeutschen und die Dritte Welt: Entwick- lungspolitik und Entwicklungsdienste zwischen Reform und Revolte 1959–1974 (Armin Grünbacher) 119 Conference Reports Chivalric Heroism or Brutal Cruelty—How Violent were the Middle Ages? (Hanna Vollrath) 122 The Holy Roman Empire, 1495–1806 (Michael Schaich) 125 Fifth Workshop on Early Modern German History (Michael Schaich) 135 Royal Kinship: Anglo-German Family Networks 1760–1914 (Matthew S. -

Steroids a New Look at Performance Enhancing Drugs
STEROIDS STEROIDS A New Look at Performance-Enhancing Drugs Rob Beamish Copyright 2011 by Rob Beamish All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Beamish, Rob. Steroids : a new look at performance-enhancing drugs / Rob Beamish. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978–0–313–38024–2 (hard copy : alk. paper) — ISBN 978–0–313–38025–9 (ebook) 1. Anabolic steroids. 2. Doping in sports. 3. Olympics—Political aspects. 4. Olympics— Social aspects. I. Title. RC1230.B454 2011 362.2909—dc22 2011010791 ISBN: 978–0–313–38024–2 EISBN: 978–0–313–38025–9 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 This book is also available on the World Wide Web as an eBook. Visit www.abc-clio.com for details. Praeger An Imprint of ABC-CLIO, LLC ABC-CLIO, LLC 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 This book is printed on acid-free paper Manufactured in the United States of America Contents Preface vii Introduction xi 1. Coubertin’s Olympic Project 1 2. Sports, Spectacles, and the Nation-State: The Nazi Olympics 25 3. The Olympic Games’ Fundamental Principle: The Spirit of Olympism 41 4. The Social Construction of Steroids in Sports 73 5. Interests of the Nation-State, Sports, and Steroids 101 6. -
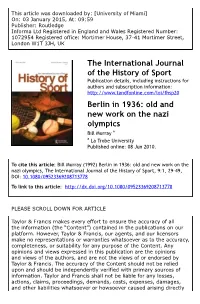
Berlin in 1936: Old and New Work on the Nazi Olympics Bill Murray a a La Trobe University Published Online: 08 Jun 2010
This article was downloaded by: [University of Miami] On: 03 January 2015, At: 09:59 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK The International Journal of the History of Sport Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/fhsp20 Berlin in 1936: old and new work on the nazi olympics Bill Murray a a La Trobe University Published online: 08 Jun 2010. To cite this article: Bill Murray (1992) Berlin in 1936: old and new work on the nazi olympics, The International Journal of the History of Sport, 9:1, 29-49, DOI: 10.1080/09523369208713778 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09523369208713778 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

GERMANY from 1896-1936 Presented to the Graduate Council
6061 TO THE BERLIN GAMES: THE OLYMPIC MOVEMENT IN GERMANY FROM 1896-1936 THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science By William Gerard Durick, B.S. Denton, Texas May, 1984 @ 1984 WILLIAM GERARD DURICK All Rights Reserved Durick, William Gerard, ToThe Berlin Games: The Olympic Movement in Germany From 1896-1936. Master of Science (History), May, 1984, 237epp.,, 4 illustrations, bibliography, 99 titles. This thesis examines Imperial, Weimar, and Nazi Ger- many's attempt to use the Berlin Olympic Games to bring its citizens together in national consciousness and simultane- ously enhance Germany's position in the international com- munity. The sources include official documents issued by both the German and American Olympic Committees as well as newspaper reports of the Olympic proceedings. This eight chapter thesis discusses chronologically the beginnings of the Olympic movement in Imperial Germany, its growth during the Weimar and Nazi periods, and its culmination in the 1936 Berlin Games. Each German government built and improved upon the previous government's Olympic experiences with the National Socialist regime of Adolf Hitler reaping the benefits of forty years of German Olympic participation and preparation. TABLE OF CONTENTS Page 0 0 - LIST OF ILLUSTRATIONS....... ....--.-.-.-.-.-. iv Chapter I. ....... INTRODUCTION "~ 13 . 13 II. IMPERIAL GERMANY AND THE OLYMPIC GAMES . 42 III. SPORT IN WEIMAR GERMANY . - - IV* SPORT IN NAZI GERMANY. ...... - - - - 74 113 V. THE OLYMPIC BOYCOTT MOVEMENTS . * VI. THE NATIONAL SOCIALISTS AND THE OLYMPIC GAMES .... .. ... - - - .- - - - - - . 159 - .-193 VII. THE OLYMPIC SUMMER . - - .- -. - - 220 VIII. -
Carl Diem and the Olympics
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH., Issue 2 suppl. 2010 Our JOURNAL is nationally acknowledged by C.N.C.S.I.S., being included in the B+ category publications, 2008-2010.Indexed in: INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST, DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS, SOCOLAR CARL DIEM AND THE OLYMPICS Mehmet TUNCKOL1, Yasar SAHIN2 1Gaziosmanpasa University, School of Physical Education and Sport, Tokat-TURKEY 2Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara-TURKEY Abstract Carl Diem (1882-1962) was an important sports bureaucrat of his century. He was a planner and principal organizer of the Berlin Games. He served to the Olympic movement from the 1912 Stockholm Games until the year of his death. He was an energetic sports educator and traveled all around the world for consulting to various countries about sports. The purpose of this study was to examine Carl Diem‘s life and his creative projects about sport and the Olympics. The subject was searched based upon the literature. As a result, it could be said that Carl Diem is one of the most important people in German sport history and in the Olympic history. Key Words: Olympics, German Sports. Introductıon charge for a better Europe" (R. K. Barney & G. No critical biography of Diem (1882- Paton, 2002). 1962) has been published to date, although many His accomplishments were various, sport historians presented studies on the occasion of grandiose and so numerous as to seem in retrospect Diem‘s 100th anniversary in 1982 when there was a impossible of carrying out for an ordinary mortal. -

Frauensport Im Nationalsozialismus Und Dessen Missbrauch Als Propagandainstrument Am Beispiel Von Helene Mayer
BACHELORARBEIT Frau Miriam Hanke Frauensport im Nationalsozialismus und dessen Missbrauch als Propagandainstrument am Beispiel von Helene Mayer 2012 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Frauensport im Nationalsozialismus und dessen Missbrauch als Propagandainstrument am Beispiel von Helene Mayer Autorin: Frau Miriam Hanke Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft Seminargruppe: AM09wJ2-B Erstprüfer: Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer Zweitprüfer: Marcel Meinert Einreichung: Mittweida, 23. Juli 2012 Faculty of Media BACHELOR THESIS Women´s sports in times of National Socialism and its abuse for propaganda issues using the example of Helene Mayer author: Ms. Miriam Hanke course of studies: Applied Media Economics seminar group: AM09wJ2-B first examiner: Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer second examiner: Marcel Meinert submission: Mittweida, July 23rd 2012 Bibliografische Angaben Hanke, Miriam: Frauensport im Nationalsozialismus und dessen Missbrauch als Propagandainstrument am Beispiel von Helene Mayer Women´s sports in times of National Socialism and its abuse for propaganda issues using the example of Helene Mayer 73 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2012 Abstract Die Arbeit “Frauensport im Nationalsozialismus und dessen Missbrauch als Propagandainstrument am Beispiel von Helene Mayer” beschreibt die Entwicklung des Frauensports im nationalsozialistischen Deutschland. Zudem wird der Einfluss von Propagandamaßnahmen auf den Sport beleuchtet. Abschließend werden die beiden großen Teilabschnitte -

The 1936 Berlin Olympics Was the Turning Point for the Politicization of Sport
The 1936 Berlin Olympics was the turning point for the politicization of sport 10.1 HASS Mrs Casserly Heather Bytheway Word Count – 1,999 "Sport is prostituted when sport loses its independent and democratic character and becomes a political institution”1 These are the words of the Committee on Fair Play in Sports, and could not more accurately describe the negative impacts of the politicization of sports. Prior to 1936, the Olympics remained separate from politics, and was a place where many countries could unite and partake in friendly competition; however, with the rise of Nazism in Germany and growing tension across the western world, the 1936 Olympics became the turning point for the politicization of sport. Past Olympics had never been so affected by propaganda, antisemitism, boycott calls, and racial discrimination, and to this day the changes to the nature of global sport are still visible. In 1931 the International Olympic Committee (IOC) awarded hosting rights for the 1936 Olympics to Germany, which was then under the Weimar Republic.2 After Germany had previously been banned from the 1920 and 1924 Olympics due to being held responsible for World War I, the move was seen as “an opportunity to welcome Germany back into the international community…”3 In 1933 the Nazi party gained power after the President of the German Reich, Paul von Hindenburg appointed Adolf Hitler to Chancellor. 4 Hitler soon took on emergency dictatorial powers, transforming the once democratic Germany to a fascist, authoritarian state. 5 When Hitler came to power, he inherited something he didn’t really want, the Olympics, 6 yet his Minister for Propaganda, Dr.