Handreichung Fußball
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wir Feiern in Berlin!
33 2017 DER 10. CDN-GEBURTSTAG WIR FEIERN IN BERLIN! AUF DEM WEG PHILIPP LAHMS „FÜR MICH WIE ZUM 5. STERN NÄCHSTE MISSION EIN LOTTOGEWINN“ DIE MANNSCHAFT blieb 2017 Ehrenspielführer und Serie: Hans Siemensmeyer unbesiegt und geht als Nr. 1 deutscher EM-Botschafter über sein bemerkenswertes der Weltrangliste ins WM-Jahr 10 für die EURO 2024 16 Debüt für Deutschland 30 INHALT 2 CDN-MAGAZIN 33 | 2017 6 Berlin Auf geht’s zur Nacht des großen Wiedersehens 10 Auf zum 5. Stern DIE MANNSCHAFT blieb 2017 unbesiegt und geht als Nr. 1 der Weltrangliste ins WM-Jahr 16 Neues Leben Neue Aufgaben Als Botschafter der Bewerbung um die Ausrichtung der EURO 2024 wird Lahm das Gesicht der deutschen Kampagne INHALT CDN-MAGAZIN 33 | 2017 3 30 „Das war für mich wie ein Lottogewinn“ Zwei Tore zum Einstand im Nationalteam EDITORIAL Von Szymaniak bis Kroos – Vom Profi zum „Pauker“ ein Überblick über die AUS DER KÖNIGS- Uwe Seelers Bilanz und Ausblick auf Nationalspieler im Ausland KLASSE INS den 10. Geburtstag des Clubs der IM AUSLAND GEREIFT 18 KLASSENZIMMER 38 Nationalspieler „ DER CDN – EINE EINHEIT OHNE STANDESDÜNKEL“ 4 VOR 25 JAHREN WEIHNACHTSTOURNEEN DER DDR-AUSWAHL Vor 25 Jahren starb Ernst Happel INSIDE CDN „ BIS HEUTE Weihnachten im Kreis der Familie – WEGWEISEND“ 22 in den 60er-Jahren war das für DDR- Nach 2010 kommen die Mitglieder Nationalspieler eher Ausnahme des CdN wieder im Berliner WEIHNACHTEN Olympiastadion zusammen VOR 50 JAHREN ZWISCHEN BERLIN, BERLIN, FERNWEH & HEIMWEH 42 WIR FEIERN IN BERLIN 6 Ein einziges Mal scheiterte Deutschland schon im Rahmen des Qualifikationswettbewerbs INSIDE CDN AKTUELL IM BLICKPUNKT DER ALBTRAUM VON ALBANIEN 26 Hervorragende Beteiligung beim 2017 – eins der erfolgreichsten regionalen CdN-Treffen in Köln – Jahre der DFB-Historie unvergessen: AUF ZUM 5. -

Kircher Und Baitinger Schiedsrichter Des Jahres
Offizielles Organ für die Schiedsrichter im Deutschen Fußball-Bund 5/2012 September/Oktober Ausgezeichnet: Christine Baitinger und Knut Kircher wurden vom DFB zu den Schiedsrichtern des Jahres 2012 ernannt. Titelthema Lehrwesen DFB-Schiedsrichter Analyse Kircher und Der Freistoß Vorbereitung: Was wir aus Baitinger als zentraler Der Präsident den Spielen Schiedsrichter Punkt des zu Besuch im der EM 2012 des Jahres Regelwerks Trainingslager lernen können Editorial Inhalt Liebe Leserinnen und Leser, Wir befinden uns hier auf dem richtigen Weg, der im Übrigen auch von allen Vertretern der Deut- seitdem ich mich mit dem Fußball befasse, kenne schen Fußball Liga mitgetragen wird. ich den Begriff „Sommerpause“. Im Sommer macht der Fußball Pause, soll das ja heißen. Ich *** meine mich zu erinnern, dass es einst auch so war. Aber vor allem in diesem Jahr war nach Diesen richtigen Weg gehen wir Schiedsrichter mit Abschluss der Punktspielsaison keine Auszeit vom dem DFB-Präsidium auch in einer anderen Angele- Fußball zu erkennen; und das lag nicht nur an der genheit, die in dieser „Sommerpause“ für viele Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Auf Schlagzeilen sorgte. Wohl noch nie war die Auf- zwei wichtige Themen, die uns in Atem hielten, merksamkeit für den IFAB (International Football möchte ich hier eingehen. Association Board) so groß wie Anfang Juli. Kein *** Wunder: Schließlich ging es bei der Sitzung des allein entscheidenden Regel-Gremiums im Welt- Natürlich müssen wir in der Führung unserer Top- fußball um die wichtigsten Fragen unseres Spiels: Schiedsrichter bestrebt sein, ihren hohen Leis - Ist der Ball im Tor oder nicht, und wie erkennen tungsgrad zu erhalten und auszubauen. -

3 Sep-Report Inhalt 07 RZ:Sepp Herberger 15.02.2008 13:00 Uhr Seite 3
0 TITEL U1-2-3-4 Sepp-Report07 RZ:Layout 1 15.02.2008 11:37 Uhr Seite 1 JAHRESBERICHT 2007 SEPP HERBERGER-STIFTUNG JAHRESBERICHT 2007 JAHRESBERICHT SEPP HERBERGER-STIFTUNG Für den Fußball. Für die Menschen. Für den Fußball. Für die Menschen. www.sepp-herberger.de www.sepp-herberger.de 0 TITEL U1-2-3-4 Sepp-Report07 RZ:Layout 1 15.02.2008 11:38 Uhr Seite 2 ie 1977 gegründete Sepp Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes Dverfolgt das Ziel, die integrative Kraft des Fußballs für die Gesellschaft zu nut- zen. Sie fördert Fußballprojekte im sozialen und gesellschaftspolitischen Kontext, vor allem in Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, im Bereich des Behinderten- sports oder im Zuge der Resozialisierung. Weiterer Stiftungszweck ist die soziale Be- treuung von Menschen, die als aktive Sportler, als ehrenamtliche oder hauptamtliche Mitarbeiter im Sport Schäden erlitten haben oder in Not geraten sind. Die Stiftung will zudem das Bewusstsein für Sepp Herberger als Persönlichkeit der Zeitgeschichte erhalten und schärfen. Das älteste Stiftungswerk des deutschen Fußballs hat für seine Maßnahmen seit seiner Gründung vor 30 Jahren rund 15 Millionen Euro auf- gewendet. Repräsentanten der Sepp Herberger-Stiftung sind die früheren National- spieler Horst Eckel, Helmut Haller und Uwe Seeler. Bis zu seinem Tod 2004 war auch Fritz Walter langjähriger Botschafter. Titelbild: 30 Jahre für den Fußball, für die Menschen: Die Sepp Herberger-Stiftung feierte 2007 mit 200 Gästen aus Sport, Politik und dem öffentlichen Leben ihr Jubiläum in Hannover. -

Seleccionado Ayer El Equipo Mundial De Balompié —•
Pág. 6 HAMO LAS AMERICA} íabado, yi pe enero de isso Pascual Pérez es el Favorito<VE 1J ? ? ? *?????? ? *°" +' Seleccionado Ayer el Equipo Mundial de Balompié —• - . a» . (VEA COL. 4) Antofagasta, Chile En Puerto Rico Campeonato Mundial de Basket Derrotó a México Primero Por GUILLERMO FIGUEROA, de la UPI deportes 4 Colombia f Los uruguayos, que hoy jugarán con Filipinas su en la Natación primer partido por lo prueba eliminatoria del Cam- Venezuela Eliminado Gloria Botella Estableció un Nuevo Record. peonato Mundial de Basketball, demostraron estar en a caftqo" de £c*é Oidia J perfectas condiciones en los entrenamientos efectua- I '' —40x34 Fu» «I Seo re Irma Schulter, También de Nacionalidad ii .7 dos ayer. 1\ ' CARACAS, Venezuela, ene- Mexicana Tenia la Marca Anterior. Detalles Se destacaron en el equipo Bligen, Mera y Gar- ro 15 (UPl)—Puerto Rico CARACAS, enero 14. (UPI) 4) cía, que exhibieron gran ogilidad y seguridad en los venció a Colombia por Mauricio Ocampo, Mé- 86 | Las mexicanas Blanca Luz Ba- xico remates. Alvaro Roca, que ayer se sentía indispuesto, a 5.12.8 68 en el Torneo Masculino rrón y Gloria Botella, ganaron 5) Julio Martínez amaneció hoy restablecido. de Basketball. Al finalizar Guevara, Resultados de los Octavos las dos primeras pruebas de na- El Salvador 5.19.8 En el otro partido de la noche se medirán Bulga- el primer tiempo el acore fa- tación efectuadas esta noche en 6) Jorge Alberto Flores, El que es- ria y Puerto Rico. cuadro puertorriqueño, vorecía a los senadores 40 los Juegos Centroamericanos y El Salvador 5.21.3 taba actuado en los Octavos Juegos Centroamericanos a 34. -

Wm 1958 Schweden
WM 1958 SCHWEDEN GRUPPE A 1. Deutschland 3 1 2 0 7- 5 4 08.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 10.647 2. Nordirland 3 1 1 1 4- 5 3 NORDIRLAND – CSSR 1 : 0 (1 : 0) 3. CSSR 3 1 1 1 8- 4 3 Cush (20.) 4. Argentinien 3 1 0 2 5-10 2 Nordirland: Gregg, Keith, McMichael, Blanchflower, Cunningham, Peacock, Bingham, Cush, Dougan, McIlroy, McParland. Trainer: Doherty (NIR) GRUPPE B CSSR: Dolejsi, Mraz, Novak, Pluskal, Cadek, Masopust, 08.06.1958, Västerås (Arosvallen), 9.591 Hovorka, Dvorak, Borovicka, Hartl, Kraus. Trainer: Kolsky SCHOTTLAND – JUGOSLAWIEN 1 : 1 (0 : 1) (CSR) Murray (48.); Petakovic (6.) Schottland: Younger, Caldow, Hewie, Turnbull, Evans, Cowie, 08.06.1958, Malmö (Malmö Stadion), 31.156 Leggat, Murray, Mudie, Collins, Imlach. Trainer: Walker (SCO) DEUTSCHLAND – ARGENTINIEN 3 : 1 (2 : 1) Jugoslawien: Beara, Sijakovic, Crnkovic, Krstic, Zebec, Rahn (32.,89.), Seeler (42.); Corbatta (3.) Boskov, Petakovic, Veselinovic, Milutinovic, Sekularac, Rajkov. Deutschland: Herkenrath, Stollenwerk, Juskowiak, Eckel, Trainer: Tirnanic (YUG) Erhardt, Szymaniak, Rahn, F.Walter, Seeler, Schmidt, Schäfer. Trainer: Herberger (GER) 08.06.1958, Norrköping (Idrottsparken), 16.518 Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, FRANKREICH – PARAGUAY 7 : 3 (2 : 2) Varacka, Corbatta, Prado, Menendez, Rojas, O.Cruz. Trainer: Fontaine (24.,30.,67.), Piantoni (52.), Kopa (68.), Stabile (ARG) Wisnieski (61.), Vincent (84.); Amarilla (20.,45./E), Romero (50.) 11.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 14.174 Frankreich: Remetter, Kaelbel, Lerond, Penverne, Jonquet, ARGENTINIEN – NORDIRLAND 3 : 1 (1 : 1) Marcel, Wisnieski, Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent. Trainer: Corbatta (38./E), Menendez (55.), Avio (60.); Batteux (FRA) McParland (3.) Paraguay: Mageregger, Arevalo, Miranda, Achucaro, Lezcano, Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, Villalba, Agüero, Parodi, Romero, Re, Amarilla. -

Team Checklist I Have the Complete Set 1966/67 FKS Publishers World Cup Stars
Nigel's Webspace - English Football Cards 1965/66 to 1979/80 Team checklist I have the complete set 1966/67 FKS Publishers World Cup Stars Argentina 038 Dimitar Penev 084 Bernard Bosquier 037 Aleksandar Shalamanov 083 Robert Budzynski 008 Rafael Albrecht 035 Ivan Vutsov 082 Andre Chorda 016 Luis Artime 045 Dimitar Yakimov 093 Nestor Combin 006 Oscar Calics 041 Dobromir Zhechev 094 Yvon Douis 005 Roberto Ferreiro 042 Petar Zhehov 092 Philippe Gondet 014 Alberto Gonzalez 095 Gerard Hausser 002 Rolando Irusta Chile 086 Robert Herbin 013 Juan Carlos Lallana 059 Pedro Araya 091 Georges Lech 003 Oscar Malbernat 050 Manuel Astorga 088 Marcel Loncle 012 Oscar Mas 064 Carlos Campos 090 Lucien Muller 010 Ermindo Onega 055 Carlos Contreras 089 Maryan Wisnieski 004 Roberto Perfumo 058 Humberto Cruz 011 Oscar Pianetti 052 Humberto Donoso Hungary 007 Antonio Rattin 057 Luis Eyzagurre 111 Florian Albert 015 Omar Roldan 053 Elias Figueroa 108 Ferenc Bene 001 Miguel Santoro 063 Alberto Fouilloux 109 Janos Farkas 009 Abel Vieytez 049 Adan Godoy 112 Mate Fenyvesi Brazil 056 Roberto Hodge 098 Jozsef Gelei 062 Honorino Landa 102 Istvan Juhasz 031 Dias 060 Ignacio Prieto 104 Imre Mathesz 026 Dudu 061 Leonel Sanchez 099 Sandor Matrai 028 Flavio 051 Aldo Valentini 100 Kalman Meszoly 030 Garrincha 054 Hugo Villanueva 107 Dezso Molnar 023 Gerson 105 Laszlo Nagy 017 Gilmar England 103 Dezso Novak 027 Jairzinho 077 Alan Ball 101 Gyula Rakosi 025 Lima 065 Gordon Banks 106 Erno Solymosi 018 Manga 079 Ian Callaghan 097 Antal Szentmihalyi 022 Pecanho Orlando 075 Bobby -
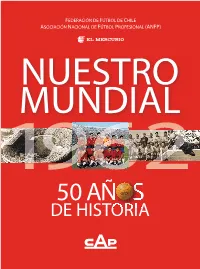
El Mundial, Señores, Se Hace En Chile, Sí O Sí” Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente De Chile
1 2 “El Mundial, señores, se hace en Chile, sí o sí” Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente de Chile. (En respuesta a la FIFA después del terremoto de 1960, el más grande de la historia) “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo” Carlos Dittborn Pinto, Delegado de Chile ante la FIFA. (En su discurso previo a la votación en el congreso de FIFA en Lisboa para elegir la sede del Mundial de 1962 y en la cual nuestro país obtuvo 32 votos, Argentina 10 y se abstuvieron 14 países) 3 4 EL MUNDIAL DE 1962 MARCÓ EN FORMA INDELEBLE A NUESTRO PAÍS Al cumplirse medio siglo de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en Chile, CAP ha querido aportar a su conmemoración este documento que recopila los mejores momentos de ese gran evento de nuestra historia deportiva. Desde la perspectiva que da el tiempo, hoy podemos afirmar que el Mundial de 1962 constituyó un acontecimiento único, que marcó en forma indeleble a nuestro país, tanto por lo realizado en la cancha, como fuera de ella. Chile se sobrepuso a los efectos devastadores del gran terremoto de 1960, y pudo hacer realidad el compromiso que había asumido de organizar esta gran justa deportiva. Esta es la epopeya de una nación que ha vencido reiteradamente a la adversidad, sacando fuerzas de flaquezas, transformando el infortunio en una historia de logros y satisfacciones, donde el tercer puesto alcanzado en 1962 resulta una merecida recompensa al esfuerzo colectivo de toda esa generación. CAP —empresa chilena con 62 años de trayectoria— ha debido sobrellevar idénticas dificultades, producto de esta singular naturaleza que poseemos. -

Offizielle Mitteilungen Kammerer , Jacob Pawlowski , Andreas Putz , Timo Röntsch , Marcus Schierbaum , Sascha He Raus Ge Ber: Deut Scher Fuß Ball-Bund E .V
Nr. 5 31. August 2012 OF FIZIE LLE DEUT SCHER MITT EI LU NGEN FUSS BA LL-BUND Der Deutsche Fußball-Bund trauert um Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den seinen ehemaligen Nationalspieler ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Hans Nowak Rudolf Kreitlein (Glonn) (Stuttgart) der am 19. Juli 2012 im Alter von 74 Jahren der am 31. Juli 2012 im Alter von 92 Jahren verstorben ist. verstorben ist. Hans Nowak bestritt in der Zeit zwischen 1961 Rudolf Kreitlein hat sich seine Meriten als und 1964 insgesamt 15 Länderspiele und Schiedsrichter insbesondere Mitte der 60er- gehörte zum Kader des Deutschen Fußball-Bun - Jahre erworben. 1965 leitete er das Weltpokal- des bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile. finale Inter Mailand gegen Independiente Buenos Aires, rund zwölf Monate später das Endspiel im Von 1958 bis 1962 spielte Hans Nowak für den Europapokal der Landesmeister zwischen Real FC Schalke 04, anschließend bis 1968 für den Madrid und Partizan Belgrad. Höhepunkt s einer FC Bayern München. Mit den Bayern gewann er Laufbahn war die Nominierung für die Weltmeis- 1966 und 1967 den DFB-Pokal und 1967 den terschaft 1966 in England. Insgesamt war der Europapokal der Pokalsieger. Für eine Saison langjährige FIFA-Schiedsrichter bei 18 Länder - wechselte er dann zu den Offenbacher Kickers, spielen im Einsatz. ehe er seine Spieler-Laufbahn bei einigen Ama - teur-Vereinen beendete. In der Bundesliga leitete Rudolf Kreitlein zwi - schen 1963 und 1969 insgesamt 66 Spiele. Der deutsche Fußball hat mit Hans Nowak einen außergewöhnlichen Fußballer verloren, der sich Rudolf Kreitlein hat sich große Verdienste um durch seine Spielstärke und Defensivkünste das Schiedsrichter-Wesen erworben. -

Schiedsrichter Zeitung 03 Offizielles Magazin Des Deutschen Fussball-Bundes 2018 Mai / Juni
SCHIEDSRICHTER ZEITUNG 03 OFFIZIELLES MAGAZIN DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES 2018 MAI / JUNI Titelthema Report Lehrwesen Online FUSSBALL-WM KOMMUNIKATION THEMA MEHR IN RUSSLAND TRAINIEREN FREISTOSS TRANSPARENZ Felix Brych ist einer Obleute-Fortbildung für Der Inhalt des neuen Bundesliga-Schiedsrichter von 36 Schiedsrichtern die „Manager an der Basis“ DFB-Lehrbriefs Nr. 78 erklären ihre Entscheidungen HERE TO CREATE adidas.de/fussball © 2018 adidas AG +156262_SP_FA_H21118_DeadlyStrike_Produckt_Combined_incCopy_P0_DFBSchiri_HFV_BFV_FLWV_Schalke_210x297.indd 1 07.03.18 10:45 3 EDITORIAL INHALT TITELTHEMA LIEBE LESERINNEN 4 Mister 100 Prozent UND LESER, Felix Brych vor der WM in Russland 10 Zwei Lauterer auf Rekordjagd die Saison 2017/2018 befindet sich auf der Zielgeraden. Deutsche Schiedsrichter in der Im zurückliegenden Winter hatten wir im Amateur- WM-Historie bereich witterungsbedingt viele Spielausfälle zu ver- zeichnen, sodass oftmals unter der Woche angesetzt PANORAMA werden musste. Dies bedeutete einen zusätzlichen Auf- 12 DFB und DEKRA bleiben Partner wand für die Schiedsrichter und auch für die Ansetzer, wofür ich allen herzlich danken möchte. LEHRWESEN 14 Thema Freistoß Danke sagen wollen wir von der DFB-Schiedsrichter- Der Inhalt des aktuellen Kommission Amateure auch mit unserer Aktion „Danke DFB- Lehrbriefs Schiri.“: Von den Kreisen über die Bezirke bis in die ▼ 21 Landesverbände fanden tolle Ehrungsveranstaltun- REGEL-TEST HELMUT GEYER, gen zusammen mit unserem Partner DEKRA statt. 16 Vergehen beim Strafstoß VORSITZENDER DER DFB-SCHIEDSRICHTER- Die 63 Preisträger aus den Landesverbänden werden ANALYSE KOMMISSION am 5. Mai 2018 zur Ehrungsveranstaltung des DFB in 18 Länger immer, kürzer nimmer AMATEURE Dortmund zusammenkommen und dort das Bundesliga- Situationen zum Thema Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 im Nachspielzeit Signal Iduna Park besuchen. -

Information Is Taken from the Book "50 Jahre Bundesliga" by Werner Welsch
Information is taken from the book "50 Jahre Bundesliga" by Werner Welsch. Covered are seasons 1963-64 up to season 2011-12. Most consecutive games without receiving a yellow card Outfield players Games Player time span 299 Bum Kun Cha (11.08.1979 - 15.04.1989) 136 Werner Dressel (17.05.1980 - 25.02.1986) 123 Bernd Dürnberger (11.08.1979 - 13.08.1983) 117 Marco Bode (05.08.1989 – 23.09.1995) 109 Klaus Fischer (22.09.1979 – 01.10.1983) 109 Frank Hartmann (19.05.1984 – 17.10.1987) 103 Bernard Dietz (22.05.1982 – 08.11.1986) 103 Hans-Jörg Criens (17.04.1986 – 13.10.1989) 101 Thomas Kroth (31.08.1983 – 30.05.1987) Goalkeepers 212 Andreas Köpke (31.10.1987 – 27.04.1996) [one red card] 183 Ulrich Stein (27.09.1986 – 05.11.1995) [two red cards] 157 Ralf Zumdick (05.09.1981 – 29.05.1987) 152 Oliver Reck (01.08.1987 – 05.03.1994) [one red card] 145 Wolfgang Kleff (11.08.1979 – 03.09.1985) 133 Claus Reitmaier (12.10.1996 – 05.11.2000) 132 Rüdiger Vollborn (19.05.1984 – 22.07.1988) 120 Uwe Kamps (12.03.1983 – 26.08.1989) Most penalty saves absolute 23 of 76 Rudolf Kargus (1974 – 1987) 18 of 88 Harald Schumacher (1974 – 1988) 17 of 64 Norbert Nigbur (1966 – 1981) 14 of 44 Andreas Köpke (1986 – 1996) 14 of 73 Dieter Burdenski (1971 – 1986) 13 of 44 Claus Reitmaier (1991 – 2003) 13 of 57 Richard Golz (1989 – 2005) 12 of 53 Ronnie Hellström (1975 – 1984) 11 of 28 Robert Enke (1998 – 2009) 11 of 36 Petar Radenkovic (1964 to 1970) relative % 39.29 Robert Enke 31.82 Andreas Köpke 31.82 Tim Wiese 30.56 Petar Radenkovic 30.26 Rudolf Kargus 29.55 Claus Reitmaier 26.56 Norbert Nigbur 24.39 Uwe Kamps 24.39 Dr. -

Fotobildband Horst Szymaniak
Seite 16 CRONENBERGER WOCHE 7./8. Dezember 2012 Wuppertal- Frank Hüttemann Bedachungen +++ Viele Freikarten & Bücher zu gewinnen +++ Ihr Meisterbetrieb für Dach, Wand und Solartechnik Spiel gewinnen • Dach-, Fassaden-, und Klempnerarbeiten Hahnerberg. Kunden der Hahner- • Balkon- und Terrassensanierung berg-Apotheke haben in der Ad- Fotobildband Horst Szymaniak ventszeit die Gelegenheit, bei ei- • Energieberatung/Energieausweis Anlässlich des ersten Todestages des Wuppertaler Fußballheroen Horst Szymaniak würdigt ein Bildband den 43-fa- nem Besuch an der Cronenberger • Wärmedämmtechnik eit chen Nationalspieler erstmals ausführlich. Mit 250 vielfach unveröffentlichten Fotografien und Zeitzeugnissen, die weltw n Straße 332 etwas zu gewinnen. • Dachbegrünung Die stärkste ihrem großen Archiv entstammen, zeichnen die Autoren Leben und Karriere des mit Abstand erfolgreichsten Spie- istungs lers, der jemals das blau-rote Trikot des WSV trug. Denn bis Weihnachten verlost In- • Schieferarbeiten le en! haberin Meike Roßberg täglich ein -Anlag Der Leser entdeckt den jungen Horst bei seinen ersten Jugendspielen in Erken- • Solartechnik PV schwick, verfolgt seine Laufbahn, die ihn vom WSV über den KSC, Catania, Inter „Leben in Wuppertal“-Spiel. Mailand und Tasmania Berlin bis in die USA trug, und seine Länderspiel-Erfolge, • Photovoltaik aber auch „Schimmis“ Privatleben während und nach der Karriere. Weggefährten 7KHUPRJUDÀH wie Max Lorenz, Erich Ribbeck, Uwe Seeler oder Hans Tilkowski, aber auch Jour- • Reparaturnotdienst nalisten und Freunde schildern ihre Erinnerungen an ihren Freund „Schorsch“ – Freikarten für ein würdiges Erinnerungsstück für einen stets freundlichen und bescheidenen Telefon 0202 - 976 55 40 • Küllenhahner Str. 242 Star. Posaunenchor 42349 Wuppertal•www.huettemann-bedachungen.de Vom Bergmann über Platzarbeiter im Stadion am Zoo und Tankstellenpächter zum Fußballprofi in Italien, Gastwirt und Lastwagenfahrer – nicht nur die sportli- Ortsmitte. -

Talente Tanzen Auf Vier Hochzeiten
AUSGABE APRIL 2021 WUPPERTALER FUSSBALLSPORT TALENTE TANZEN AUF VIER HOCHZEITEN KLUBS KÄMPFEN SCHICKSALE IM LANGERFELDER UM SPONSOREN WUPPERTALER TRADITION AUS VELBERT SPORTLEBEN IM BLICKPUNKT 2 | IM 44. LEBENSJAHR BERGISCHE HANDBALL-ZEITSCHRIFT* *Alles andere ist nachgemacht AUCH SIR WINSTON CHURCHILL (NO SPORTS) WÄRE EIN FREUND DER BHZ – WÜRDE ER NOCH LEBEN. KOSTENLOS FÜR ALLE HANDBALL- FREUNDE! EINWÜRFE | 3 MOUKI TRIFFT BEWEGUNG IM 44. LEBENSJAHR AUCH FÜR DFB IN DER SZENE * s gab zwei Möglichkeiten. Der WSV hatte BERGISCHE HANDBALL-ZEITSCHRIFT nach dem missglückten Arbeitsversuch mit E Alexander Voigt die Qual der Wahl: Statt für den Wuppertaler Björn Joppe (jetzt Bonner SC) ent- schied sich die sportliche Führungsetage am Zoo für *Alles andere ist nachgemacht einen früheren WSV-Kapitän, der das seit Jahren le- cke Wupper-Schiff wieder flott machen sollte. Fol- ge: Trainer Björn Mehnert (42), der vorher in seiner westfälischen Heimat zweimal gescheitert war, er- wies sich als Glücksfall. Es gab zwei Möglichkeiten. Borussia Dortmund hätte für den ausgeschiedenen Favre einen neuen Cheftrai- ner von außen oder einen von der Bank holen kön- nen. Diesmal tat der BVB das Richtige. Er gab Edin Tercic die Gelegenheit, die Truppe mit den blutjungen sichts überzeugender Auftritte und erkennbarerer Po- Talenten wieder auf Vordermann zu bringen. Späte- sitiventwicklungen: „Hätten sie den mal früher ge- stens nach den erfolgreichen Krimis in der Champi- holt!“ Grammozis kann also viel Vertrauen gewinnen ons League gegen Sevilla ist klar, dass der sympa- in der nächsten Zeit. thische Edin der richtige Coach für die verwöhnten Genau wie „Mehne“ in Wuppertal. Klassenerhalt? s war ein Tor, das die Tür zur deutschen Borussen ist.