Dgfm-Mitteilungen-2013-1.Pdf 4,29 MB
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mushroom Toxins & Poisonings in New Jersey
Mushroom Toxins & Poisonings in New Jersey & Nearby Eastern North America What this document doesn’t do: (1) This document is not intended to be used as a guide for treatment and should not be so used. (2) Mushrooms should not be selected for eating based on the content of this document. [In identifying mushrooms in poisoning cases, this document does not replace expertise that should be obtained by calling NJPIES and obtaining contact with an experienced mycologist.] (3) This document is not a replacement for a detailed toxicological review of the subject of mushroom poisoning. (4) This document is intended for use with a broad set of audiences; for this reasons, it should not be used uncritically in setting protocols [for example, carrying out a Meixner test would be inappropriate for a first responder who would appropriately focus on collecting a poi- soning victim, the relevant objects from the scene of the poisoning, and the critical timing characteristics of the event such as the delay between ingestion and onset of symptoms.] POISON CONTROL: New Jersey “Poison Control” is called NJPIES (New Jersey Poison Information & Education System). Telephone: 1-800-222-1222 [works in all states—(WARN- ING) WILL CONNECT TO A MOBILE PHONE’S HOME STATE—IF YOU’RE UNCERTAIN, USE A LAND- LINE] If the victim is unconscious, call “911.” Background of these notes: This document was originally compiled by Rod Tulloss and Dorothy Smullen for an NJ Mycol. Assoc. workshop, 25 March 2006. Version 2.0 was compiled by Tulloss. When viewed with Acrobat Reader, underlined red or gray words and phrases are “hot linked cross-references.” We have included a few notes on fungal poisons that are not from “mushrooms.” The notes were prepared by mycologists with experience in diagnosis of fungi involved in cases in which ingestion of toxic fungi was suspected. -

Toxic Fungi of Western North America
Toxic Fungi of Western North America by Thomas J. Duffy, MD Published by MykoWeb (www.mykoweb.com) March, 2008 (Web) August, 2008 (PDF) 2 Toxic Fungi of Western North America Copyright © 2008 by Thomas J. Duffy & Michael G. Wood Toxic Fungi of Western North America 3 Contents Introductory Material ........................................................................................... 7 Dedication ............................................................................................................... 7 Preface .................................................................................................................... 7 Acknowledgements ................................................................................................. 7 An Introduction to Mushrooms & Mushroom Poisoning .............................. 9 Introduction and collection of specimens .............................................................. 9 General overview of mushroom poisonings ......................................................... 10 Ecology and general anatomy of fungi ................................................................ 11 Description and habitat of Amanita phalloides and Amanita ocreata .............. 14 History of Amanita ocreata and Amanita phalloides in the West ..................... 18 The classical history of Amanita phalloides and related species ....................... 20 Mushroom poisoning case registry ...................................................................... 21 “Look-Alike” mushrooms ..................................................................................... -
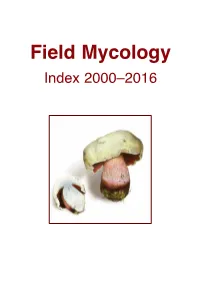
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1 KEYS TO GENERA etc 12 AUTHOR INDEX 13 BOOK REVIEWS & CDs 15 GENERAL SUBJECT INDEX 17 Illustrations are all listed, but only a minority of Amanita pantherina 8(2):70 text references. Keys to genera are listed again, Amanita phalloides 1(2):B, 13(2):56 page 12. Amanita pini 11(1):33 Amanita rubescens (poroid) 6(4):138 Name, volume (part): page (F = Front cover, B = Amanita rubescens forma alba 12(1):11–12 Back cover) Amanita separata 4(4):134 Amanita simulans 10(1):19 SPECIES INDEX Amanita sp. 8(4):B A Amanita spadicea 4(4):135 Aegerita spp. 5(1):29 Amanita stenospora 4(4):131 Abortiporus biennis 16(4):138 Amanita strobiliformis 7(1):10 Agaricus arvensis 3(2):46 Amanita submembranacea 4(4):135 Agaricus bisporus 5(4):140 Amanita subnudipes 15(1):22 Agaricus bohusii 8(1):3, 12(1):29 Amanita virosa 14(4):135, 15(3):100, 17(4):F Agaricus bresadolanus 15(4):113 Annulohypoxylon cohaerens 9(3):101 Agaricus depauperatus 5(4):115 Annulohypoxylon minutellum 9(3):101 Agaricus endoxanthus 13(2):38 Annulohypoxylon multiforme 9(1):5, 9(3):102 Agaricus langei 5(4):115 Anthracoidea scirpi 11(3):105–107 Agaricus moelleri 4(3):102, 103, 9(1):27 Anthurus – see Clathrus Agaricus phaeolepidotus 5(4):114, 9(1):26 Antrodia carbonica 14(3):77–79 Agaricus pseudovillaticus 8(1):4 Antrodia pseudosinuosa 1(2):55 Agaricus rufotegulis 4(4):111. Antrodia ramentacea 2(2):46, 47, 7(3):88 Agaricus subrufescens 7(2):67 Antrodiella serpula 11(1):11 Agaricus xanthodermus 1(3):82, 14(3):75–76 Arcyria denudata 10(3):82 Agaricus xanthodermus var. -

Marseille, Le
THESE PRESENTEE ET PUBLIQUEMENT SOUTENUE DEVANT LA FACULTE DE PHARMACIE DE MARSEILLE Le 5 octobre 2020 Par GIRAUD Annabelle Née le 2 mars 1994 à Marseille EN VUE D’OBTENIR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE TITRE : Mycétismes : bilan et prise en charge en France des principaux syndromes tardifs et des nouveaux syndromes Directrice de thèse : Pr. Anne Favel JURY : Président : Pr. Anne FAVEL Membres : Pr. Alexandrine BERTAUD Dr. Laurence REIGNIER Université d’Aix-Marseille – Faculté de Pharmacie – 27 bd Jean Moulin – CS 30064 - 13385 Marseille cedex 05 - France Tél. : +33 (0)4 91 83 55 00 - Fax : +33 (0)4 91 80 26 12 27 Boulevard Jean Moulin – 13385 MARSEILLE Cedex 05 Tel. : 04 91 83 55 00 – Fax : 04 91 80 26 12 ADMINISTRATION Doyen : Mme Françoise DIGNAT-GEORGE Vice-Doyens : M. Jean-Paul BORG, M. François DEVRED, M. Pascal RATHELOT Chargés de Mission : Mme Pascale BARBIER, M. David BERGE-LEFRANC, Mme Manon CARRE, Mme Caroline DUCROS, Mme Frédérique GRIMALDI Conseiller du Doyen : M. Patrice VANELLE Doyens honoraires : M. Jacques REYNAUD, M. Pierre TIMON-DAVID, M. Patrice VANELLE Professeurs émérites : M. José SAMPOL, M. Athanassios ILIADIS, M. Jean-Pierre REYNIER, M. Henri PORTUGAL Professeurs honoraires : M. Guy BALANSARD, M. Yves BARRA, Mme Claudette BRIAND, M. Jacques CATALIN, Mme Andrée CREMIEUX, M. Aimé CREVAT, M. Bernard CRISTAU, M. Gérard DUMENIL, M. Alain DURAND, Mme Danielle GARÇON, M. Maurice JALFRE, M. Joseph JOACHIM, M. Maurice LANZA, M. José MALDONADO, M. Patrick REGLI, M. Jean- Claude SARI Chef des Services Administratifs : Mme Florence GAUREL Chef de Cabinet : Mme Aurélie BELENGUER Responsable de la Scolarité : Mme Nathalie BESNARD DEPARTEMENT BIO-INGENIERIE PHARMACEUTIQUE Responsable : Professeur Philippe PICCERELLE PROFESSEURS BIOPHYSIQUE M. -

Paralepistopsis Amoenolens: First Record of a Rare and Poisonous Taxon in Turkey
Turkish Journal of Life Sciences Turk J Life Sci Türk Yaşam Bilimleri Dergisi (2017)2/2:175-179 http://dergipark.gov.tr/tjls e-ISSN: 2536-4472 Received: 25.11.2017 Accepted: 30.12.2017 Research Article Paralepistopsis amoenolens: First Record of A Rare and Poisonous Taxon in Turkey Paralepistopsis amoenolens: Nadir ve Zehirli Bir Taksonun Türkiye'deki İlk Kaydı Ömer F. ÇOLAK Abstract Süleyman Demirel University, Vocational School of Health Services, East Campus, Isparta, Turkey In this study, the rare and poisonous species Paralepistopsis amoenolens (Turkish: E-mail: [email protected] Kokulu felceden, English: Paralysis funnel) is reported from Turkey for the first time. Microscopic images and descriptions of the species are given together with Oğuzhan KAYGUSUZ* macroscopic photographs. Pamukkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, Kınıklı, Denizli, Turkey Key Words: Toxic species, erythromelalgia, taxonomy, Tricholomataceae. E-mail: [email protected] Öz Eliseo BATTISTIN Natural History Museum, Valdagno, VI, Italy Bu çalışmada, nadir ve zehirli bir tür olan Paralepistopsis amoenolens (Kokulu E-mail: [email protected] felceden) Türkiye’den ilk kez rapor edilmektedir. Türün fotoğrafı ile birlikte mikroskobik görüntüsü ve deskripsiyonu verilmektedir. *Corresponding author Handling Editor: B. Toprak Anahtar Kelimeler: Zehirli tür, eritromelalji, taksonomi, Tricholomataceae. 1. Introduction Paralepistopsis Vizzini (2012) is a new genus introduced Doğan and Kurt 2016; Kaygusuz et al. 2016; Topcu-Sesli as a consequence of molecular studies: it belongs to the and Sesli 2016; Sesli et al. 2016; Şen et al. 2016; Çolak family Tricholomataceae Lotsy and encompasses a et. al. 2017; Işık and Türkekul 2017; Kaygusuz and Çolak couple of taxa previously inserted in the genus Clitocybe 2017a; Kaygusuz and Çolak 2017b; Türkekul 2017; Uzun (Fr). -

Abstracts of Journals Received in the Library Oct –Dec 2012
Abstracts of Journals Received in the Library Oct –Dec 2012 Journals Abstracted Bulletin de la Societe Mycologique de France –Vol 127, 1 & 2, 2011 Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde Vol. 90, nos. 1,2,3, 4, & 5, 2012 Miscellanea Mycologica – No 103, July 2012 Myologicke Listy – No 120, 2012 Myologicke Listy – No 121, 2012 Mushroom – Issue 108, Vol 29, No 1-2 Bolets de Catalunya – XXX1, 2012 The Mycophile - Vol. 52:5, Sep/Oct 2012 Mycobiology – Vol 40, 3, Sep 2012 Mycological Research Information about recent issues (including free access to contents lists and abstracts of published papers) can be found on the Elsevier website at www.elsevier.com/locate/mycres (Abstractor – Anne Andrews unless stated otherwise) Bulletin de la Societe Mycologique de France –Vol 127, 1 & 2, 2011 Carteret X & Reumaux (pp. 1-53) [French] The authors propose a new taxonomical approach to Inocybes in Section Lilacinae. They propose 8 new species. These species are described in detail and illustrated with b/w drawings of microscopic features and paintings of f/bs. Latin descriptions are included at the end of the article. A key to Section Lilacinae, with a key to sub-sections, series and stirps and then a key to taxa is provided. (44 refs.) Botton B, Guillaumin J J & Le Tacon F (pp. 55-80) [French] The use of molecular methods has changed concepts of the phylogeny of fungi. This article traces the development of fungi from a form of bacteria in middle Pre-Cambrian times, to Eyssartier G, Ducousso M & Buyck B (pp.81-98) [French & Latin] Account of the white Entoloma species of the island of New Caledonia. -

Mushroom Toxins & Poisonings
Mushroom Toxins & Poisonings (N.J. & NE U.S.A.) POISON CONTROL: In New Jersey, “poison control” is NJPIES (New Jersey Poison Informa- tion and Education System) and can be reached by dialing 1-800-222-1222 (works in all states, but (WARNING) will be automatically connected to the home state of a cell phone)or1-800- POISON1 (connects only to NJPIES). These notes prepared by Rod Tulloss and Dorothy Smullen for an NJ Mycol. Assoc. work- shop, 25 March 2006. When viewed with Acrobat Reader, underlined red or gray words and phrases are “hot linked.” We have included a few notes on fungal poisons that are not from “mushrooms.” We caution that this document has not been reviewed by a professional toxicolo- gist or pathologist. Main reference: Benjamin, D. R. 1995. Mushrooms: Poisons and panaceas. (W. H. Freeman, New York). xxvi+422 pp. Citation of this reference omits the date of publication. Other valuable references may be found in “Bibliography”onpage20. The authors have also added information from their own experiences and unpublished data and information supplied by persons experienced with identifying mushrooms in poisoning cases and tracking the course of those cases (see “Acknowledgments”onpage20). Table 1. Benjamin’s “Major Clinical Syndromes” Chart For miscellaneous other syndromes and their causes, see the section below labeled “Miscellaneous or recently reported syndromes caused by fungi”onpage16and “Table 2. Benjamin’s list of rarely eaten toxic fungi [not oth- erwise covered in this summary]”onpage2. Onset Initial Evolution Syndrome of Symptoms Signs & Symptoms of clinical features 6-8 hrs: Vomiting, diarrhea, abdominal Liver failure, hemolysis, fever, Gyromitrin I. -

5° Convegno Internazionale Di Micotossicologia
PAGINE DI MICOLOGIA 5° Convegno Internazionale di Micotossicologia Funghi e salute: problematiche cliniche, igienico-sanitarie, ecosistemiche, normative e ispettive, legate alla globalizzazione commerciale Associazione Micologica Bresadola “Fondazione Centro Studi Micologici” Commissione Micotossicologia In collaborazione con: Centro Antiveleni di Milano Provincia di Milano Con il Patrocinio di: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM 1 PdM 37.pmd 1 14/01/17, 11.45 A.M.B. Centro Studi Micologici 5° Convegno Internazionale di Micotossicologia 3-4 dicembre 2012 Centro Congressi Provincia di Milano Via Corridoni, 16 - Milano SEGRETERIA SCIENTIFICA L. Cocchi - Gruppo Franchi - AMB di Reggio Emilia E-mail: [email protected] C. Siniscalco - ISPRA/GMEM-AMB E-mail: [email protected] SEGRETERIA ORGANIZZATIVA G. Visentin - Segretario AMB E-mail: [email protected] P. Follesa - Comitato scientifico AMB E-mail: [email protected] C. Converso - Provincia di Milano E-mail: [email protected] COMMISSIONE MICOTOSSICOLOGIA CSM-AMB O. Tani - E-mail: [email protected] E. Borghi - E-mail: [email protected] E. Brunelli - E-mail:[email protected] L. Cocchi - E-mail: [email protected] P. Follesa - E-mail: [email protected] A. Granziero - E-mail: [email protected] K. Kob - E-mail: [email protected] C. Siniscalco - E-mail: [email protected] G. Visentin - E-mail: [email protected] 2 PdM 37.pmd 2 14/01/17, 11.45 PAGINE DI MICOLOGIA 5° Convegno Internazionale di Micotossicologia PROGRAMMA SCIENTIFICO 3 dicembre 2012 8.30 Registrazione dei partecipanti 9.00 Apertura dei lavori - saluto delle Autorità: N.U. -

<I>Paralepistopsis</I> Gen. Nov. and <I>Paralepista</I> (<I>Basidiomycota, Agaricales</I>)
ISSN (print) 0093-4666 © 2012. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON http://dx.doi.org/10.5248/120.253 Volume 120, pp. 253–267 April–June 2012 Paralepistopsis gen. nov. and Paralepista (Basidiomycota, Agaricales) Alfredo Vizzini* & Enrico Ercole Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università degli Studi di Torino, Viale Mattioli 25, I-10125, Torino, Italy *Correspondence to: [email protected] Abstract — Paralepistopsis, a new genus in Agaricales, is proposed for the rare toxic species, Clitocybe amoenolens from North Africa (Morocco) and southern and southwestern Europe and C. acromelalga from Asia (Japan and South Korea). Paralepistopsis is distinguished from its allied clitocyboid genera by a Lepista flaccida-like habit, a pileipellis with diverticulate hyphae, small non-lacrymoid basidiospores with a smooth slightly cyanophilous and inamyloid wall, and the presence of toxic acromelic acids. Combined ITS-LSU sequence analyses place Paralepistopsis close to Cleistocybe and Catathelasma within the tricholomatoid clade. Our phylogenetic analysis further supports Lepista subg. Paralepista (= Lepista sect. Gilva) as an independent clitocyboid evolutionary line. We recognize the genus Paralepista, for which we propose twelve new combinations. Key words — Agaricomycetes, erythromelalgia/acromelalgic syndrome, Clitocybe sect. Gilvaoideae, /catathelasma clade Introduction The genusClitocybe (Fr.) Staude traditionally encompassed saprobic agarics that produce fleshy basidiomata with often adnate-decurrent lamellae, convex to funnel-shaped pilei, usually a whitish to pinkish yellow spore print, and smooth non-amyloid basidiospores (Kühner 1980, Singer 1986, Bas 1990, Raithelhuber 1995, 2004). Recent molecular studies that included a significant number of Clitocybe species (Moncalvo et. al. 2002, Redhead et al. 2002, Matheny et al. -

<I>Paralepistopsis</I> Gen. Nov. and <I>Paralepista</I> (<I>Basidiomycota, Agaricales</I>)
ISSN (print) 0093-4666 © 2012. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON http://dx.doi.org/10.5248/120.253 Volume 120, pp. 253–267 April–June 2012 Paralepistopsis gen. nov. and Paralepista (Basidiomycota, Agaricales) Alfredo Vizzini* & Enrico Ercole Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università degli Studi di Torino, Viale Mattioli 25, I-10125, Torino, Italy *Correspondence to: [email protected] Abstract — Paralepistopsis, a new genus in Agaricales, is proposed for the rare toxic species, Clitocybe amoenolens from North Africa (Morocco) and southern and southwestern Europe and C. acromelalga from Asia (Japan and South Korea). Paralepistopsis is distinguished from its allied clitocyboid genera by a Lepista flaccida-like habit, a pileipellis with diverticulate hyphae, small non-lacrymoid basidiospores with a smooth slightly cyanophilous and inamyloid wall, and the presence of toxic acromelic acids. Combined ITS-LSU sequence analyses place Paralepistopsis close to Cleistocybe and Catathelasma within the tricholomatoid clade. Our phylogenetic analysis further supports Lepista subg. Paralepista (= Lepista sect. Gilva) as an independent clitocyboid evolutionary line. We recognize the genus Paralepista, for which we propose twelve new combinations. Key words — Agaricomycetes, erythromelalgia/acromelalgic syndrome, Clitocybe sect. Gilvaoideae, /catathelasma clade Introduction The genusClitocybe (Fr.) Staude traditionally encompassed saprobic agarics that produce fleshy basidiomata with often adnate-decurrent lamellae, convex to funnel-shaped pilei, usually a whitish to pinkish yellow spore print, and smooth non-amyloid basidiospores (Kühner 1980, Singer 1986, Bas 1990, Raithelhuber 1995, 2004). Recent molecular studies that included a significant number of Clitocybe species (Moncalvo et. al. 2002, Redhead et al. 2002, Matheny et al. -

Investigation and Analysis of 102 Mushroom Poisoning Cases in Southern China from 1994 to 2012
Fungal Diversity (2014) 64:123–131 DOI 10.1007/s13225-013-0260-7 Investigation and analysis of 102 mushroom poisoning cases in Southern China from 1994 to 2012 Zuohong Chen & Ping Zhang & Zhiguang Zhang Received: 17 June 2013 /Accepted: 31 July 2013 /Published online: 15 August 2013 # Mushroom Research Foundation 2013 Abstract Mushroom poisoning is the main cause of mortality Keywords Mushroom poisoning . Amanita . Syndrome . in food poisoning incidents in China. Although some respon- Psilocybe samuiensis . Rhabdomyolysis sible mushroom species have been identified, some were identified inaccuratly. This study investigated and analyzed 102 mushroom poisoning cases in southern China from 1994 Introduction to 2012, which involved 852 patients and 183 deaths, with an overall mortality of 21.48 %. The results showed that 85.3 % Approximately 3,800 species of mushrooms have been of poisoning cases occurred from June to September, and catalogued in China, and about 421 species are considered involved 16 species of poisonous mushroom: Amanita species as poisonous (Mao 2000, 2006). Collecting wild mushrooms (A. fuliginea, A. exitialis, A. subjunquillea var. alba, A. cf. for human consumption has been a long-standing tradition in pseudoporphyria, A. kotohiraensis, A. neoovoidea, A. many areas in southern China. However, edible and poisonous gymnopus), Galerina sulciceps, Psilocybe samuiensis, mushrooms may be frequently confused, or their identities Russula subnigricans, R. senecis, R. japonica, Chlorophyllum mistaken, leading to an annual toll of mushroom poisoning molybdites, Paxillus involutus, Leucocoprinus cepaestipes incidents. The statistical data of the national food poisoning and Pulveroboletus ravenelii. Six species (A. subjunquillea report from the Chinese Center for Disease Control and Pre- var. -

Application of Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Targeted and Non-Targeted Analysis in Toxic and Edible Mushrooms
Luís Miguel da Fonseca Carvalho Application of Gas Chromatography-Mass Spectrometry for targeted and non-targeted analysis in toxic and edible mushrooms Dissertação do 2º Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Toxicologia Analítica, Clínica e Forense Trabalho realizado sob a orientação da Doutora Paula Guedes de Pinho – REQUIMTE, Laboratório de Toxicologia, Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto; e co-orientação do Professor Doutor Félix Carvalho – Laboratório de Toxicologia, Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto; e da Professora Doutora Paula Baptista – CIMO/Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança. Outubro de 2012 Application of Gas Chromatography-Mass Spectrometry for targeted and non-targeted analysis in toxic and edible mushrooms É autorizada a reprodução integral deste trabalho apenas para efeitos de investigação, mediante declaração escrita do interessado, que a tal se compromete. ii Application of Gas Chromatography-Mass Spectrometry for targeted and non-targeted analysis in toxic and edible mushrooms ACKNOWLEDGMENTS Agradecimentos Em primeiro lugar quero agradecer à Doutora Paula Guedes de Pinho, orientadora deste trabalho, pelos conhecimentos que me transmitiu ao longo deste ano, os quais foram fundamentais para a realização desta investigação, bem como pelo seu constante apoio, preocupação e incentivo. De igual modo tenho a agradecer aos meus co-orientadores. Ao Professor Doutor Félix Carvalho pelos conselhos e saber transmitidos e pelo seu constante entusiasmo e otimismo. O meu agradecimento também à Professora Doutora Paula Baptista pela disponibilidade, simpatia e grande ajuda na vertente “micológica” deste trabalho. Tenho também de agradecer à Professora Doutora Maria de Lourdes Bastos pelo seu empenho e esforço para o desenvolvimento, primando sempre pela excelência e qualidade, do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.