Dgfm-Mitteilungen-2013-2.Pdf 2,56 MB
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mushroom Toxins & Poisonings in New Jersey
Mushroom Toxins & Poisonings in New Jersey & Nearby Eastern North America What this document doesn’t do: (1) This document is not intended to be used as a guide for treatment and should not be so used. (2) Mushrooms should not be selected for eating based on the content of this document. [In identifying mushrooms in poisoning cases, this document does not replace expertise that should be obtained by calling NJPIES and obtaining contact with an experienced mycologist.] (3) This document is not a replacement for a detailed toxicological review of the subject of mushroom poisoning. (4) This document is intended for use with a broad set of audiences; for this reasons, it should not be used uncritically in setting protocols [for example, carrying out a Meixner test would be inappropriate for a first responder who would appropriately focus on collecting a poi- soning victim, the relevant objects from the scene of the poisoning, and the critical timing characteristics of the event such as the delay between ingestion and onset of symptoms.] POISON CONTROL: New Jersey “Poison Control” is called NJPIES (New Jersey Poison Information & Education System). Telephone: 1-800-222-1222 [works in all states—(WARN- ING) WILL CONNECT TO A MOBILE PHONE’S HOME STATE—IF YOU’RE UNCERTAIN, USE A LAND- LINE] If the victim is unconscious, call “911.” Background of these notes: This document was originally compiled by Rod Tulloss and Dorothy Smullen for an NJ Mycol. Assoc. workshop, 25 March 2006. Version 2.0 was compiled by Tulloss. When viewed with Acrobat Reader, underlined red or gray words and phrases are “hot linked cross-references.” We have included a few notes on fungal poisons that are not from “mushrooms.” The notes were prepared by mycologists with experience in diagnosis of fungi involved in cases in which ingestion of toxic fungi was suspected. -

Full-Text (PDF)
African Journal of Microbiology Research Vol. 5(31), pp. 5750-5756, 23 December, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJMR ISSN 1996-0808 ©2011 Academic Journals DOI: 10.5897/AJMR11.1228 Full Length Research Paper Leucocalocybe, a new genus for Tricholoma mongolicum (Agaricales, Basidiomycota) Xiao-Dan Yu1,2, Hui Deng1 and Yi-Jian Yao1,3* 1State Key Laboratory of Mycology, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100101, China. 2Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China. 3Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, United Kingdom. Accepted 11 November, 2011 A new genus of Agaricales, Leucocalocybe was erected for a species Tricholoma mongolicum in this study. Leucocalocybe was distinguished from the other genera by a unique combination of macro- and micro-morphological characters, including a tricholomatoid habit, thick and short stem, minutely spiny spores and white spore print. The assignment of the new genus was supported by phylogenetic analyses based on the LSU sequences. The results of molecular analyses demonstrated that the species was clustered in tricholomatoid clade, which formed a distinct lineage. Key words: Agaricales, taxonomy, Tricholoma, tricholomatoid clade. INTRODUCTION The genus Tricholoma (Fr.) Staude is typified by having were re-described. Based on morphological and mole- distinctly emarginate-sinuate lamellae, white or very pale cular analyses, T. mongolicum appears to be aberrant cream spore print, producing smooth thin-walled within Tricholoma and un-subsumable into any of the basidiospores, lacking clamp connections, cheilocystidia extant genera. Accordingly, we proposed to erect a new and pleurocystidia (Singer, 1986). Most species of this genus, Leucocalocybe, to circumscribe the unique genus form obligate ectomycorrhizal associations with combination of features characterizing this fungus and a forest trees, only a few species in the subgenus necessary new combination. -
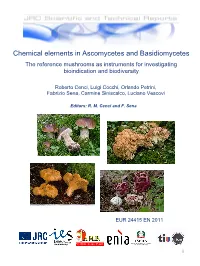
Chemical Elements in Ascomycetes and Basidiomycetes
Chemical elements in Ascomycetes and Basidiomycetes The reference mushrooms as instruments for investigating bioindication and biodiversity Roberto Cenci, Luigi Cocchi, Orlando Petrini, Fabrizio Sena, Carmine Siniscalco, Luciano Vescovi Editors: R. M. Cenci and F. Sena EUR 24415 EN 2011 1 The mission of the JRC-IES is to provide scientific-technical support to the European Union’s policies for the protection and sustainable development of the European and global environment. European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Via E.Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA) Italy Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/ JRC Catalogue number: LB-NA-24415-EN-C Editors: R. M. Cenci and F. Sena JRC65050 EUR 24415 EN ISBN 978-92-79-20395-4 ISSN 1018-5593 doi:10.2788/22228 Luxembourg: Publications Office of the European Union Translation: Dr. Luca Umidi © European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 Attached to this document is a CD containing: • A PDF copy of this document • Information regarding the soil and mushroom sampling site locations • Analytical data (ca, 300,000) on total samples of soils and mushrooms analysed (ca, 10,000) • The descriptive statistics for all genera and species analysed • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in mushrooms • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in soils 3 Contact information: Address: Roberto M. -

Trametes Ochracea on Birch, Pasadena Ski and Andrus Voitk Nature Park, Sep
V OMPHALINForay registration & information issueISSN 1925-1858 Vol. V, No 4 Newsletter of Apr. 15, 2014 OMPHALINA OMPHALINA, newsletter of Foray Newfoundland & Labrador, has no fi xed schedule of publication, and no promise to appear again. Its primary purpose is to serve as a conduit of information to registrants of the upcoming foray and secondarily as a communications tool with members. Issues of OMPHALINA are archived in: is an amateur, volunteer-run, community, Library and Archives Canada’s Electronic Collection <http://epe. not-for-profi t organization with a mission to lac-bac.gc.ca/100/201/300/omphalina/index.html>, and organize enjoyable and informative amateur Centre for Newfoundland Studies, Queen Elizabeth II Library mushroom forays in Newfoundland and (printed copy also archived) <http://collections.mun.ca/cdm4/ description.php?phpReturn=typeListing.php&id=162>. Labrador and disseminate the knowledge gained. The content is neither discussed nor approved by the Board of Directors. Therefore, opinions expressed do not represent the views of the Board, Webpage: www.nlmushrooms.ca the Corporation, the partners, the sponsors, or the members. Opinions are solely those of the authors and uncredited opinions solely those of the Editor. ADDRESS Foray Newfoundland & Labrador Please address comments, complaints, contributions to the self-appointed Editor, Andrus Voitk: 21 Pond Rd. Rocky Harbour NL seened AT gmail DOT com, A0K 4N0 CANADA … who eagerly invites contributions to OMPHALINA, dealing with any aspect even remotely related to mushrooms. E-mail: info AT nlmushrooms DOT ca Authors are guaranteed instant fame—fortune to follow. Authors retain copyright to all published material, and BOARD OF DIRECTORS CONSULTANTS submission indicates permission to publish, subject to the usual editorial decisions. -

Toxic Fungi of Western North America
Toxic Fungi of Western North America by Thomas J. Duffy, MD Published by MykoWeb (www.mykoweb.com) March, 2008 (Web) August, 2008 (PDF) 2 Toxic Fungi of Western North America Copyright © 2008 by Thomas J. Duffy & Michael G. Wood Toxic Fungi of Western North America 3 Contents Introductory Material ........................................................................................... 7 Dedication ............................................................................................................... 7 Preface .................................................................................................................... 7 Acknowledgements ................................................................................................. 7 An Introduction to Mushrooms & Mushroom Poisoning .............................. 9 Introduction and collection of specimens .............................................................. 9 General overview of mushroom poisonings ......................................................... 10 Ecology and general anatomy of fungi ................................................................ 11 Description and habitat of Amanita phalloides and Amanita ocreata .............. 14 History of Amanita ocreata and Amanita phalloides in the West ..................... 18 The classical history of Amanita phalloides and related species ....................... 20 Mushroom poisoning case registry ...................................................................... 21 “Look-Alike” mushrooms ..................................................................................... -

Notes on Clitocybe S. Lato (Agaricales)
Ann. Bot. Fennici 40: 213–218 ISSN 0003-3847 Helsinki 19 June 2003 © Finnish Zoological and Botanical Publishing Board 2003 Notes on Clitocybe s. lato (Agaricales) Harri Harmaja Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, P.O Box 7, FIN-00014 University of Helsinki, Finland (e-mail: harri.harmaja@helsinki.fi ) Received 7 Feb. 2003, revised version received 28 Mar. 2003, accepted 1 Apr. 2003 Harmaja, H. 2003: Notes on Clitocybe s. lato (Agaricales). — Ann. Bot. Fennici 40: 213–218. Agaricus nebularis Batsch : Fr. is approved as the lectotype of the genus Clitocybe (Fr.) Staude (Agaricales: Tricholomataceae). Lepista (Fr.) W.G. Smith is a younger taxonomic synonym. Diagnostic characters of Clitocybe are discussed; among the less known ones are: (i) a proportion of the detached spores adhere in tetrads in microscopic mounts, (ii) the spore wall is cyanophilic, and (iii) the mycelium is capable of reducing nitrate. Three new nomenclatural combinations in Clitocybe are made. The new genus Infundibulicybe Harmaja, with Agaricus gibbus Pers. : Fr. as the type, is segregated for the core group of those species of Clitocybe s. lato that do not fi t to the genus as defi ned here. Infundibulicybe mainly differs from Clitocybe in that: (i) the spores do not adhere in tetrads, (ii) all or a proportion of the spores have confl uent bases, (iii) all or most of the spores are lacrymoid in shape, (iv) the spore wall is cyanophobic, and (v) the mycelium is incapable of reducing nitrate. Thirteen new nomenclatural combinations in Infundibulicybe are made. Two new nomenclatural combinations are made in Ampulloclitocybe Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (syn. -

Notes, Outline and Divergence Times of Basidiomycota
Fungal Diversity (2019) 99:105–367 https://doi.org/10.1007/s13225-019-00435-4 (0123456789().,-volV)(0123456789().,- volV) Notes, outline and divergence times of Basidiomycota 1,2,3 1,4 3 5 5 Mao-Qiang He • Rui-Lin Zhao • Kevin D. Hyde • Dominik Begerow • Martin Kemler • 6 7 8,9 10 11 Andrey Yurkov • Eric H. C. McKenzie • Olivier Raspe´ • Makoto Kakishima • Santiago Sa´nchez-Ramı´rez • 12 13 14 15 16 Else C. Vellinga • Roy Halling • Viktor Papp • Ivan V. Zmitrovich • Bart Buyck • 8,9 3 17 18 1 Damien Ertz • Nalin N. Wijayawardene • Bao-Kai Cui • Nathan Schoutteten • Xin-Zhan Liu • 19 1 1,3 1 1 1 Tai-Hui Li • Yi-Jian Yao • Xin-Yu Zhu • An-Qi Liu • Guo-Jie Li • Ming-Zhe Zhang • 1 1 20 21,22 23 Zhi-Lin Ling • Bin Cao • Vladimı´r Antonı´n • Teun Boekhout • Bianca Denise Barbosa da Silva • 18 24 25 26 27 Eske De Crop • Cony Decock • Ba´lint Dima • Arun Kumar Dutta • Jack W. Fell • 28 29 30 31 Jo´ zsef Geml • Masoomeh Ghobad-Nejhad • Admir J. Giachini • Tatiana B. Gibertoni • 32 33,34 17 35 Sergio P. Gorjo´ n • Danny Haelewaters • Shuang-Hui He • Brendan P. Hodkinson • 36 37 38 39 40,41 Egon Horak • Tamotsu Hoshino • Alfredo Justo • Young Woon Lim • Nelson Menolli Jr. • 42 43,44 45 46 47 Armin Mesˇic´ • Jean-Marc Moncalvo • Gregory M. Mueller • La´szlo´ G. Nagy • R. Henrik Nilsson • 48 48 49 2 Machiel Noordeloos • Jorinde Nuytinck • Takamichi Orihara • Cheewangkoon Ratchadawan • 50,51 52 53 Mario Rajchenberg • Alexandre G. -

Early Diverging Clades of Agaricomycetidae Dominated by Corticioid Forms
Mycologia, 102(4), 2010, pp. 865–880. DOI: 10.3852/09-288 # 2010 by The Mycological Society of America, Lawrence, KS 66044-8897 Amylocorticiales ord. nov. and Jaapiales ord. nov.: Early diverging clades of Agaricomycetidae dominated by corticioid forms Manfred Binder1 sister group of the remainder of the Agaricomyceti- Clark University, Biology Department, Lasry Center for dae, suggesting that the greatest radiation of pileate- Biosciences, 15 Maywood Street, Worcester, stipitate mushrooms resulted from the elaboration of Massachusetts 01601 resupinate ancestors. Karl-Henrik Larsson Key words: morphological evolution, multigene Go¨teborg University, Department of Plant and datasets, rpb1 and rpb2 primers Environmental Sciences, Box 461, SE 405 30, Go¨teborg, Sweden INTRODUCTION P. Brandon Matheny The Agaricomycetes includes approximately 21 000 University of Tennessee, Department of Ecology and Evolutionary Biology, 334 Hesler Biology Building, described species (Kirk et al. 2008) that are domi- Knoxville, Tennessee 37996 nated by taxa with complex fruiting bodies, including agarics, polypores, coral fungi and gasteromycetes. David S. Hibbett Intermixed with these forms are numerous lineages Clark University, Biology Department, Lasry Center for Biosciences, 15 Maywood Street, Worcester, of corticioid fungi, which have inconspicuous, resu- Massachusetts 01601 pinate fruiting bodies (Binder et al. 2005; Larsson et al. 2004, Larsson 2007). No fewer than 13 of the 17 currently recognized orders of Agaricomycetes con- Abstract: The Agaricomycetidae is one of the most tain corticioid forms, and three, the Atheliales, morphologically diverse clades of Basidiomycota that Corticiales, and Trechisporales, contain only corti- includes the well known Agaricales and Boletales, cioid forms (Hibbett 2007, Hibbett et al. 2007). which are dominated by pileate-stipitate forms, and Larsson (2007) presented a preliminary classification the more obscure Atheliales, which is a relatively small in which corticioid forms are distributed across 41 group of resupinate taxa. -
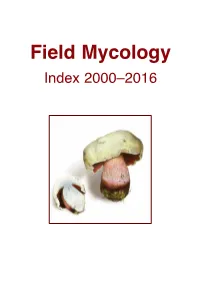
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1 KEYS TO GENERA etc 12 AUTHOR INDEX 13 BOOK REVIEWS & CDs 15 GENERAL SUBJECT INDEX 17 Illustrations are all listed, but only a minority of Amanita pantherina 8(2):70 text references. Keys to genera are listed again, Amanita phalloides 1(2):B, 13(2):56 page 12. Amanita pini 11(1):33 Amanita rubescens (poroid) 6(4):138 Name, volume (part): page (F = Front cover, B = Amanita rubescens forma alba 12(1):11–12 Back cover) Amanita separata 4(4):134 Amanita simulans 10(1):19 SPECIES INDEX Amanita sp. 8(4):B A Amanita spadicea 4(4):135 Aegerita spp. 5(1):29 Amanita stenospora 4(4):131 Abortiporus biennis 16(4):138 Amanita strobiliformis 7(1):10 Agaricus arvensis 3(2):46 Amanita submembranacea 4(4):135 Agaricus bisporus 5(4):140 Amanita subnudipes 15(1):22 Agaricus bohusii 8(1):3, 12(1):29 Amanita virosa 14(4):135, 15(3):100, 17(4):F Agaricus bresadolanus 15(4):113 Annulohypoxylon cohaerens 9(3):101 Agaricus depauperatus 5(4):115 Annulohypoxylon minutellum 9(3):101 Agaricus endoxanthus 13(2):38 Annulohypoxylon multiforme 9(1):5, 9(3):102 Agaricus langei 5(4):115 Anthracoidea scirpi 11(3):105–107 Agaricus moelleri 4(3):102, 103, 9(1):27 Anthurus – see Clathrus Agaricus phaeolepidotus 5(4):114, 9(1):26 Antrodia carbonica 14(3):77–79 Agaricus pseudovillaticus 8(1):4 Antrodia pseudosinuosa 1(2):55 Agaricus rufotegulis 4(4):111. Antrodia ramentacea 2(2):46, 47, 7(3):88 Agaricus subrufescens 7(2):67 Antrodiella serpula 11(1):11 Agaricus xanthodermus 1(3):82, 14(3):75–76 Arcyria denudata 10(3):82 Agaricus xanthodermus var. -

Recognition of Mycena Sect. Amparoina Sect. Nov. (Mycenaceae, Agaricales), Including Four New Species and Revision of the Limits of Sect
A peer-reviewed open-access journal MycoKeys 52:Recognition 103–124 (2019) of Mycena sect. Amparoina sect. nov., including four new species... 103 doi: 10.3897/mycokeys.52.34647 RESEARCH ARTICLE MycoKeys http://mycokeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Recognition of Mycena sect. Amparoina sect. nov. (Mycenaceae, Agaricales), including four new species and revision of the limits of sect. Sacchariferae Qin Na1, Tolgor Bau1 1 Engineering Research Centre of Chinese Ministry of Education for Edible and Medicinal Fungi, Jilin Agri- cultural University, Changchun 130118, China Corresponding author: Tolgor Bau ([email protected]) Academic editor: M.P. Martín | Received 19 March 2019 | Accepted 26 April 2019 | Published 16 May 2019 Citation: Na Q, Bau T (2019) Recognition of Mycena sect. Amparoina sect. nov. (Mycenaceae, Agaricales), including four new species and revision of the limits of sect. Sacchariferae. MycoKeys 52: 103–124. https://doi.org/10.3897/ mycokeys.52.34647 Abstract Phylogenetic reconstruction revealed that Mycena stirps Amparoina, which is traditionally classified in sect. Sacchariferae, should be treated at section level. Section Amparoina is characterised by the presence or absence of cherocytes, the presence of acanthocysts and spinulose caulocystidia. Eight species referred to Mycena sect. Amparoina sect. nov. are recognised in China. Of these taxa, four new species classified in the new section are formally described: M. bicystidiata sp. nov., M. griseotincta sp. nov., M. hygrophoroides sp. nov. and M. miscanthi sp. nov. The new species are characterised by the absence of both cherocytes and a basal disc, along with the presence of acanthocysts on the pileus, spinulose cheilocystidia and cau- locystidia. -

Ethnomycological Investigation in Serbia: Astonishing Realm of Mycomedicines and Mycofood
Journal of Fungi Article Ethnomycological Investigation in Serbia: Astonishing Realm of Mycomedicines and Mycofood Jelena Živkovi´c 1 , Marija Ivanov 2 , Dejan Stojkovi´c 2,* and Jasmina Glamoˇclija 2 1 Institute for Medicinal Plants Research “Dr Josif Pancic”, Tadeuša Koš´cuška1, 11000 Belgrade, Serbia; [email protected] 2 Department of Plant Physiology, Institute for Biological Research “Siniša Stankovi´c”—NationalInstitute of Republic of Serbia, University of Belgrade, Bulevar despota Stefana 142, 11000 Belgrade, Serbia; [email protected] (M.I.); [email protected] (J.G.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +381-112078419 Abstract: This study aims to fill the gaps in ethnomycological knowledge in Serbia by identifying various fungal species that have been used due to their medicinal or nutritional properties. Eth- nomycological information was gathered using semi-structured interviews with participants from different mycological associations in Serbia. A total of 62 participants were involved in this study. Eighty-five species belonging to 28 families were identified. All of the reported fungal species were pointed out as edible, and only 15 of them were declared as medicinal. The family Boletaceae was represented by the highest number of species, followed by Russulaceae, Agaricaceae and Polypo- raceae. We also performed detailed analysis of the literature in order to provide scientific evidence for the recorded medicinal use of fungi in Serbia. The male participants reported a higher level of ethnomycological knowledge compared to women, whereas the highest number of used fungi species was mentioned by participants within the age group of 61–80 years. In addition to preserving Citation: Živkovi´c,J.; Ivanov, M.; ethnomycological knowledge in Serbia, this study can present a good starting point for further Stojkovi´c,D.; Glamoˇclija,J. -

Marseille, Le
THESE PRESENTEE ET PUBLIQUEMENT SOUTENUE DEVANT LA FACULTE DE PHARMACIE DE MARSEILLE Le 5 octobre 2020 Par GIRAUD Annabelle Née le 2 mars 1994 à Marseille EN VUE D’OBTENIR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE TITRE : Mycétismes : bilan et prise en charge en France des principaux syndromes tardifs et des nouveaux syndromes Directrice de thèse : Pr. Anne Favel JURY : Président : Pr. Anne FAVEL Membres : Pr. Alexandrine BERTAUD Dr. Laurence REIGNIER Université d’Aix-Marseille – Faculté de Pharmacie – 27 bd Jean Moulin – CS 30064 - 13385 Marseille cedex 05 - France Tél. : +33 (0)4 91 83 55 00 - Fax : +33 (0)4 91 80 26 12 27 Boulevard Jean Moulin – 13385 MARSEILLE Cedex 05 Tel. : 04 91 83 55 00 – Fax : 04 91 80 26 12 ADMINISTRATION Doyen : Mme Françoise DIGNAT-GEORGE Vice-Doyens : M. Jean-Paul BORG, M. François DEVRED, M. Pascal RATHELOT Chargés de Mission : Mme Pascale BARBIER, M. David BERGE-LEFRANC, Mme Manon CARRE, Mme Caroline DUCROS, Mme Frédérique GRIMALDI Conseiller du Doyen : M. Patrice VANELLE Doyens honoraires : M. Jacques REYNAUD, M. Pierre TIMON-DAVID, M. Patrice VANELLE Professeurs émérites : M. José SAMPOL, M. Athanassios ILIADIS, M. Jean-Pierre REYNIER, M. Henri PORTUGAL Professeurs honoraires : M. Guy BALANSARD, M. Yves BARRA, Mme Claudette BRIAND, M. Jacques CATALIN, Mme Andrée CREMIEUX, M. Aimé CREVAT, M. Bernard CRISTAU, M. Gérard DUMENIL, M. Alain DURAND, Mme Danielle GARÇON, M. Maurice JALFRE, M. Joseph JOACHIM, M. Maurice LANZA, M. José MALDONADO, M. Patrick REGLI, M. Jean- Claude SARI Chef des Services Administratifs : Mme Florence GAUREL Chef de Cabinet : Mme Aurélie BELENGUER Responsable de la Scolarité : Mme Nathalie BESNARD DEPARTEMENT BIO-INGENIERIE PHARMACEUTIQUE Responsable : Professeur Philippe PICCERELLE PROFESSEURS BIOPHYSIQUE M.