1 27.1.2016 – Antifa-Mahnmal Salzburg – Barbara Wolf-Wicha
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
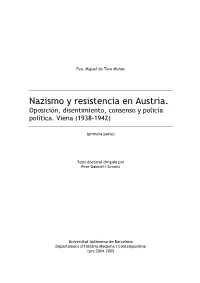
Nazismo Y Resistencia En Austria
Fco. Miguel de Toro Muñoz Nazismo y resistencia en Austria. Oposición, disentimiento, consenso y policía política. Viena (1938-1942) (primera parte) Tesis doctoral dirigida por Pere Gabriel i Sirvent Universitat Autònoma de Barcelona Departament d’Història Moderna i Contemporània curs 2004-2005 Índice Abreviaturas, pág. 8 Introducción. Conceptos, estructura, fuentes y metodología, pág. 15 1. Definiendo algunos conceptos, pág. 23 2. Marco geográfico y temporal, pág. 27 3. Estructura del trabajo, pág. 34 4. Fuentes de investigación y bibliografía, pág. 36 5. Metodología concreta de la investigación, pág. 54 Primera parte. Las organizaciones de control nacional- socialista. Capítulo 1. El aparato represivo del Tercer Reich, pág. 57 1.1. El control sobre la población, pág. 59 1.2. La policía política nacionalsocialista: rupturas y continuidades, pág. 67 1.2.1. La transformación de la policía: de la República de Weimar al Tercer Reich (1918-1933), pág. 67 1.2.2. El nacimiento y desarrollo de la Geheime Staatspolizei (1933-1936), pág. 82 1.2.3. La "nacionalización" de la Gestapo (1936-1939), pág. 90 1.2.4. El personal de la Gestapo, pág. 97 1.2.5 El nacimiento del Departamento Superior de Seguridad del Reich: la glo- balización del control, pág. 110 1.3. Cooperación con otros órganos de control social, pág. 119 1.3.1. Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei, Ordnungspolizei, pág. 120 1.3.2. Geheime Staatspolizei y Sicherheitsdienst (SD), pág. 124 1.3.3. La colaboración con el Partido, pág. 127 1.3.4. Policía y Gestapo como pilares del sistema SS, pág. 128 1.4. Algunas reflexiones, pág. -

Die Stadt Salzburg 1943
Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1943 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Zeitung: SZ Verweise auf die im Stadtarchiv Salzburg befindliche und von Gernod Fuchs transkribierte zeitgenössische „Chronik der Gauhauptstadt Salzburg 1940–1945“ von Thomas Mayrhofer: CGS 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Dezember 1942 (Nachtrag) Dezember 1942 NSKOV-Jahresschlussfeier. Die NSKOV-Fachabteilung erblindeter Krieger hält ihre Jahresschluss- und Weihnachtsfeier ab. Gauamtsleiter Sonner hält eine Ansprache, Gemeinschaftsleiter Allerberger verteilt als Leiter der Gaufachabteilung Salzburg Geschenke. SZ, 4.1.1943, S. 3. Dezember 1942 Kameradschaften. Die NS-Kriegerkameradschaft Maxglan-Riedenburg hält ihren Jahresschlussappell ab. Kameradschaftsführer Reindl hält eine „mitreißende Ansprache“ (5.1.). Die Kameradschaft Wals hält eine Julfeier mit Preisstockschießen ab (7.1.). SZ, 5.1.1943, S. 4. SZ, 7.1.1943, S. 4. Dezember 1942 DRK-Weihnachtsgeschenke. Die Kreisstelle Salzburg des DRK, die für die Betreuung durchreisender Soldaten zuständig ist, beteilt am Weihnachtsabend alle Soldaten mit einem Geschenk. SZ, 7.1.1943, S. 4. Dezember 1942 NSDAP Kuchl. Die NSDAP-Ortsgruppe Kuchl hält ihren Jahresschlussappell in der Turnhalle ab. Ortsgruppenleiter Lenz Hasenbichler, Ortsbauernführer Hans Siller und Bürgermeister Sepp Moldan berichten über die Entwicklung der Gemeinde und des Genossenschaftswesen. SZ, 13.1.1943, S. 4. 2 Die Stadt Salzburg im Jahr 1943 Zeitungsdokumentation von S. Göllner 19.–20.12.1942 Reichsstraßensammlung. Am 19. und 20. sammeln HJ und BdM für das Kriegs-WHW. Als Spenden-Abzeichen werden Miniatur-Spielsachen aus Holz abgegeben. Motor-, Berg- und Feuerwehr-HJ führen ihr Können auf Mozart-, Residenz- und Siegmundsplatz vor. -

Archäologie Österreich 1938
D GESCHICHTE UND LÄNDERKUNDE DA ALLGEMEINES; EPOCHEN DAB Vor- und Frühgeschichte; Archäologie Österreich 1938 - 1945 16-3 Archäologische Denkmalpflege zur NS-Zeit in Österreich : kommentierte Regesten für die "Ostmark" / Marianne Pollak. - Wien [u.a.] : Böhlau, 2015. - 377 S. : Ill., Kt. + 1 CD-ROM. - (Studien zu Denkmalschutz und Denkmalpflege ; 23). - Die CD- ROM enth. Regesten und digitalisierte Dokumente. - ISBN 978- 3-205-20123-6 : EUR 49.00 [#4139] Aus dem Vorwort (S. 9) von Bernhard Hebert, dem Leiter der Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamtes, geht hervor, daß sich das Bundes- denkmalamt im Jahr 2012 dazu entschloß, „als einen Schwerpunkt seiner archäologischen Denkmalforschung ein Projekt zu starten, das nicht nur zu dem vorliegenden Buch, sondern parallel auch zur Vorbereitung der bislang größten einschlägigen Tagung ‚Archäologie in Österreich 1938 - 1945‘ 1 ge- meinsam mit dem Universalmuseum Joanneum (27. - 29. April 2015 in Graz) geführt hat.“ Präsentiert wurde das Buch bereits eine Woche zuvor am 21. April 2015 im Ahnensaal des Bundesdenkmalamtes in der Wiener Hofburg. 2 Besagtes hier nicht näher definiertes Projekt 3 scheint sich in eine Reihe von Projekten zur österreichischen Archäologiegeschichte wie Pro- vinzialrömische Archäologie in Österreich 1918 - 1945 von Gudrun Wlach 4 1 https://www.museum-joanneum.at/archaeologiemuseum-schloss-eggenberg/ihr- besuch/veranstaltungen/events/event/27.04.-29.04.2015/archaeologie-in- oesterreich-1938-1945 http://www.bda.at/events/11/19982/Archaeologie-in-Oesterreich-1938-1945 http://www.museumsbund.at/uploads/ausbildung/Tagungsprogramm_Arch%C3%A 4ologie%20in%20%C3%96sterreich%201938-1945.pdf https://www.museum- joan- neum.at/fileadmin//user_upload/Archaologiemuseum/Veranstaltungen/2015/Archa eologie_Oesterreich_1938_bis_1945/Tagung_Abstractbook [alle 2016-07-17; so auch für alle folgenden]. -

Alpen Und Donau-Reichsgaue
leensuVonatkKeikhIgaue Das Gesetz vom 14. April 1939, R. G.Bl. 1 S. 777, führt als neue Verwaltungseinheit die Reichsgaue ein, an deren spitze die Reichsstatthalter stehen. Die Reichsgaue, die vorläufig nur in der Ostmark, 1m Sudeten- rebiet und den neu angegliederten Gebieten im Osten des Reiches bestehen, stellen die Verwirklichung des Grundsatzes von der Einheit in der Verwaltung dar, wodurch eine straffe Verwaltungsführung am besten gewährleistet ist. Sie sind auch die Verkörperung der Einheit von Partei und staat, da sie mit den Gauen der NSDAR territorial übereinstimmen und der Reichsstatthalter zugleich auch Gauleiter ist. Mit der Bildung der Reichsgaue fiel das Land Osterteich mit seiner Landesregierung endgültig weg- Aus der Ostmark wurden sieben Reichsgaue gebildet: Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier- mark und Tirol. Vorarlberg ist kein Reichsgau, bildet aber einen besonderen Verwaltungsbezirk und wird zusammen mit dem ReichsgauTirol verwaltet-. Jeder Reichsgau ist zugleich staatlicher Verwaltungsbezirk und selbstverwaltungsliorpeix Der an der Spitze stehende Reichsstatthalter führt nach fachlichen Weisungen der Reichsminister die staatliche Verwaltung und unter Aufsicht des Reichsmjnisters des lnnern die Selbstverwaltung in seinem Reichsgau; sein allgemeiner Vertreter in der staatlichen Verwaltung ist der Regierungspråisident, in der selbstverwaltung der Gauhauptmann. Der Reichsstatthalter ist jedoch nicht nur Beherdenleiter seiner eigenen Behörde, sondern auch Chef der ein- und angegliederten Sonder- verwaltungen und hat auch ein Informatious-, Initiativ- und Anweisungsrecht gegenüber den anderen nicht angeglie- derten Sonderverwaltungen und gegenüber allen öffentlich-rechtlichen Korporsehaften in seinem Reichsgau. Die Behörde des Itcichsstatthalters gliedert sieh in den Reichsgauen (mit Ausnahme von Wien) wie folgt: l. Abteilung für allgemeine und innere Verwaltung; Il. Abteilung für Erziehung, -Volksbild1mg, Kultur-— und Gemeinschaftspflegez Ill. -

Salzburg NSDAP, Staatliche Verwaltung
Die NSDAP.-Ga1llleitung Salzburg Sit-z der Gauieitung: Saizbiirg, Chiemseehof, Rut 20 13, 10 14._ 5 Kreise, 124 Ort-sgruppen. Gauleiter: Dr.. Friedrich Rainer. Stellvertretender Gauleiter: Ing. Anton W in t e r s t e g e r. Gauiimter; Ortsgruppen: _ . Gauorganisationsleiti'ing: Karl F e B m a n n. Kreis 1 Bischoishoien (22 Ortsgruppen); Gaugeschflftsfiihrung: Karl F e B m a n n. 'Altenmarkt, Badgastein, Bischofshofen, Dorfgastein, ' Gaupersomiiamt: Josef A u e r. , Dorfwerfen, Eben, Filzmoos, Flachau, Goidegg, GroBarl, Gauschulungsamt: Karl. S p ri n g e n s c h mid. Hofgastein, Hiittau, Markt Pongau, Mtihlbach, Niedern- fritz, Radstadt, Schwarzach, St. Martin, St. Veit, Tenneck, Gaupropagandzamt: Ing. Artur S a1 c h e r. Wagrain, Werfen. Gaupresseamt: Dr. Gustav Adolf P o g a. t s c h n i g g. Gauschatzamt: Ottokar B e s l. ' Kreis 2 Hallein (15 Ortsgruppen). Ga-uinspektion: Friedrich K a l t, n e r. Abtenau, Adnet, Annaberg, Dilrrnberg, Golling, Hailein- Amt fiir Volksgesundheit: Dr. Adolf S a m i t z. Ost, Hallein-West, Kolornan, Krispl, Kuchl, Oberaim, 'Puch, RuBbach, Scheffau, Vigaun. Amt fiir Rassenpolitik: Karl F i a l a. Deutsche Arbeitsfront: Anton R e s c h. - Kreis 3 Salzburg (49 Ortsgruppen). Amt fiir Agrarpolitik: Paul K r e n n w a.l 1n e r. Stadt-Ortsgruppen: Aigen-Eisbethen (Aigen-Abfalter Gauamt. fiir Erzieher: Karl S p ri n g e n s c h mid. Nr. 65), Altstadt (Griesgasse 29), AuBerer Stein (Imberg- Gaurechtsamt: Dr. Fritz B e r n h o l d. -

Albert Lichtblau „Arisierungen“, Beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen Und Entschädigungen in Salzburg Veröffentlichungen Der Österreichischen Historikerkommission
Albert Lichtblau „Arisierungen“, beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen und Entschädigungen in Salzburg Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Herausgegeben von Clemens Jabloner, Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, Georg Graf, Robert Knight, Lorenz Mikoletzky, Bertrand Perz, Roman Sandgruber, Karl Stuhlpfarrer und Alice Teichova Band 17/2 Band 17 „Arisierungen“, beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen und Entschädigungen Zweiter Teil (= Band 17/2) Albert Lichtblau: „Arisierungen“, beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen und Entschädigungen in Salzburg Oldenbourg Verlag Wien München 2004 Albert Lichtblau „Arisierungen“, beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen und Entschädigungen in Salzburg Oldenbourg Verlag Wien München 2004 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. © 2004. R. Oldenbourg Verlag Ges. m. b. H., Wien. Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in EDV-Anlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Satz: Laudenbach, 1070 Wien Druck: WB-Druck, D-87669 Rieden/Allgäu Wissenschaftliche Redaktion: Mag. Eva Blimlinger Lektorat: Astrid Früh Umschlaggestaltung: Christina Brandauer ISBN 3-7029-0522-7 R. Oldenbourg Verlag Wien ISBN 3-486-56780-2 Oldenbourg Wissenschaftsverlag München Inhaltsverzeichnis 1. Danksagung . 9 2. Quellenlage . 11 3. Methoden . 15 4. Zum Aufbau des Berichtes . 17 5. Das Kippen der Gesellschaft . 18 6. Die „Arisierungen“ in Salzburg . 21 7. Die „Arisierung“ von Firmen und Geschäften . 28 7.1. „Arisierung“ durch Verkauf . 31 7.1.1. -

(2015) Kurt Drexel
252 Rezensionen Kurt Drexel: Klingendes Bekenntnis zu Führer und Reich. Musik und Identität im Reichsgau Tirol- Vorarlberg 1938–1945. Innsbruck, Wagner, 2014, 325 S., zahlr. Abb. Die immensen Bemühungen des nationalsozialistischen Regimes, kulturelle Aktivitäten, Identitäten und Leitbilder ideologiegemäß zu indoktrinieren und zu steuern, sind – trotz vieler, teils aber relativ verstreuter Schriften unterschiedlichster Provenienz – bis heute keineswegs vollständig aufgearbei- tet. Während in Bezug auf einzelne (NS-)Institutionen wie etwa die Reichskulturkammer oder auch hinsichtlich der damals tätigen Komponisten und Musiker durchaus umfassende Gesamtdarstellun- gen existieren,1 fehlt es bislang vor allem an Überblicken zur Infiltration und Neudefinition des Kulturschaffens und -lebens in den ehemaligen Alpen- und Donau-Reichsgauen (Tirol-Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberdonau, Niederdonau, Wien). Die Schwierigkeit einer möglichst lückenlosen Aufarbeitung etwa im Bereich der Musik liegt nicht zuletzt im Konglomerat der vielen verschiedenen nationalsozialistischen Institutionen begründet, die sich, teils einander in ihren Kom- petenzen überschneidend, mit dem Musikleben, nicht zuletzt auch im Bereich der Ausbildung und ideologiekonformer Forschung, beschäftigten (Hitlerjugend, NS-Lehrerbund, Landesbauernschaft, Gauausschüsse für das Volkslied, SS-Ahnenerbe etc.). So ist das große Verdienst des vorliegenden Buches zunächst darin zu sehen, dass es erstmals eine Gesamtdarstellung des Musiklebens eines ehemaligen Reichsgaues (Tirol-Vorarlberg) präsen- tiert. Autor Kurt Drexel, der sich bereits im Rahmen seiner Dissertation2 sowie in zahlreichen Auf- sätzen3 mit dem Thema „Musik und Nationalsozialismus“ auseinandergesetzt und gemeinsam mit Kollegin Monika Fink eine umfassende Musikgeschichte Tirols herausgebracht hat,4 stützt sich für sein vorliegendes Buch auf ein reiches Fundament an Literatur nach 1945,5 das im Verbund mit 1 U.a. Joseph Wulf (Hg.): Kultur im Dritten Reich, 5 Bde. -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Der Nationalsozialismus im Pinzgau (Land Salzburg) 1930 bis 1945 – Widerstand und Verfolgung. Diktatur in der Provinz.“ Verfasser Mag. Rudolf LEO angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: Hon. Prof. Univ.-Doz. Dr. Brigitte Bailer 1 DER PINZGAU (Land Salzburg) Grafik: Sarah LEO 2 "Seine Wurzeln versteht nur, wer sich mit der Generation befasst, die uns erzogen hat…" [Anton Innauer] Meinen Eltern, Kreszenzia [geb. Niederegger] und Johann Leo gewidmet. 3 Kurzzusammenfassung Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Nationalsozialismus zwischen 1930 und 1945 im Pinzgau (Land Salzburg). Der Pinzgau, der größte Gau im Land Salzburg, umfasst 28 Gemeinden und hat rund 83.000 EinwohnerInnen auf einer Fläche von 2.641,35 km². Besonderes Augenmerk wird auf das Schicksal der Opfer während des dunkelsten Kapitels im 20. Jahrhundert gelegt. Wie im gesamten "Deutschen Reich" werden auch in den Salzburger Tälern Menschen wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihrer "rassischen" Herkunft verfolgt, inhaftiert und vernichtet. Das Schicksal dieser Menschen – ob Sozialdemokraten, Kommunisten, Christlichsoziale, Kritiker, Deserteure, Priester, Juden, Zwangsarbeiter oder "Zigeuner" – steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Frei nach Immanuel Kant: "…tot ist nur, wer vergessen wird." Darüberhinaus wird versucht, mittels bisher unveröffentlichter Dokumente den politischen Alltag in der Region während der sieben-jährigen NS-Herrschaft nachzuzeichnen. Jahre, geprägt von Angst, Hunger, Misstrauen, Denunziation und Spitzeltum. Im Mai 1945 wird der Pinzgau von amerikanischen Soldaten befreit. Die letzten Tage im Pinzgau gestalten sich dramatisch, da zahlreiche hochrangige NS-Funktionäre in den Tälern für sich und ihre Raubgüter Schutz und Zuflucht suchen. -

S.001-012 Titelei NS-Gaue.Indd
5 Inhalt Vorwort der Herausgeber. 7 1. Grundfragen......................................... 13 Thomas Schaarschmidt Regionalität im Nationalsozialismus – Kategorien, Begriffe, Forschungsstand . ...................................... 13 Jürgen John Die Gaue im NS-System.................................. 22 Rüdiger Hachtmann „Neue Staatlichkeit“ – Überlegungen zu einer systematischen Theorie des NS-Herrschaftssystems und ihrer Anwendung auf die mittlere Ebene der Gaue ................................. 56 Bernhard Gotto Dem Gauleiter entgegen arbeiten? Überlegungen zur Reichweite eines Deutungsmusters .................................. 80 Michael Ruck Kommentar: Strukturelle Grundfragen ....................... 100 2. Politikfelder . 105 2.1 Rassenpolitik und „Euthanasie“ ........................ 105 Ingo Haar Biopolitische Differenzkonstruktionen als bevölkerungspolitisches Ordnungsinstrument in den Ostgauen: Raum- und Bevölkerungs- planung im Spannungsfeld zwischen regionaler Verankerung und zentralstaatlichem Planungsanspruch........................ 105 Winfried Süß Zur Rolle der Gaue in der regionalisierten „Euthanasie” (1942–1945) 123 Susanne Heim Kommentar: Regionalpotentaten oder Akteure auf Reichsebene?. 136 2.2 Wissenschaft, Bildung, Kultur.......................... 141 Martina Steber Fragiles Gleichgewicht. Die Kulturarbeit der Gaue zwischen Regionalismus und Zentralismus ........................... 141 Jürgen Finger Gaue und Länder als Akteure der nationalsozialistischen Schulpolitik. Württemberg als Sonderfall und Musterbeispiel -

Die Stadt Salzburg 1942 Zeitungsdokumentation Pdf, 3 MB
Die Stadt Salzburg im Jahr 1942 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1942 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Volksblatt: SVB (erscheint bis 14. November) Salzburger Landeszeitung: SLZ (erscheint bis 14. November) Salzburger Zeitung: SZ (erscheint ab 16. November) Verweise auf die im Stadtarchiv Salzburg befindliche und von Gernod Fuchs transkribierte zeitgenössische „Chronik der Gauhauptstadt Salzburg 1940–1945“ von Thomas Mayrhofer: CGS 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1942 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Dezember 1941 (Nachtrag) 20.–21.12.1941 Reichsstraßensammlung. Bei der 4. Reichsstraßensammlung für das III. Kriegs-WHW sammeln HJ und BdM. Als Spender-Abzeichen werden Holzkreisel verteilt. Die HJ veranstaltet eine öffentliche Hasenversteigerung. Die Feuerwehr-HJ zeigt am Mirabellplatz einen Probeeinsatz mit dem Löschzug. Das Ergebnis – um 40 Prozent mehr, als bei der gleichen Sammlung des Vorjahres, – war im Reichsgau Salzburg RM 163.927,72 (65,1 Pfg. je Kopf), davon im Kreis Salzburg RM 91.570,78 (74 Pfg. je Kopf). SLZ, 5.1.1942, S. 3. SVB, 5.1.1942, S. 4. CGS, 1941, S. 45. 27.12.1941 Gaukriegerführung spendet Bilder. Die von der Gaukriegerführung „Alpenland“ (Generalmajor Hornung) für das Kriegsschiff „Salzburg“ gespendeten drei Stiche mit Ansichten der Stadt Salzburg, werden „in einem deutschen Hafen“ durch den stellvertretenden Stabsführer der Gaukriegerführung Dragoni, in Beisein des aus Salzburg stammenden Korvettenkapitäns Lepuschitz übergeben. Die Bilder werden in der Offiziersmesse des Schiffes aufgehängt. SLZ, 8.1.1942, S. 4. SVB, 8.1.1942, S. 4. CGS, 1942, S. 1f. 29.12.1941 Jahresabschlussappell NSDAP Gnigl. Die NSDAP-Ortsgruppe Gnigl tritt im Gasthaus Rangierbahnhof zum Jahresabschluss-Appell der Politischen Leiter zusammen. -

Volksmusik in Der NS-Zeit Und Danach
Kultur.verbände Seite 94 Volksmusik in der NS-Zeit und danach Ein Workshop zum aktuellen Umgang mit der (musikalischen) Vergangenheit, Grödig, 17.1.2015: Kurznachlese TEXT: Wolfgang Dreier-Andres Volksmusiksammlung und -pflege vor, während und nach der NS-Zeit (Wolfgang Damit sich interessierte Musikerinnen und Mu- Dreier-Andres) siker und Lehrende nicht von Grund auf und ohne Start- Die intensive Sammlung von Volkslied und Volks- hilfe in das Thema einlesen müssen, startete das Musi - musik im 19. Jahrhundert mündete schließlich 1904 kum in Zusammenarbeit mit Salzburger Musikverein und ins monarchieübergreifende Österreichische Volkslied- Salzburger Volksliedwerk eine Initiative für Lehrende, in unternehmen. Dessen erklärtes Ziel war eine „Gesamt- der die komplexen und vielschichtigen Ursachen, Zusam- ausgabe“ der österreichischen Volksmusik, der man seit menhänge und Wechselwirkungen didaktisch aufbereitet 1908 auch in Salzburg in einem eigens dafür gebildeten und von verschiedenen Seiten beleuchtet wurden. „Arbeitsausschuss“ zuarbeitete. Mit Unterbrechungen sammelte man bis Ende der 1920er-Jahre sehr intensiv. Die Musikwissenschaftler Thomas Nußbaumer, In den 1930er-Jahren wandelten sich die Interessen – die Thomas Hochradner (beide Universität Mozarteum), Pflege der bereits gesammelten Lieder trat in den Vor- Wolfgang Dreier-Andres (Archivleiter Salzburger Volks- dergrund, „offene Singen“, „Volkslieder-Wettsingen“ liedwerk) und der Germanist und Tobi Reiser-Kenner und ähnliche Veranstaltungen boomten. Diese „Pflege“ Karl Müller (Universität -
Prawno-Organizacyjne Aspekty Wcielania Do III Rzeszy Sudetenlandu I Austrii
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Bartosz Nieścior Prawno-organizacyjne aspekty wcielania do III Rzeszy Sudetenlandu i Austrii rozprawa doktorska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Wąsowicza Warszawa 2020 Spis treści Wstęp……………………………………………………………………………………… …5 Rozdział I. Charakterystyka systemu prawno-ustrojowego III Rzeszy ............................ 15 1.1.Koncepcja państwa idealnego, rodzaje i hierarchia źródeł prawa w państwie hitlerowskim ...... 15 1.2. Proces ustawodawczy w III Rzeszy ........................................................................................... 26 1.3. Administracja publiczna III Rzeszy ........................................................................................... 29 1.3.1. Administracja centralna hitlerowskich Niemiec – geneza i ewolucja ................................. 30 1.3.2. Administracja terenowa III Rzeszy ..................................................................................... 37 Podsumowanie................................................................................................................................... 41 Rozdział II. Struktura prawno-ustrojowa III Rzeszy na wcielonym terytorium Austrii 43 2.1.Historyczny przypadek tworzenia Mustergau – aneksja Alzacji i Lotaryngii do Rzeszy Niemieckiej ....................................................................................................................................... 43 2.2.Sytuacja ustrojowo-prawna Austrii w latach 1918-1939 ...........................................................