01 Hofgartenarkaden.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
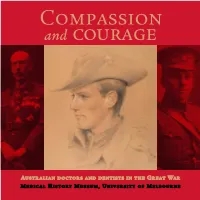
Compassion and Courage
Compassion and courage Australian doctors and dentists in the Great War Medical History Museum, University of Melbourne War has long brought about great change and discovery in medicine and dentistry, due mainly to necessity and the urgency and severity of the injuries, disease and other hardships confronting patients and practitioners. Much of this innovation has taken place in the field, in makeshift hospitals, under conditions of poor Compassion hygiene and with inadequate equipment and supplies. During World War I, servicemen lived in appalling conditions in the trenches and were and subjected to the effects of horrific new weapons courage such as mustard gas. Doctors and dentists fought a courageous battle against the havoc caused by AUSTRALIAN DOCTORS AND DENTISTS war wounds, poor sanitation and disease. IN THE REAT AR Compassion and courage: Australian doctors G W and dentists in the Great War explores the physical injury, disease, chemical warfare and psychological trauma of World War I, the personnel involved and the resulting medical and dental breakthroughs. The book and exhibition draw upon the museums, archives and library of the University of Melbourne, as well as public and private collections in Australia and internationally, Edited by and bring together the research of historians, doctors, dentists, curators and other experts. Jacqueline Healy Front cover (left to right): Lafayette-Sarony, Sir James Barrett, 1919; cat. 247: Yvonne Rosetti, Captain Arthur Poole Lawrence, 1919; cat. 43: [Algernon] Darge, Dr Gordon Clunes McKay Mathison, 1914. Medical History Museum Back cover: cat. 19: Memorial plaque for Captain Melville Rule Hughes, 1922. University of Melbourne Inside front cover: cat. -

Materializing the Military
MATERIALIZING THE MILITARY Edited by Bernard Finn Barton C Hacker Smithsonian Institution, Washington DC Associate Editors Robert Bud Science Museum, London Helmuth Trischler Deutsches Museum, Munich . sCience museum Published 2005 by NMSI Trading Ltd, Science Museum, Exhibition Road, London SW7 2DD All rights reserved © 2005 Board ofTrustees of the Science Museum, except for contributions from employees of US national museums Designed by Jerry Fowler Printed in England by the Cromwell Press ISBN 1 90074760 X ISSN 1029-3353 Website http://www.nmsi.ac.uk Artefacts series: studies in the history of science and technology In growing numbers, historians are using technological artefacts in the study and interpretation of the recent past. Their work is still largely pioneering, as they investigate approaches and modes of presentation. But the consequences are already richly rewarding. To encourage this enterprise, three of the world's greatest repositories of the material heritage of science and technology: the Deutsches Museum, the Science Museum and the Smithsonian Institution, are collaborating on this book series. Each volume treats a particular subject area, using objects to explore a wide range of issues related to science, technology and medicine and their place in society. Edited by Robert Bud, Science Museum, London Bernard Finn, Smithsonian Institution, Washington DC Helmuth Trischler, Deutsches Museum, Munich Volume 1 Manifesting Medicine Principal Editor Robert Bud Volume 2 Exposing Electronics Principal Editor Bernard Finn Volume 3 Tackling Transport Principal Editors Helmuth Trischler and Stefan Zeilinger Volume 4 Presenting Pictures Principal Editor Bernard Finn Volume 5 Materializing the Military Principal Editors Bernard Finn and Barton C Hacker Volume. -

EINSICHTEN PERSPEKTIVEN Bayerische Zeitschrift Für Politik Und Geschichte
EINSICHTEN PERSPEKTIVEN Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte 4 17 Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, Autorinnen und Autoren dieses Heftes eigentlich war es geplant, mit dem letzten Beitrag der „Einsichten- Jan Dinter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und-Perspektiven“-Serie zur Bundestagswahl 2017 ein Resümee zu im Projekt „Kommunikationsstress im Ruhrge- ziehen und im besten Fall das neue Bundeskabinett vorzustellen. Doch biet. Die Gesprächsstörung zwischen Politikern, bis zum Redaktionsschluss am 1. Dezember 2017 war noch keine trag- Bürgern und Journalisten“ an der NRW School fähige Regierungskonstellation absehbar – was einige Beobachter im of Governance (Universität Duisburg-Essen). Hinblick auf die 18 Vorgängerwahlen zum bundesdeutschen Parla- ment bereits jetzt als Zäsur interpretieren. Bleibt abzuwarten, ob wir Prof. Dr. Klaus Gestwa ist Lehrstuhlinhaber im im März 2018 erscheinenden Heft über Neuwahlen oder ein doch und Direktor des Instituts für Osteuropäische noch zustande gekommenes Kabinett berichten werden. Geschichte und Landeskunde an der Univer- sität Tübingen. Um weitere historische Zäsuren geht es auch bei den folgenden Bei- trägen von Marita Krauss, die kurz vor dem Gedenkjahr 2017 erzählt, Stefan Haußner, M.A., ist wissenschaftlicher warum Bayern vor 1913/1914 ein anderes Land als nach dem Ende Mitarbeiter am Jean-Monnet-Lehrstuhl für der Monarchie 1918 war, und von Klaus Gestwa, der im vorletzten Europäische Integration und Europapolitik Teil der Serie über den Russischen Revolutionszyklus die turbulenten der Universität Duisburg-Essen. Ereignisse des Revolutionsjahres 1917 schildert und die Hauptakteure des Umsturzes vorstellt. Oliver Heiss ist Architekt und Stadtplaner sowie Geschäftsführer Aus-, Fort- und Wei- Oliver Heiss berichtet von einem Aufenthalt in dem bürgerkriegsge- terbildung der Bayerischen Architektenkam- schüttelten Land Mali und Ansgar Reiß lädt schließlich zu einer inter- mer in München. -

André Butzer
ANDRÉ BUTZER André Butzer is one of Germany’s most relevant contemporary artists who founded the Akademie Isotrop in Hamburg. Butzer continues to have frequent international coverage in arts publications with over 290 worldwide exhibitions including prestigious institutions such as MUMOK, the Kunsthalle Nuernberg, and works in the collections of MOCA Los Angeles, LACMA, Sammlung Goetz and the Scharpff Collection, amongst many others. A self proclaimed "colorist", Butzer's body of work has progressed from chromatically-intense large scale figurative paintings rife with pop-culture references, to seemingly "minimalist" black and white abstract paintings, all of which allude to "NASAHIEM", Butzer's created non-imaginable, non-picture-able space from which all his paintings begin in and move towards. Born in 1973 in Stuttgart, Germany Lives and works in Altadena, California Education 2001 Bjoern Dahlem, Gründung Institut für SDI-Traumforschung, Berlin 1996-2000 Akademie Isotrop, Hamburg Solo Exhibition (selected) 2020 Carbon 12, Dubai Museum of the Light / Yoshii Foundation, Hokuto “Light, Colour and Hope”, YUZ Museum, Shanghai Galerie Max Hetzler, Paris Galerie Max Hetzler, Berlin 2019 Museum of the Light at Yoshii Foundation, Hokuto Galerie Bernd Kugler, Innsbruck Kirchgasse, Steckborn Boers-Li Gallery, Beijing Galerie Hammelehle und Ahrens, Cologne Goethe komischer Mann Nino Mier Gallery, Los Angeles Filsers, Mainburg Galerie Christine Mayer, Munich Metro Pictures, New York 2018 “Auf Wiedersehen In Kopenhagen – A Soloshow On Planet Earth”, -
MUSEEN Inhaltsverzeichnis Index
ingolstadt interessant & einzigartig MUSEEN Inhaltsverzeichnis Index 4 Audi museum mobile Audi museum mobile 6 Deutsches Medizinhistorisches Museum German Museum of the History of Medicine 8 Bayerisches Armeemuseum Bavarian Army Museum 10 Reduit Tilly (Abteilung 1. Weltkrieg) Reduit Tilly (First World War section) 12 Museum für Konkrete Kunst Museum of Concrete Art 14 Lechner Museum Lechner Museum 16 Asamkirche Maria de Victoria Asam’s Maria de Victoria Church 18 Stadtmuseum City Museum 20 Spielzeugmuseum Toy Museum 21 Europäisches Donaumuseum European Danube Museum 22 Fleißer Dokumentationsstätte Fleisser Documentation Site 24 Bauerngerätemuseum Farmers’ Equipment Museum 25 Heimatmuseum Niemes-Prachatitz Niemes-Prachatitz Museum of Local History 26 Schulmuseum School Museum 27 Astronomiepark Astronomy Park 28 Lageplan der Museen Museum Site Plan Willkommen Welcome Willkommen zur Museumstour! Ingolstadt beherbergt ein breites Spektrum außergewöhnlicher Museen, die nur darauf warten von Ihnen erkundet zu werden. Streifen Sie durch faszinierende Sammlungen, atmen Sie den Geist der Geschichte, erforschen Sie die Facetten moderner Kunst. Die reizvolle und bunte Mischung verschiedener Themenbereiche lässt einen Besuch der Museumslandschaft zu einem informativen wie spannenden Kulturerlebnis werden. Ingolstadts Museen stecken voller Überraschungen – überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie! Welcome to the museum tour! Ingolstadt is home to a wide range of extraordinary museums awaiting your discovery. Amble among the captivating collections, breathe the spirit of history and explore the many facets of modern art. A charming and varied mix of different themes makes each visit to the museum ecosystem an informative and entertaining cultural experience. Ingolstadt’s museums are chock-full of surprises. But don’t take our word for it, see for yourself. -

Schriftliche Anfrage
18. Wahlperiode 09.08.2019 Drucksache 18/2631 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Barbara Fuchs, Claudia Köhler, Susanne Kurz, Tim Pargent, Katharina Schulze BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 02.05.2019 Finanzierung und Konzept – Museum der Bayerischen Geschichte in Regens- burg 2 Wir fragen die Staatsregierung: 1. a) Mit welchem konzeptionellen Ansatz bzw. fachwissenschaftlich-didaktischen Im- petus findet die Darstellung der politischen Auseinandersetzung zwischen baye- rischer Bevölkerung und Regierung in Wackersdorf in den 1980er-Jahren Ein- gang in das Museum? b) Wie werden sich Dr. Petra Loibls Ausführungen im Ausschuss am 26.04.2017, dass Wackersdorf „im Rahmen einer Inszenierung ebenfalls die ihm gebührende Würdigung erfahren“ soll, konkret in der Ausstellung darstellen? c) Werden die dem Museum der Bayerischen Geschichte (MdBG) laut Dr. Petra Loibl angebotenen Banner und Fahnen zum Protest in Wackersdorf Eingang in die Ausstellung finden? 2. a) Nachdem laut Bericht des Donaukuriers vom 25.04.2019 die Besucherinnen und Besucher auf der alten Bestuhlung des Landtages Platz nehmen und über Themen wie die Kruzifix- und die Nichtraucherschutzdebatte abstimmen dürfen, werden nun die in der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst vom 26.04.2017 von Dr. Petra Loibl als für die Debatte vorgegebenen Themen „Grundgesetz“ und „Wackersdorf“ nicht mehr diskutiert werden? b) Wie sieht die Kooperation des Bayerischen Rundfunks (BR) – einschließlich des Fernsehens – mit dem Museum der Bayerischen Geschichte konkret aus? 3. a) Wie viele Ausstellungsstücke sind beim Museum der Bayerischen Geschichte bis heute eingegangen? b) Wie viele der eingegangenen Ausstellungsstücke haben Eingang in die Ausstel- lung gefunden? c) Welche Ausstellungsstücke werden nicht gezeigt? 4. -

Jahresbericht
2013–2014 JAHRESBERICHT BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN JAHRESBERICHT 2013–2014 JAHRESBERICHT 2013–2014 Inhalt Vorwort ........................................................................................... 7 01 EREIGNISSE ................................................................................ 13 Neues Licht in der Alten Pinakothek – energetische Sanierung 2014–2018 ............ 14 Die Barockgalerie in der Staatsgalerie Bamberg .......................................... 16 Fotografi e in der Neuen Pinakothek: Sammlung Dietmar Siegert ....................... 17 Die »Schaustelle« – temporäre Plattform der Pinakothek der Moderne ............... 18 Erwerb eines Konvoluts von Fotografi en August Sanders ................................ 21 Erweiterung des Fachaustausches mit Museen in China (2014–2016) .................. 22 02 ERWERBUNGEN ........................................................................... 23 03 AUSSTELLUNGEN ......................................................................... 31 Rückblick ....................................................................................... 32 Ausstellungen 2013 ........................................................................... 41 Ausstellungen 2014 ........................................................................... 45 04 PUBLIKATIONEN ........................................................................... 51 05 BERICHTE DER ABTEILUNGEN ........................................................... 55 Doerner Institut ............................................................................... -

1918-1923 Bayern
1923 - 1918 Kriegsende, Revolution und Räterepublik, die Ermordung Kurt Eisners, der Bürgerkrieg um München und die Putschversuche gegen die junge Demokratie: 1918-1923 war Bayern ein Brennpunkt der deutschen Geschichte. Die Ausstellung im Bayerischen Armeemuseum dokumentiert mit einer Fülle von Objekten, AYERN Fotografien und Zeugnissen die Geschichte der Gewalt in den Jahren nach dem Krieg. Dahinter steht die bren- B nende Frage, wie nach dem verlorenen Krieg ein wirklicher Frieden nach außen und innen zu gewinnen war. FRIEDENSBEGINN ISBN 978-3-8062-3900-3 9 783806 239003 Friedensbeginn? Bayern 1918-1923 Friedensbeginn? Bayern 1918-1923 Herausgegeben von Dieter Storz und Frank Wernitz Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Band 18 Herausgegeben von Ansgar Reiß Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Bayerischen Armeemuseums und des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. wbgTHEISS ist ein Imprint der wbg. © 2018 by Bayerisches Armeemuseum, Paradeplatz 4, 85049 Ingolstadt und wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht. Umschlag: Die Umschlagabbildung basiert auf einer Fotografie -

Überfall Auf Die Sowjetunion Das Unternehmen »Barbarossa« 1941
Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Heft 1/2021 Kriegsgeburt Unterschätzte Rivalin »Braune Nostalgie«? Die Reichsgründung 1871 Die Entstehung der Bundeswehr-Skandale in den Royal Australian Navy 1970er Jahren Überfall auf die Sowjetunion Das Unternehmen »Barbarossa« 1941 ZMSBw Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Zeitschrift Militärgeschichte im Wandel 1987 1987 Heft 1/1991 Heft 2/1996 Heft 1/1999 Heft 1/2001 Heft 1/2002 Heft 3/2002 Heft 4/2004 Heft 1-2/2005 Heft 2/2006 Heft 2/2007 Heft 4/2011 Heft 1/2013 Heft 2/2018 Heft 4/2020 Heft 1/2021 EDITORIAL wie Ihnen vermutlich bereits beim ersten Blick auf die neue Ausgabe auf- gefallen sein wird, hat die Militärgeschichte ihr Gesicht gewandelt. Um die Zeitschrift für Sie noch abwechslungsreicher und interessanter zu gestalten, haben wir uns als Herausgeber und Redaktion dazu entschieden, der Militär- geschichte einen neuen Farbanstrich zu geben. Das Heft stellt sich nun fri- scher und moderner dar. Unser Fachbereich Publikationen unter der Leitung von Christian Adam hat diesen Prozess von der Auswahl potenzieller Grafik- büros bis hin zur professionellen Umsetzung des Layouts durch die Medien- gestalterinnen im ZMSBw begleitet. Mein besonderer Dank für den Entwurf des neuen Layouts gilt Anke Mitrenga, plettenberg design Berlin. Sie hat uns von den ersten Ideen bis zur Umsetzung ihres Gestaltungsrasters in diesem Heft kompetent unterstützt. Die Neuerungen beschränken sich allerdings nicht allein auf die optische Gestaltung. Es war unser Ziel, die Militärgeschichte auch inhaltlich weiter zu entwickeln. Der Darstellung einzelner Themen im Heft wollen wir mehr Raum geben: Die Rubrik »Im Blickpunkt« bietet künftig in einer Art »Fak- tencheck« zentrale Hintergrundinformationen zu einem wichtigen themati- schen Aspekt des Heftes. -

Helmbarte Bayern.Pdf
e^i_boa== South Germany, 17th Century. Overall length: 241 cm. Length of head without langets: 62 cm. Maximum width: 27,5 cm. Large axe head and blade of hollow diamond section decorated with etchings against a blackened ground in typical 17th century style, depicting foliate scrollwork and the electoral coat of arms of Bavaria, the latter against a fire gilt ground, and a later etched dating 1762 with the inscription MICHIB (Maximilian III Ioseph Churfürst Herzog in Bayern); weapon number 11 on the base, wooden haft preserved in full length with ferrule; head attached to the pole by its four langets with brass covered nails . This halberd was commissioned by Elector Ferdinand Maria of Bavaria (1636 – 1679), called the piece - loving, for his life guard. He became elector in 1651 only shortly after the thirty years war (1618-48). This conflict had devastated Bavaria like no other war had done before - and since then till our days! For the sake of his state Ferdinand Maria implemented a very intelligent policy, meaning on the one hand a strategy of neutrality against both France and the Holy Roman Empire let by the Hapsburg family. On the other hand, his economic policies were very successful which encompassed the consolidation of the courtly finances. 26 Against this background it becomes clear, why the original dating of this halberd had been replaced by the year 1762 and the inscription MICHIB added. Elector Maximilian III Joseph of Bavaria carried on with the politics of Ferdinand Maria, facing severe economic constraints. While a certain representation was indispensable for an Elector – that is the reason why the present halberd is so fine and elaborately decorated- he had to save money. -

The Original Kar. 98 . . . • a Little-Known German Military Arm
The Original Kar. 98 . • a little-known German Military arm By Heinz Lehner (GUN COLLECTORS DIGEST 4th edition) THE “GEWEHR 98,” a Mauser design adopted as a prototype by the German Army in April, 1898, is well known. Its adoption was preceded by two tests with rifles in calibers 8mm (Gewehr 88/97) and 6mm (Mauser). Production examples of the 29,000 Gewehre made by Mauser in Oberndorf from 1898 to 1907, from government Gewehrfabriken in Spandau, Danzig, Erfurt, Amberg, and during WWI manufactured by many private German arms companies, have survived in great numbers and can be seen in arms museums and private collections. On the other hand, early military Model 98 carbines are generally unknown. The reason is that only a small number was manufactured, from 1898-1905, and most of them went to the Kaiserliche Schutztruppe in Africa and the Deutsches Ostasiatische Expeditionskorps. When Germany lost World War I in 1918 those arms remained in Africa, and only a few have survived. The author was able to obtain his early Kar.98, marked ERFURT 1904, from a collector in South Africa. Several authors in the past have shown one or two samples of the short “Kar.98,” built in the beginning primarily for troop testing, with or without an Aufpflanzvorrichtung (attachment) for the Seitengewehr 98 (SG.98) bayonet; their attempts fell short of giving a complete list of all the variations. While in the U.S. publications the Kar,98 has been shown with a round-headed bolt, in German books these carbines are pictured with a flat bolt as is found with the German Kar.88. -

2018.11.07-Andre Butzer
ANDRÉ BUTTER André Butzer is one of Germany’s most relevant contemporary artists who founded the Akademie Isotrop in Hamburg. Butzer continues to have frequent international coverage in arts publications with over 290 worldwide exhibitions including prestigious institutions such as MUMOK, the Kunsthalle Nuernberg, and works in the collections of MOCA Los Angeles, LACMA, Sammlung Goetz and the Scharpff Collection, amongst many others. A self proclaimed "colorist", Butzer's body of work has progressed from chromatically-intense large scale figurative paintings rife with pop-culture references, to seemingly "minimalist" black and white abstract paintings, all of which allude to "NASAHIEM", Butzer's created non-imaginable, non-picture-able space from which all his paintings begin in and move towards. Born in 1973 in Stuttgart, Germany Lives and works in Altadena, California Education 2001 Bjoern Dahlem, Gründung Institut für SDI-Traumforschung, Berlin 1996-2000 Akademie Isotrop, Hamburg Solo Exhibition (selected) 2018 “Auf Wiedersehen In Kopenhagen – A Soloshow On Planet Earth”, Sunday-S, Copenhagen Heinrich Ehrhardt, Madrid “Recent Paintings and an Artist Book”, Galerie Max Hetzler, Berlin “Selected Works from Private Collections”, Galerie Max Hetzler, Berlin Gió Marconi, Milan IKOB Museum of Contemporary Art, Eupen Nino Mier Gallery, Cologne Museum of the Light, Yoshii Foundation, Hokuto 2017 Carbon 12, Dubai Kirchgasse, Steckborn Nino Mier Gallery, Los Angeles Xippas Gallery, Geneva Galerie Bernd Kugler, Innsbruck Galeria Mario Sequeira,