Wa(H)Re Forschung? Science – Change of Paradigms?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gesellschaft Und Psychiatrie in Österreich 1945 Bis Ca
1 VIRUS 2 3 VIRUS Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin 14 Schwerpunkt: Gesellschaft und Psychiatrie in Österreich 1945 bis ca. 1970 Herausgegeben von Eberhard Gabriel, Elisabeth Dietrich-Daum, Elisabeth Lobenwein und Carlos Watzka für den Verein für Sozialgeschichte der Medizin Leipziger Universitätsverlag 2016 4 Virus – Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin Die vom Verein für Sozialgeschichte der Medizin herausgegebene Zeitschrift versteht sich als Forum für wissenschaftliche Publikationen mit empirischem Gehalt auf dem Gebiet der Sozial- und Kulturgeschichte der Medizin, der Geschichte von Gesundheit und Krankheit sowie an- grenzender Gebiete, vornehmlich solcher mit räumlichem Bezug zur Republik Österreich, ihren Nachbarregionen sowie den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie. Zudem informiert sie über die Vereinstätigkeit. Die Zeitschrift wurde 1999 begründet und erscheint jährlich. Der Virus ist eine peer-reviewte Zeitschrift und steht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen Disziplinen offen. Einreichungen für Beiträge im engeren Sinn müssen bis 31. Okto- ber, solche für alle anderen Rubriken (Projektvorstellungen, Veranstaltungs- und Aus stel lungs- be richte, Rezensionen) bis 31. Dezember eines Jahres als elektronische Dateien in der Redak- tion einlangen, um für die Begutachtung und gegebenenfalls Publikation im darauf fol genden Jahr berücksichtigt werden zu können. Nähere Informationen zur Abfassung von Bei trägen sowie aktuelle Informationen über die Vereinsaktivitäten finden Sie auf der Homepage des Ver eins (www.sozialgeschichte-medizin.org). Gerne können Sie Ihre Anfragen per Mail an uns richten: [email protected] Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi - bli o grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. -

Prof. Gottfried Schatz
Katedry biochémie a genetiky PriF UK a občianske združenie NATURA Vás pozývajú na 100. prednášku v rámci Kuželových seminárov: Prof. Gottfried Schatz University of Basel, Switzerland From little science to Big Science ktorá sa uskutoční 13. marca 2015 (piatok) o 14:30 v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej Fakulte UK http://www.naturaoz.org/seminare.html http://www.naturaoz.org/KuzeloveSeminare.html *hostiteľ: proF. Jordan Kolarov, Katedra biochémie PriF UK Gottfried Schatz Former Head oF the Biozentrum and ProFessor emeritus oF Biochemistry at the University oF Basel, Switzerland Gottfried (JeFF) Schatz was born in 1936 and grew up in Graz, Austria. AFter receiving a PhD degree in Chemistry and Biochemistry From the University oF Graz in 1961, he did postdoctoral work in Vienna and New York and emigrated to the USA in 1968 where he accepted a proFessorship at Cornell University in Ithaca, N.Y. Six years later he moved to what was then the recently established Biozentrum oF the University oF Basel which he chaired From 1985 to 1987. From 1984 until 1989, ProFessor Schatz was Secretary General oF the European Molecular Biology Organization (EMBO). AFter receiving the emeritus status in 2000, he served as President oF the Swiss Science and Technology Council For Four years. Gottfried Schatz is the author oF more than two hundred publications and several books and For more than two decades played a leading role in elucidating the biogenesis oF mitochondria and was a co-discoverer of mitochondrial DNA. His achievements have been honoured with numerous prestigious national and international prizes and awards as well as membership oF several scientiFic academies along with two honorary doctorates including this From the Comenius University in Bratislava. -

Science & Policy Meeting Jennifer Lippincott-Schwartz Science in The
SUMMER 2014 ISSUE 27 encounters page 9 Science in the desert EMBO | EMBL Anniversary Science & Policy Meeting pageS 2 – 3 ANNIVERSARY TH page 8 Interview Jennifer E M B O 50 Lippincott-Schwartz H ©NI Membership expansion EMBO News New funding for senior postdoctoral In perspective Georgina Ferry’s enlarges its membership into evolution, researchers. EMBO Advanced Fellowships book tells the story of the growth and ecology and neurosciences on the offer an additional two years of financial expansion of EMBO since 1964. occasion of its 50th anniversary. support to former and current EMBO Fellows. PAGES 4 – 6 PAGE 11 PAGES 16 www.embo.org HIGHLIGHTS FROM THE EMBO|EMBL ANNIVERSARY SCIENCE AND POLICY MEETING transmissible cancer: the Tasmanian devil facial Science meets policy and politics tumour disease and the canine transmissible venereal tumour. After a ceremony to unveil the 2014 marks the 50th anniversary of EMBO, the 45th anniversary of the ScienceTree (see box), an oak tree planted in soil European Molecular Biology Conference (EMBC), the organization of obtained from countries throughout the European member states who fund EMBO, and the 40th anniversary of the European Union to symbolize the importance of European integration, representatives from the govern- Molecular Biology Laboratory (EMBL). EMBO, EMBC, and EMBL recently ments of France, Luxembourg, Malta, Spain combined their efforts to put together a joint event at the EMBL Advanced and Switzerland took part in a panel discussion Training Centre in Heidelberg, Germany, on 2 and 3 July 2014. The moderated by Marja Makarow, Vice President for Research of the Academy of Finland. -

CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Abstracts of the Oral Communications and Posters Presented During the Congress Anatomia Clinica
Surgical and Radiologic Anatomy (2019) 41:1227–1303 https://doi.org/10.1007/s00276-019-02334-4 ABSTRACT Abstracts of the oral communications and posters presented during the congress Anatomia Clinica Ó Springer-Verlag France SAS, part of Springer Nature 2019 123 1228 Surgical and Radiologic Anatomy (2019) 41:1227–1303 The international congress of Anatomia Clinica, held in Madrid 24th O-003 to 26th June 2019, has been a joint meeting of the European Asso- ciation of Clinical Anatomy (EACA) and the International Study preferences in anatomy education: perspective of Turkish Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA). The invited medical students societies were the Japanese Research Society of Clinical Anatomy (JRSCA), the Mexican Anatomical Society (SMA) and the Spanish Anatomical Society (SAE). Barut Cagatay, Karaer Ekremcan, Yavuz Melike It has been an important international meeting in the fields of clinical and applied anatomy, and translational research in anatomical Bahcesehir University, Istanbul, Turkey sciences. Introduction: Anatomy has been taught for centuries and many vari- On behalf of the President of the Congress, PR J. Sanudo, and ations occurred in anatomy education all around the world. Vice-President, PR T. Vasquez, we are happy to group and publish Researches mostly focused on what is the best teaching method for here the selected abstracts of the presented communications (grouped students, instead of what is the best studying method for them. Thus, by sessions) and posters. this study aims to identify the study preferences of Turkish medical F. Duparc (France) and M. Konschake (Austria), for the Scientific students in terms of study methods and sources. -

Judaica Olomucensia
Judaica Olomucensia 2016/2017 Special Issue Kurt Schubert, the Founder 1 – 2016/2017 Table of Content Judaica Olomucensia 2016/2017 Special Issue Kurt Schubert, the Founder This special issue is a last and final volume of biannual peer-reviewed journal Judaica Olomucensia. Editor-in-Chief Ingeborg Fiala-Fürst Editor Ivana Cahová, Matej Grochal ISSN 1805-9139 (Periodical) ISBN 978-80-244-5289-0 (Proceedings) Table of Content 5 Introduction Ingeborg Fiala-Fürst 6 The Jewish Community in Olomouc Reborn Josef Jařab 8 Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies Ivana Cahová – Ingeborg Fiala-Fürst 27 The Importance of Feeling Continuity Eva Schubert 30 Interreligious Dialogue as The Mainstay of Kurt Schubert’s Research Petrus Bsteh 33 Kurt and Ursula Schubert Elisheva Revel-Neher 38 The Jewish Museum as a Physical, Social and Ideal Space – a Jewish Space? Felicitas Heimann-Jelinek 47 The Kurt and Ursula Schubert Archive at the University of Vienna Sarah Hönigschnabel 52 The Institute for Jewish Studies in Vienna – From its Beginnings to The Presen Gerhard Langer 65 Between Jewish Tradition and Early Christian Art Katrin Kogman-Appel – Bernhard Dolna 4 – 2016/2017 Introduction Ingeborg Fiala-Fürst The anthology we present to the readers fulfills a dual function: the authors of the individual articles both recall Prof. Kurt Schubert (2017 marked the 10th anniversary of his death) and the institutions which were co-founded by Kurt Schubert and his wife, Ursula Schubert. This double function is reflected in the title of the anthology, "Kurt Schubert, the Founder". One of the youngest institutions that Kurt Schubert helped to found, the Center for Jewish Studies at the Faculty of Arts at Palacký University, is allowed the bear the Schuberts' name since 2008. -

CV Paul Maxime Nurse Date of Birth: 25 January 1949 Nationality: British Marital Status: Married, Two Children EDUCATION 1960
CV Paul Maxime Nurse Date of Birth: 25 January 1949 Nationality: British Marital Status: Married, two children EDUCATION 1960 - 1966 Harrow County Grammar School 1967 - 1970 University of Birmingham - BSc (First Class Honours) in Biological Sciences Awarded the John Humphreys Memorial Prize in Botany 1970 - 1973 University of East Anglia - PhD in Cell Biology/Biochemistry EMPLOYMENT 1967 Twyford Laboratories, London; Research Assistant in Microbiology Department 1973 Institute of Microbiology, University of Bern, Switzerland; Royal Society Research Fellow 1974 - 1980 Department of Zoology, University of Edinburgh; SERC Research Fellow with Professor J M Mitchison 1980 - 1984 School of Biology, University of Sussex; MRC Senior Research Fellow 1984 - 1987 Imperial Cancer Research Fund, London; Head of Cell Cycle Control Laboratory 1987 - 1991 University of Oxford, Iveagh Professor of Microbiology 1991 - 1993 University of Oxford, Napier Research Professor of the Royal Society 1993 - 1996 Imperial Cancer Research Fund, London, Director of Research (Laboratories) 1996 - 2002 Imperial Cancer Research Fund, London, Director-General 2002 - 2003 Cancer Research UK, Director-General (Science) (Feb-Mar 2002), Chief Executive (Mar-Apr 2003) 2003 - 2011 The Rockefeller University, New York, USA, President 2010 - 2015 The Royal Society, London, President 2010 - Francis Crick Institute, Director ACADEMIC DISTINCTIONS Major International Award Lectures and Medals 1990 Royal Society Florey Lecturer (UK) 1991 Cetus Lecturer, University of California, -

Tree 19.Indd
15th Annual Conference The Academia’s Letter from New members to 2003 at Graz future plans the President Academia Europaea page 2 page 8 page 12 page 21 Academia Europaea ~19 88~ TheTNewsletter of Academiaree Europaea • Issue 19 • March 2004 16th Annual Conference University of Helsinki, 2-4 September 2004 “Europe in Change” and give short papers to the assembly. We Session 3: will once again welcome newly elected The 2004 annual conference of the 1 Social and economic change and health members of the Academia. Academia Europaea, will bring together in Europe East and West. Michael eminent researchers from across all This year we will also have two “invited Marmot (London) disciplines. The meeting will encourage in papers” sessions, one on each day of the 1 Society and well-being Richard Layard open discussion of a range of key factors conference. (London) that have conspired together to shape the 1 Child development in Europe Michael Europe of today and may well contribute Main programme speakers Rutter (London) towards the Europe of tomorrow. include: 1 Psychological change through the life “Europe in Change” emphasises a fact of course. Paul Baltes (Berlin) our European heritage – that ‘Europe’ is Session1: Session 4: constantly evolving and in flux. Aspects 1 Glacial and interglacial climate 1 of change will be presented through four From analogue to digital – convergence variability: How do they compare? What multidisciplinary sessions: and divergence.Yrjö Neuvo (Helsinki) are the implications for the future? Jean- 1 Market driven energy supply with 1: The Shaping of Europe Claude Duplessy (Gif-sur-Yvette) growing shares of nuclear energy and 2: Turning points in European Culture 1 Patterns in biodiversity: past, present, and biomass Pekka Pirilä (Helsinki) 3: Is there a common European Society? future. -

SEPARATA Fritz Krinzinger
SEPARATA Fritz Krinzinger When the Greeks Went West, 0024 National Geographic, November 1994, 11-37 Östliche Randkulturen. Phryger, Lyder, Lykier: Grabhäuser und 0039 Nekropolen Säulen, Tempel und Pagoden, Kulturen im antiken Europa und in Asien, Kunst und Kultur, Band 2, 1997, 193-198 Vrienden van Sagalassos, Nieuwsbrief 2001 0065 Arkeolojik Gezi Rehberi Efes 0089 Kültür dizisi 3 Gutachterverfahren: Schutzdächer Hanghaus II in Ephesos, 0125 Türkei Fachjournal Wettbewerbe Heft 86/87, 1989, 87-93 Fundus Cocceianus, oder „wen gehörte die Villa von 0208 Bruckneudorf?“ Steine und Wege, Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag, ÖAI Sonderschriften Band 32, 1999, 397-401 Gli affreschi della catacomba di Karmuz presso Alessandria 0287 d’Egitto OCNUS, Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia, XI, 2003, 175-193 Festkolloquium anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. Peter 0364 Waldhäusl Geowissenschaftliche Mitteilungen, Heft Nr. 55, 2001 Montfort, Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwert 0390 Vorarlbergs, 49. Jg., 1997, Heft 3 Arche – Zeitschrift für Geschichte und Archäologie in OÖ 0395 Nr. 7, Dez. 1994 Blick in den Boden. Geophysikalische Prospektion der 0397 urzeitlichen, befestigten Siedlung „Burg“ in Schwarzenbach, Bucklige Welt Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG) und Interdiszi plinäre Einrichtung für Archäologie der Uni Wien (IDEA), 1996 Pro Austria Romana – Nachrichtenblatt für die 0405 Forschungsarbeit über die Römerzeit in Österreich, Jg. 47, 1997, Heft 3/4 „Lokale Identitäten in Randgebieten des Römischen Reiches“ 0408 (Abstracts) Int. Symposium 24.-26.4.2003, Wiener Neustadt Römische Grenzlinie in Europa. Teilabschnitt/Modul Limes- 0409 Österreich. Hinweise zu Arbeitsschritten und zum Arbeitsprogramm für die UNESCO-Weltkulturerbeeinrichung Steine sprechen. Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft 0410 für Denkmal- und Ortsbildpflege Nr. -

My Life with Polymer Science: Scientific Nda Personal Memoirs Otto Vogl University of Massachusetts - Amherst, [email protected]
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Emeritus Faculty Author Gallery 2004 My Life with Polymer Science: Scientific nda Personal Memoirs Otto Vogl University of Massachusetts - Amherst, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/emeritus_sw Part of the Chemical Engineering Commons, and the Chemistry Commons Vogl, Otto, "My Life with Polymer Science: Scientific nda Personal Memoirs" (2004). Emeritus Faculty Author Gallery. 255. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/emeritus_sw/255 This Book is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Emeritus Faculty Author Gallery by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. My Life with Polymer Science - Otto Vogl My Life with Polymer Science: Scientific and Personal Memoirs Index Acknowledgements Preface I. The Formative Years II. The Years of Wandering III. The Industry Years at Du Pont IV. The University of Massachusetts V. The Polytechnic University VI. Publishing VII. Teaching VIII. Professional Societies IX. Appendix Edited by William J Truett and formatted by Frank Blum Jr. http://www.missouri.edu/~fdbq36/ottovogl.mylife/main.shtml10/10/06 12:03 PM Index My Life with Polymer Science: Scientific and Personal Memoirs Index i-vi Acknowledgements vii-viii Preface 1 I. The Formative Years 5 A. My Youth B. The Student Years C. The Dissertation D. As Instructor at the University of Vienna II. The Years of Wandering 54 A. At the University of Michigan B. At Princeton University III. The Industry Years at Du Pont 71 A. -
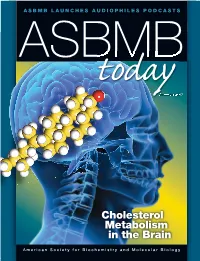
Cholesterol Metabolism in the Brain
ASBMB LAUNCHES AUDIOPHILES PODCASTS December 2007 Cholesterol Metabolism in the Brain American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2008 ® 42==7@C =2E63C62<:?8 2acZ]&¿* 23DEC24ED www.eb2008.org Da`_d`cd+ 222 December 10, 2007. 22: Wednesday, April 9, 2008. 2AD 2D3>3 www.eb2008.org Wednesday, February 6, 2008. 2D:A www.eb2008.org 2D? 2DA6E [email protected] DRgV>`_Vj contents DECEMBER 2007 ON THE COVER: John Dietschy is studying society news cholesterol processing in the brain to find ways to 2 President’s Message prevent it from accumulating abnormally. 26 4 Washington Update CHOLESTEROL IMAGE CREDIT: KEN BUTENHOF. 10 New Skin Lipids Series in JLR 10 ASBMB Launches AudioPhiles Podcasts 12 Retrospective: Arthur Kornberg (1918—2007) special interest 11 Women in Science is Focus of Hill Hearings, Legislation 14 Trends in Employment and Awards 2008 meeting overview 16 The 2008 FASEB Excellence in Science Award: Mina J. Bissell 17 The 2008 Avanti Award in Lipids: Alexandra C. Newton pg (1918—2007) 12 science focus 26 John Dietschy: Understanding Cholesterol Metabolism Biomedical Science Ph.D. Employment 120,000 departments 100,000 80,000 5 News from the Hill 60,000 8 Member Spotlight 40,000 20,000 18 Minority Affairs 0 1973 1977 1981 1985 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 20 Career Insights Other Government Industry Academia 22 Education and Training py 14 24 BioBits resources 30 Career Opportunities podcast summary 34 For Your Lab This month’s ASBMB AudioPhiles Podcast looks at a line of “mighty mice” bred by Case Western 35 Scientific Meeting Calendar Reserve University researchers as well as the classic work of protein chemist Frank W. -

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.)
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität