Insecta: Lepidoptera) 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Insekt-Nytt • 38 (3) 2013
Insekt-Nytt • 38 (3) 2013 Insekt-Nytt presenterer populærvitenskape lige Insekt-Nytt • 38 (3) 2013 oversikts- og tema-artikler om insekters (inkl. edder koppdyr og andre landleddyr) økologi, Medlemsblad for Norsk entomologisk systematikk, fysiologi, atferd, dyregeografi etc. forening Likeledes trykkes artslister fra ulike områder og habitater, ekskursjons rap por ter, naturvern-, Redaktør: nytte- og skadedyrstoff, bibliografier, biografier, Anders Endrestøl his to rikk, «anek do ter», innsamlings- og prepa re- rings tek nikk, utstyrstips, bokanmeldelser m.m. Redaksjon: Vi trykker også alle typer stoff som er relatert Lars Ove Hansen til Norsk entomologisk forening og dets lokal- Jan Arne Stenløkk av de linger: årsrapporter, regnskap, møte- og Leif Aarvik ekskur sjons-rapporter, debattstoff etc. Opprop og Halvard Hatlen kon taktannonser er gratis for foreningens med lem- Hallvard Elven mer. Språket er norsk (svensk eller dansk) gjerne med et kort engelsk abstract for større artik ler. Nett-redaktør: Våre artikler refereres i Zoological record. Hallvard Elven Insekt-Nytt vil prøve å finne sin nisje der vi Adresse: ikke overlapper med vår forenings fagtidsskrift Insekt-Nytt, v/ Anders Endrestøl, Norwegian Journal of Entomology. Origi na le NINA Oslo, vitenskapelige undersøkelser, nye arter for ulike Gaustadalléen 21, faunaregioner og Norge går fortsatt til dette. 0349 Oslo Derimot tar vi gjerne artikler som omhandler Tlf.: 99 45 09 17 «interessante og sjeldne funn», notater om arters [Besøksadr.: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo] habitatvalg og levevis etc., selv om det nødven- E-mail: [email protected] digvis ikke er «nytt». Sats, lay-out, paste-up: Redaksjonen Annonsepriser: 1/2 side kr. 1000,– Trykk: Gamlebyen Grafiske AS, Oslo 1/1 side kr. -

Korrekturen Und Ergänzungen Zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs Und Angrenzender Gebiete - 2
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart Jahr/Year: 2009 Band/Volume: 44_2009 Autor(en)/Author(s): Hausenblas Dietger Artikel/Article: Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag. 81-107 © Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at 81 Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag Dietger Hausenblas, Stuttgart Abstract This paper is the author’s second contribution to the microlepidoptera fauna of Baden-Wuerttemberg and neighbouring regions. As a result of recent collecting and of a review of historical specimens in the mu- seums of Karlsruhe and Stuttgart several species are reported as new to the fauna of Baden- Wuerttemberg whereas some others have to be deleted from the faunal list. Two species - Metalampra italica Baldizzone , 1977 and Stenoptilia mariaeluisae B igot & P icard , 2002 - are new for Germany. In an appendix the geographical colour-code-system of the labels in the C. Reutti collection is elucidated. Zusammenfassung In diesem zweiten Beitrag des Autors zur Microlepidopterenfauna von Baden-Württemberg und benachbarter Regionen sind erneut Ergebnisse sowohl aktueller Aufsammlungen als auch von Nachuntersuchung historischen Materials in den beiden großen Naturkundemu seen des Landes in Verbindung mit der Auswertung von Literaturmeldungen zusammenge stellt. Zahlreiche Arten können der Fauna hinzugefügt, während andere Meldungen korrigiert werden. Zwei Arten - Metalampra italica Baldizzone , 1977 und Stenoptilia mariaeluisae Bigot & P icard, 2002 - sind neu für Deutschland. Zusätzlich erfolgt in einem Anhang die Auflistung von Fundorten der Sammlungsetiketten von C. Reutti in Verbindung mit der von ihm verwendeten Farbcodierung. -

Sborník SM 2013.Indb
Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 31: 67–168, 2013 ISBN 978-80-87266-13-7 Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I Jan Šumpich1), Miroslav Žemlička2) & Ivo Dvořák3) 1) CZ-582 61 Česká Bělá 212; e-mail: [email protected] 2) Družstevní 34/8, CZ-412 01 Litoměřice 3) Vrchlického 29, CZ-586 01 Jihlava; e-mail: [email protected] Abstract. Faunistic records of butterflies and moths (Lepidoptera) found at nine localities of northern Bohemia (Czech Republic) are presented. In total, 1258 species were found, of which 527 species were recorded in Želiňský meandr (Kadaň environs), 884 species in the Oblík National Nature Reserve (Raná environs), 313 species in the Velký vrch National Nature Monument (Louny environs), 367 species in the Třtěnské stráně Nature Monument (Třtěno environs), 575 species in Eváňská rokle (Eváň environs), 332 species in Údolí Podbrádeckého potoka (Mšené-lázně environs), 376 species in Vrbka (Budyně nad Ohří environs), 467 species in Holý vrch (Encovany environs) and 289 species in Skalky u Třebutiček (Encovany environs). The records of Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851), Cephimallota praetoriella (Christoph, 1872), Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847), Oegoconia caradjai Popescu- Gorj & Capuse, 1965, Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864), Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763), Pelochrista obscura Kuznetsov, 1978, Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775), Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775), Pseudo- philotes vicrama (Moore, 1865), Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775), Melitaea aurelia Nickerl, 1850, Hipparchia semele (Linnaeus, 1758), Chazara briseis (Linnaeus, 1764), Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849), Gnophos dumetata Treitschke, 1827, Watsonarctia casta (Esper, 1785), Euchalcia consona (Fabricius, 1787), Oria musculosa (Hübner, 1808) and Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) are exceptionally significant in a broader context, not only in terms of the fauna of northern Bohemia. -

Állattani Közlemények 78. (1992)
o r h ALLATTANI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI ANDRÁSSY ISTVÁN 78. KÖTET A Magvai riidománvns \kadcima cs a Pro Kcnovaiula Cultura llungariac Alapítvány ininogutásaval kiadja a MAC! YAK IIIOI (X II Al IAKSASÁC! IW2 ALLATTANI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI ANDRÁSSY ISTVÁN A szerkesztőbizottság tagjai: BAKONYI GÁBOR (a szerkesztő munkatársa), DELY OLIVÉR GYÖRGY, DÓZSA-FARKAS KLÁRA, KORSÓS ZOLTÁN, PONYI JENŐ 78. KÖTET Szedés: S&S Sopron Készült: Soproni Nyomda Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata. Elsősor- ban azokat a tanulmányokat közli, amelyek az Állattani Szakosztály ülésein elhangzottak. A szerkesztő kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőle nyomban juttassák el a címére: DR. ANDRÁSSY ISTVÁN ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Budapest. VIII. Puskin u. 3. 1088 A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25-30 sorral (ritka sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kérjük benyújtani. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve éles pozitív (fekete-fehér) fényképek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást kérünk az idegen nyelvű kivonat számára. A szerzők cikkeikről 60 különlenyomatot kapnak. Állattani Közlemények, 78, 1992 Dr. Loksa Imre (1923-1992) írta: DÓZSA-FARKAS KLÁRA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. LOKSA IMRE, a Magyar Biológiai Társaság tttani Szakosztályának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani Ökológiai Tanszékének docense, volt tanszékvezető, 1992. június 21-én váratlanul ahúnyt. -
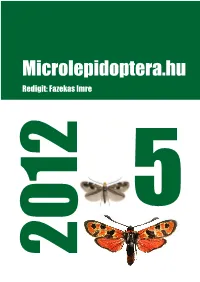
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Entomologiske Meddelelser
Entomologiske Meddelelser BIND 60 KØBENHAVN 1992 Indhold - Contents Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen: Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes .................... 117 Buhl, 0., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera) Records of Microlepidoptera from Denmark in 1990 . ............................ Buh!, 0., P. Falck, B.Jørgensen, O. Karshol t & K. Larsen: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera) Records oj Microlepidopterafrom Denmark in 1991 .............................. 101 Fibiger, M.: Diarsia rubi (Vieweg, 1790) og D.florida (Schmidt, 1859), to selvstændige arter (Lepidoptera, N octuidae) Diarsia rubi (Vieweg, 1790) and D. florida (Schmidt, 1859), two dislinet species . 61 Godske, L.: Aphids in nests of Lasiusflavus F. in Denmark. II. Population dynamics (Aphidoidea, Anoeciidae & Pemphigidae; Hymenoptera, Formicidac) . 21 Gønget, H.: Om spidsmussnudebillerne Apion (Catapion) seniculus Kirby og A. (C.) meieri Desbrochers des Loges i Danmark (Coleoptera, Apionidae) On Apion (Catapion) seniculus Kirby and A. (C.) meieri Desbrochers des Loges in Denmark . 111 Hansen, M.: Vandkæren n Berosus spinosusa - to arter i Danmark (Coleoptera, H ydrophilidae) The water scavenger beetle » Berosus spinosus« two species in Denmark . 65 Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler &J. Pedersen: 11. tillæg til "fortegnelse over Danmarks biller« (Coleoptera) 11th supplement to the list of Danish Coleoptera . 69 Heda!, S. & S. C. Schmidt: Om forekomsten af porcelænsmøllet Acentria ephemerella (Den. & Schiff.) i nogle danske fjorde (Lepidoptera, Pyralidae) On the occurrence of Acentria ephemerella (Den. & Schiff) in same Danishjjords . 17 Jensen, A., V. Mahler & M. Hansen: To nye danske biller i en brændt mose i Sønder jylland (Coleoptera, Staphylinidae & Cryptophagidae) Two new Danish beetles in a burntfen in Southjutland.. -

DOCOB Pelouses Calcaires Du Gâtinais
DOCUMENT D ’O BJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR 1100802 « PELOUSES CALCAIRES DU GATINAIS » DOCUMENT DE COMPILATION PRO NATURA Ile-de-France S/C NaturEssonne 6, route de Montlhéry Octobre 2006 91310 Longpont-sur-Orge Tel : 01 69 01 50 23 – e mail : [email protected] Directive Habitats Ile-de-France – Site des Pelouses calcaires du Gâtinais Document d’Objectifs – Opérateur : Pro Natura Ile-de-France, s/c NaturEssonne DOCUMENT D 'O BJECTIFS DU SITE NATURA 2000 N° FR 1100802 PELOUSES CALCAIRES DU GATINAIS Comité de Pilotage (constitué par arrêté préfectoral n° 2003/PREF-DCL /0271 du 15 décembre 2003) : Représentants de l'Etat et des Le Préfet de l’Essonne, représenté par le Sous-Préfet d’Etampes services déconcentrés Le Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de-France Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt Représentants des collectivités Le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France territoriales et de leurs groupements Le Président du Conseil Général de l'Essonne Le Maire de la commune de Champmotteux Le Maire de la commune de Gironville-sur-Essonne Le Maire de la commune de Maisse Le Maire de la commune de Puiselet-Le-Marais Le Maire de la commune de Valpuiseaux Le Président du Parc Naturel Régional du Gâtinais français Représentants des propriétaires et Le Président de la Chambre Interdépartementale exploitants de biens ruraux situés sur d'Agriculture d'Ile-de-France le site et usagers du site Le Président de la Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines Le Président -

Gortania 30.Indd
GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat. 30 (2008) 221-254 Udine, 31.VII.2009 ISSN: 0391-5859 P. HUEMER, C. MORANDINI BIODIVERSITY OF LEPIDOPTERA WITHIN THE AREA OF VALLE VECCHIA (CAORLE, VENEZIA) WITH SPECIAL REGARD TO NATURE CONSERVATION ASPECTS !"#$%&'($")*++*)!"#",!-#.*)/-&)+-0&/"$$-%&)/-++1*%-*)/& 2*++-)2-!!3&*)4!*"%+-5)2-#-.&*6)!"#)0*%$&!"+*%-)%&7(*%/")*7+& *,0-$$&)!"#,-%2*.&"#&,$&!& Abstract)8)684 species of butter! ies and moths are recorded from the area of Valle Vecchia (Caorle, Venezia). The species inventory includes two probably undescribed species: *9:;<;=>? sp. n. and a species of the Crambidae subfamily Odontiinae. 9 species are newly recorded from Italy: 0@ABBCDC=AE;<=) E<9@:B:=>:<, !C?F>C;<?)?;:G>B<BB:, !C?FC9;<=>H)9:=:=IJ<BB:, -IB:F9=C;<?)>FF:EIB:;<BB:, ,E=CG>9:B9:) D>;<D;<BB:, -9@A?;<=>?)>D?IB<BB:, 7ADD>KCFC=9@:)BI=>K:D:, !B:L>M<?;:)9I=K<A> and *??:=:);I=E><BB:. Several species are extremely rare and/or scattered in Italy or even restricted to Valle Vecchia, e.g. NABCFC>:)?;:DM<BF:><=>. The importance of the area is furthermore underlined by the occurrence of +AE:<D:) K>?9:= and -I9B:M>:) OI:K=>9IDE;:=>:, two species protected by the Fauna-Flora-Habitat directive of the EU. An ecological analysis underlines the particular importance of the sandy dune system and halophytic depression for Lepidoptera. Bed of reeds and hygrophilous to xerophilous grassland add to the overall diversity. Recent afforestations probably will improve the importance of woody plants. Biogeographically, species which are widely distributed in Eurasia and/or North America or which are even cosmopolitan cover about 72% of the inventory. -

Interessante Waarnemingen Van Lepidoptera in België in 2015 (Lepidoptera)
Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2015 (Lepidoptera) Willy De Prins, Chris Steeman & Tom Sierens Samenvatting. Enkele nieuwe provinciegegevens en andere interessante waarnemingen van Lepidoptera in 2015 worden gemeld. Enkele oudere gegevens worden eveneens vermeld. De hele lijst is alfabetisch gerangschikt. De gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met Fauna Europaea (www.fauna-eu.org). Abstract. Some new province records and interesting observations of Lepidoptera in 2015 are mentioned. The whole list is arranged in alphabetical order. The nomenclature is according to Fauna Europaea (www.fauna-eu.org). Résumé. Plusieurs données faunistiques nouvelles par province sont mentionnées, ainsi que quelques observations intéressantes en 2015. La liste est rangée alphabétiquement. La nomenclature suit les listes de Fauna Europaea (www.fauna- eu.org). Key words: Lepidoptera – faunistics – Belgium. De Prins W.: Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. [email protected] Steeman C.: Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen. [email protected] Sierens T.: Tijkstraat 6, B-9000 Gent. [email protected] In deze vaste rubriek worden de meest interessante Argyresthiidae waarnemingen van Lepidoptera uit het voorbije jaar (en Argyresthia bonnetella – Variabele pedaalmot: 1 ex. eventueel vorige jaren) geciteerd. Vele van de op 20.vi.2015 te Libin (LX), leg. C. Gruwier. Nieuw voor nieuwigheden in dit artikel vermeld, zijn reeds LX. gepubliceerd op de website van de Belgische Lepidoptera Argyrestha glabratella – Fijnsparpedaalmot (Fig. 2): (De Prins & Steeman 2003–2015). De hele lijst is een vijftal rupsen in de twijgen van Picea abies op alfabetisch gerangschikt volgens familie-, genus- en 26.xi.2015 te Aalst-Osbroek (OV), en 4 vraatsporen op P. -

Nachträge Und Korrekturen Zu: Verzeichnis Der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte Jahr/Year: 2008 Band/Volume: 52 Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard Artikel/Article: Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). 9-49 © Entomologische Nachrichten und Berichte; downloadEntomologische unter www.biologiezentrum.at Nachrichten und Berichte, 52, 2008/1 9 R. G a e d ik e , Bonn Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera) Zusammenfassung Die seit dem Erscheinen der Deutschlandliste (G a e d ik e & H e in ic k e 1999) in der Literatur veröffentlichten Nachträge und Berichtigungen werden zusammengestellt. Erfasst werden Neufünde für Deutschland, für einzelne Bundesländer, aktuelle Funde (nach 1980), Streichungen aus dem Verzeichnis sowie nomenklatorische Änderungen. Die folgenden 47 Arten sind Neufunde für Deutschland: 117 Stigmella sanguisorbae (W o c k e , 1865); 265 Ectoedemia amani S v e n s s o n , 1966; 272 Ectoedemia klimeschi (S k a l a , 1933); 577 Lichenotinea maculata P e t e r s e n , 1957; 592 Karsholtia marianii (R e b e l , 1936); 1180 Parornix atripalpella W a h l s t r ö m , 1979; 1261 Phyllonorycter issikii (K u m a t a , 1963); 1617 Leucoptera genistae (M. H e r in g , 1933); 1742 Agonopterix multiplicella (E r s c h o f f , 1877); 1751 Agonopterix oinochroa (T u r a t i, 1879); 1986 Elachista occidentalis F r e y , 1882; 2005a -

Der GEO-Tag Der Artenvielfalt 2008 Am Albulapass
Jber. Natf. Ges. Graubünden 116 (2010), Seiten 5 – 58 Der GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Albulapass Eine 24-Stunden-Aktion zur Erfassung der Biodiversität: Methoden und Resultate von Marion Schmid und Jürg Paul Müller Adresse: Bündner Naturmuseum Masanserstrasse 31 CH-7000 Chur [email protected] [email protected] Unter Mitarbeit von Insgesamt wurden 1535 Arten festgestellt, dar- unter drei Erstnachweise für die Schweiz, elf Erst- Felix Amiet, Ariel Bergamini, Thomas Briner, nachweise für Graubünden und weitere faunisti- Martin Camenisch, Armin Coray, Regula Cornu, sche und floristische Besonderheiten. Ein Vergleich Holger Frick, Michael Geiser, Christoph Germann, mit der Artenvielfalt auf der Alp Flix, die acht Jahre Jean-Paul Haenni, Peter Herger, Martin Kemler, Se- zuvor mit der gleichen Methodik bearbeitet wurde, raina Klopfstein, Matthias Lutz, Jani Marka, Chris- zeigt, dass die Artenzahlen in ähnlichen Bereichen toph Meier-Zwicky, Bruno Peter, Jürg Schmid, Hans liegen. Auf der Alp Flix ist das Mosaik der Lebens- Schmocker, Ulrich E. Schneppat, Norbert Schnyder, räume jedoch noch kleinräumiger und verzahnter, Arno Schwarzer, Eva Sprecher was eine ähnliche Artenzahl auf einer kleineren Fläche ergibt. In beiden Untersuchungsgebieten konnte aber im Vergleich zu Aktionen in Tieflagen Zusammenfassung eine erstaunlich hohe Artenzahl ermittelt werden, was wiederum beweist, dass die Artenzahl im Ge- Am 3. Juni 2008 führten die Stiftung Sammlung birge erst deutlich oberhalb des Waldgrenzenöko- Bündner Naturmuseum, das Management des Parc tons abnimmt. Ela und Bergün-Filisur Tourismus gemeinsam ei- Der GEO-Tag der Artenvielfalt am Albulapass bot nen Tag der Artenvielfalt durch. Das Konzept ba- eine willkommene Gelegenheit, um nicht nur die sierte auf der 24-Stunden-Aktion zur Erfassung ei- Wissenschaft, sondern auch die Bevölkerung auf die ner möglichst grossen Zahl von Pilz-, Pflanzen- und Bedeutung der Biodiversität und deren Erforschung Tierarten, wie sie die Zeitschrift GEO seit 1999 in hinzuweisen. -

Das Beutetierspektrum Und Der Jagdlebensraum Des Grossen Mausohrs Myotis Myotis
ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN DEPARTEMENT LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT INSTITUT FÜR UMWELT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN Das Beutetierspektrum und der Jagdlebensraum des Grossen Mausohrs Myotis myotis Metabarcoding-Daten aus vier Wochenstuben Bachelorarbeit von Sabrina Lötscher Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen 2017 Vertiefung Naturmanagement Abgabe: 31.07.2020 Impressum Titelbild Parc naturel régional Oise, Orry-la-Ville, Frankreich Schlagworte Grosses Mausohr, Myotis myotis, Nahrungsspektrum, Jagdhabitat, Metabarcoding, Next Generation Sequencing Zitiervorschlag Lötscher, S. (2020). Das Beutetierspektrum und der Jagdlebensraum des Grossen Mausohrs Myotis myotis – Metabarcoding-Daten aus vier Wochenstuben. Bachelorarbeit. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädenswil. Unveröffentlicht. Fachkorrektoren: Dr. Fabio Rezzonico, Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembiologie Annette Stephani, Forschungsgruppe Wildtiermanagement Prof. Dr. Theo H. M. Smits, Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembiologie Institut Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Life Sciences und Facility Management Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen IUNR CH-8820 Wädenswil ZH Zusammenfassung Die Population der Grossen Mausohren (Myotis myotis) wird in der Schweiz auf ungefähr 30'000 Individuen geschätzt und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand. Aufgrund ihrer Lebensweise als Kulturfolger sind sie allerdings diversen anthropogenen Einflüssen ausgesetzt und es gilt, die Art und ihren