Dem Morgenrot Entgegen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Baselland 1848
Baselland 1848 Autor(en): Martin Leuenberger, Hans Rudolf Schneider Quelle: Basler Stadtbuch Jahr: 1998 https://www.baslerstadtbuch.ch/.permalink/stadtbuch/84d2b088-51ef-4bac-a279-9d5203671b78 Nutzungsbedingungen Die Online-Plattform www.baslerstadtbuch.ch ist ein Angebot der Christoph Merian Stiftung. Die auf dieser Plattform veröffentlichten Dokumente stehen für nichtkommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung gratis zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online- Publikationen ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des vorherigen schriftlichen Einverständnisses der Christoph Merian Stiftung. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Die Online-Plattform baslerstadtbuch.ch ist ein Service public der Christoph Merian Stiftung. http://www.cms-basel.ch https://www.baslerstadtbuch.chhttp://www.cms-basel.ch https://www.baslerstadtbuch.ch «Kommen Sie zu uns nach der Landschaft, Martin Leuenberger Basel ist keine Luft für Sie!» Hans Rudolf Schneider Die Revolution in Baden und die Flüchtlinge im Baselbiet «In die Schweiz!» - wie die Kantone selbst. Die ge Dieser Ruf hatte im 18. und 19. Jahrhundert einen zauberhaften Klang. meinschaftliche Aussenpolitik Alles, was künstlerischen Rang und Namen hatte, lobte dieses kleine Rergland: und ein Bundesvertrag waren die Goethe, Schiller, Rossini. -

University Microfilms
INFORMATION TO USERS This dissertation was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating' adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding o f the dissertation. -

Laudatio Prof. Dr.-Ing. Stefan Schweiger
Laudatio zur Verleihung des Emma-Herwegh-Preises an Herrn Carsten Stegmeyer am 17. Mai 2014 Laudator: Prof. Dr. Stefan Schweiger Liebe Festgäste, ich habe nunmehr die Ehre und das Vergnügen, die Laudatio zur Verleihung des Emma-Herwegh-Preises zu halten – eines Preises, dessen Verleihung seit langen Jahren zu den guten Ritualen der Konstanzer BWL zu zählen ist. Neben den hoch anerkennenswerten fachlichen Leistungen, die wir mit dem Luca-Pacioli-Preis auszeichnen, ist es uns auch von besonderer Bedeutung, dass sich unsere Studierenden über das Curriculum hinaus für ihren Studiengang einsetzen. Daher verleihen wir – nicht immer, aber immer dann, wenn wir hierfür in den Reihen unserer ehemaligen Studierenden würdige Preisträger/innen finden können – den Emma-Herwegh-Preis für besonderes studentisches Engagement. Zunächst ein paar Worte zu Emma Herwegh: Sie war die engagierte Frau des Dichters Georg Herwegh, der 1848 die „Deutsche Legion“ – deutsche Legionäre im französischen Exil – anführte, um gemeinsam mit dem badischen Revolutionär Friedrich Hecker in Deutschland der Demokratie zum Durchbruch zu verhelfen – nicht mehr und nicht weniger. Emma Herwegh wuchs als Tochter des durch Seidenhandel reich gewordenen Berliner Kaufmanns Johann Gottfried Siegmund und seiner Frau Henriette in wohlhabenden Verhältnissen in Berlin auf. Gebildet und musisch begabt vertrat die junge Dame in politischer Hinsicht radikaldemokratische und republikanische Standpunkte. Im Hause Ihrer Eltern und später im eigenen Hause in Zürich und Baden-Baden verkehrten charaktervolle -

Comparative Humanities Review Volume 3 Translation: Comparative Perspectives Article 14 (Spring 2009)
Comparative Humanities Review Volume 3 Translation: Comparative Perspectives Article 14 (Spring 2009) 2009 Comparative Humanities Review Follow this and additional works at: http://digitalcommons.bucknell.edu/chr Recommended Citation (2009) "Comparative Humanities Review," Comparative Humanities Review: Vol. 3, Article 14. Available at: http://digitalcommons.bucknell.edu/chr/vol3/iss1/14 This Full Issue is brought to you for free and open access by Bucknell Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Comparative Humanities Review by an authorized administrator of Bucknell Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Translation: Comparative Perspectives Vol. 3 (Spring 2009) Edited by A. Joseph McMullen The Comparative Humanities Review 3 Translation: Comparative Perspectives Edited by A. Joseph McMullen A Student Publication of The Comparative Humanities Department Bucknell University Lewisburg, PA The Comparative Humanities Review is a student-run journal dedicated to the support and distribution of undergraduate scholarship in the humanities. We welcome submissions that are comparative in nature and employ any discipline in the humanities. Contributions should be written when the author is completing his or her undergraduate degree. For more information, contact the Editor-in-Chief by visiting the Web site below. Access the journal online: http://www.orgs.bucknell.edu/comp_hum_rev/index.html Copyright (c) 2009 All rights reserved. Cover: Preparations to burn the body of William Tyndale from John Foxe’s Book of Martyrs Source: Lacey Baldwin Smith, The Horizon Book of the Elizabethan World (New York: American Heritage, 1967), 73. 3 Translation: Comparative Perspectives Contents Translation and Film: Slang, Dialects, Accents and Multiple Languages / Allison Rittmayer … 1 Philosophy, Abstract Thought, and the Dilemmas of Philosophy / James Rickard … 13 The Great War Seen Through the Comparative Lens / Steven L. -
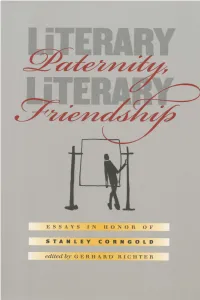
9781469658254 WEB.Pdf
Literary Paternity, Literary Friendship From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Literary Paternity, Literary Friendship Essays in Honor of Stanley Corngold edited by gerhard richter UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 125 Copyright © 2002 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Richter, Gerhard. Literary Paternity, Liter- ary Friendship: Essays in Honor of Stanley Corngold. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. doi: https://doi.org/ 10.5149/9780807861417_Richter Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Richter, Gerhard, editor. Title: Literary paternity, literary friendship : essays in honor of Stanley Corngold / edited by Gerhard Richter. Other titles: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures ; no. 125. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [2002] Series: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 2001057825 | isbn 978-1-4696-5824-7 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5825-4 (ebook) Subjects: German literature — History and criticism. -

Wissenschaftskolleg Zu Berlin Jahrbuch 1986/87
Wissenschaftskolleg zu Berlin Jahrbuch 1986/87 WISSENSCHAFTSKOLLEG -INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY - ZU BERLIN JAHRBUCH 1986/87 NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG © 1988 by Nicolaische Verlags- buchhandlung Beuermann GmbH, Berlin und Wissenschaftskolleg zu Berlin — Institute for Advanced Study — Alle Rechte, auch das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten Redaktion: Ingrid Rudolph Satz: MEDIA trend, Berlin Druck: Druckerei Gerike, Berlin Buchbinder: Luderitz & Bauer, Berlin Printed in Germany 1988 ISBN 3-87584-236-7 5 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung des Herausgebers 11 Arbeitsberichte MOHAMMED ARKOUN 17 PETER AX 20 DAVID R. AXELRAD 24 PETER BOERNER 27 ELIESER L. EDELSTEIN 30 GEORG ELWERT 33 JANE FULCHER 38 MAURICE GARDEN 39 ALDO G. GARGANI 41 JACOB GOLDBERG 43 RAINER GRUENTER 48 ROLF HOCHHUTH 49 6 GERTRUD HOHLER 51 JOHN HOPE MASON 55 LOTHAR JAENICKE 58 RUTH KATZ 62 GIULIANA LANATA 64 HERBERT MEHRTENS 67 KLAUS MOLLENHAUER 73 AUGUST NITSCHKE 81 DIETER NORR 83 MICHAEL OPPITZ 84 ADRIANA ORTIZ-ORTEGA 89 JOSEF PALDUS 93 ULRICH POTHAST 98 PETER HANNS REILL 102 7 RICHARD RORTY 105 BERND ROTHERS 108 PETER SCHEIBERT 111 YONATHAN SHAPIRO 114 VERENA STOLCKE 117 HENRY A. TURNER 122 BRIAN VICKERS 124 GYÖRGY WALKO 130 R. J. ZWI WERBLOWSKI 134 O. K. WERCKMEISTER 73 8 Seminarberichte Constitutive Laws and Microstructure Seminar veranstaltet von DAVID R. AXELRAD und WOLFGANG MUSCHIK 23.-24. Februar 1987 139 Der Wandel am Anfang des 20. Jahrhunderts. Parallele Veränderungen in Wissenschaft, Kunst, Recht und in bevorzugten Bewegungsweisen. Verschiedene Erklärungsmodelle. Seminar veranstaltet von HERBERT MEHRTENS und AUGUST NITSCHKE 11.-12. März 1987 140 Unternehmer und Regime im Dritten Reich Seminar veranstaltet von HENRY A. TURNER 19.-21. März 1987 145 Die deutsche Kunst unter der nationalsozialistischen Regierung als Gegenstand der kunstgeschichtlichen Forschung Seminar veranstaltet von O.K. -

Autographen-Auktion 1. Oktober 2011
26. AutogrAphen-Auktion A u 1. oktober 2011 T o g r A p H Los |168 E n - A s u p A K ni T E n – Jo i o n ha nn i. 1.10. 2011 A x E L Los 542 | Hermann Löns s c Axel Schmolt | Autographen-Auktionen H M 47807 Krefeld | steinrath 10 o Telefon (02151) 93 10 90 | Telefax (02151) 93 10 9 99 L E-Mail: [email protected] T AutogrAphen-Auktion hier die genaue Anschrift für ihr Autographen-Auktionen Autographen inhaltsverzeichnis navigationssystem: Bücher Dokumente 47807 Krefeld | steinrath 10 Fotos Los-nr. g eschichte – Europäische Königshäuser 1 - 187 (sammlung peter Michielsen, utrecht, niederlande) Krefeld A 57 Auktionshaus Schmolt Richtung – napoleonische Zeitdokumente 188 - 198 Richtung am besten über die A 44 Abfahrt Essen – Deutsche Länder (ohne preußen) 199 - 219 Venlo Krefeld-Fischeln Meerbusch-Osterath✘ – preußen und Kaiserreich bis 1914 220 - 247 – i. Weltkrieg und Deutsche Marine 248 - 253 A 44 – Weimarer republik 254 - 265 A 44 – nationalsozialismus und ii. Weltkrieg 266 - 344 – Deutsche geschichte seit 1945 345 - 377 A 61 – geschichte des Auslands bis 1945 378 - 407 A 52 A 52 – geschichte des Auslands seit 1945 408 - 458 Düsseldorf – Kirche-religion 459 - 467 Mönchengladbach Neuss Literatur 468 - 603 Richtung A 57 Roermond Musik 604 - 869 – oper-operette (sänger/-innen) 870 - 945 Richtung Richtung Bühne - Film - tanz 946 - 1035 Koblenz Köln Bildende kunst 1036 - 1182 A 57 Wissenschaft 1183 - 1235 Autographen-Auktionen – Forschungsreisende und geographen 1236 - 1241 Axel Schmolt Steinrath 10 Luftfahrt 1242 - 1252 ✘ Kölner Straße Weltraumfahrt 1253 - 1258 A 44 Ausfahrt Sport 1259 - 1284 Osterath A 44 Kreuz Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1285 - 1310 Meerbusch Richtung Krefelder Straße Mönchengladbach Sammlungen - konvolute 1311 - 1339 A 57 Autographen-Auktion am Samstag, den 1. -

Literatur- Und Quellentipps Der Autoren Momente 1|2017
Literatur- und Quellentipps der Autoren Momente 1|2017 2 – 7 | Luxusartikel, Massenware, Spaßgerät. 200 Jahre Fahrrad im Südwesten | Thomas Kosche Aktueller Ausstellungskatalog: Zwei Räder – 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades. Katalog zur Großen Landesausstellung 2016 Baden-Württemberg. Hg. v. TECHNOSEUM – Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Theiss: Darmstadt 2016, ISBN: 978-3806233742, 29,95 1. Literatur: Museum der Arbeit (Hg.): Das Fahrrad. Kultur, Technik, Mobilität. Hamburg 2014. Lessing, Hans-Erhard: Automobilität. Karl Drais und die unglaublichen Anfänge. Leipzig 2003. Hadland, Tony/ Lessing, Hans-Erhard: Bicycle Design. An illustrated history. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge 2014. Zimmermann, Ludwig: Geschichte der Radportbewegung in Oberschwaben. Auf den Spuren der oberschwäbischen Vereinskultur. 100 Jahre „Radfahrverein Concordia Mochenwangen 1914 e.V.“. Bergatreute, Aulendorf 2014. Ausgabe 1|2017 | 2 8 – 11 | Wohltätigkeit ist Chefsache. Die „Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins“ kümmerte sich seit 1817 um Fürsorge und Gesundheitspflege in ganz Württemberg | Beate Dettinger Neuerscheinung: Holtz, Sabine (Hg.): Hilfe zur Selbsthilfe. 200 Jahre Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg. Nomos: Baden-Baden 2016, ISBN 978-3-8487-3260-9, 59,– 1. Literatur: Boelcke, Willi A.: Sozialgeschichte Baden-Württembergs 1800 – 1989. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft (Schriften zur politischen Landeskunde Württembergs 16). Stuttgart 1989. Römer, Daniel: Die Ursprünge der Verflechtung zwischen Pietismus und Staat auf dem Gebiet des Sozialen im Württemberg des 19. Jahrhunderts. Studien zur Wechselwirkung zwischen Heinrich Lotter und Wilhelm I. als Grundlage für die Einbindung des Pietismus in das württembergische System der Wohlfahrtspflege. Zugl.: Stuttgart Univ. Diss., 2012. Stuttgart 2012. Weller, Arnold: Sozialgeschichte Südwestdeutschlands. Unter besonderer Berücksichtigung der sozialen und karitativen Arbeit vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart. -
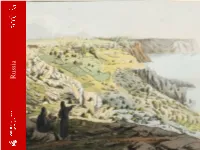
Download PDF Version
Russia Russia e-catalogue Jointly offered for sale by: ANTIL UARIAAT FOR?GE> 50 Y EARSUM @>@> Extensive descriptions and images available on request All offers are without engagement and subject to prior sale. All items in this list are complete and in good condition unless stated otherwise. Any item not agreeing with the description may be returned within one week after receipt. Prices are EURO (€). Postage and insurance are not included. VAT is charged at the standard rate to all EU customers. EU customers: please quote your VAT number when placing orders. Preferred mode of payment: in advance, wire transfer or bankcheck. Arrangements can be made for MasterCard and VisaCard. Ownership of goods does not pass to the purchaser until the price has been paid in full. General conditions of sale are those laid down in the ILAB Code of Usages and Customs, which can be viewed at: <http://www.ilab.org/eng/ilab/code.html> New customers are requested to provide references when ordering. Orders can be sent to either firm. Antiquariaat FORUM BV ASHER Rare Books Tuurdijk 16 Tuurdijk 16 3997 MS ‘t Goy 3997 MS ‘t Goy The Netherlands The Netherlands Phone: +31 (0)30 6011955 Phone: +31 (0)30 6011955 Fax: +31 (0)30 6011813 Fax: +31 (0)30 6011813 E–mail: [email protected] E–mail: [email protected] Web: www.forumrarebooks.com Web: www.asherbooks.com www.forumislamicworld.com cover image: no. 23 v 1.0 · 21 July 2020 Travelling in Russia in 1835: Russia through the eyes of an Utrecht professor 1. ACKERSDIJCK, Jan. -

Animals and Humans in German Literature, 1800-2000
Animals and Humans in German Literature, 1800-2000 Animals and Humans in German Literature, 1800-2000: Exploring the Great Divide Edited by Lorella Bosco and Micaela Latini Animals and Humans in German Literature, 1800-2000: Exploring the Great Divide Edited by Lorella Bosco and Micaela Latini This book first published 2020 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2020 by Lorella Bosco, Micaela Latini and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-5854-1 ISBN (13): 978-1-5275-5854-0 TABLE OF CONTENTS Introduction .............................................................................................. vii Exploring the Great Divide. Animals and Humans in the German- Language Literature Lorella Bosco and Micaela Latini Chapter One ................................................................................................ 1 Hounds, Horses and Elephants in Heinrich von Kleist’s Drama Penthesilea Grazia Pulvirenti and Renata Gambino Chapter Two ............................................................................................. 27 The Woman and the Snake/The Woman as a Snake. The Ophidian Feminine -

Rahmer: Das Kleist-Problem
Das Kleist Problem auf Grund neuer Forschungen zur Charakteristik und Biographie Heinrich von Kleists von S. Rahmer. Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1903. Motto: Denn die Erscheinung, die am meisten bei der Betrachtung eines Kunstwerks rührt, ist, dünkt mich, nicht das Werk selbst, sondern die Eigen- tümlichkeit des Geistes, der es hervor- brachte, und der sich in unbewußter Freiheit und Lieblichkeit darin ent- faltet. (H. v. Kleist an Fouqué, d. 25. IV. l811.) Vorwort. Trotz des reichhaltigen biographischen Materials, das über den Dichter Heinrich von Kleist in jahrzehntelanger mühseliger Arbeit gesammelt worden ist, ist er auch heut noch ein ungelöstes psychologisches Problem. Die literarhistorische Forschung hat den bequemen Ausweg gewählt, seiner Lebensbeschreibung gewissermaßen einen pathologischen Zuschnitt zu geben und hat aus dem deutschen Dichter und preußischen Helden einen erblich Belasteten und psychisch Gestörten gemacht, der in völliger geistiger Umnachtung zu Grunde ging. Die Berechtigung unserer Studie, die vom medizinisch-psychiatrischen Standpunkt diese Auffassung nachprüfen will, kann nicht in Abrede gestellt werden; auch das gerichtliche Forum appelliert an das ärztliche Gutachten in Fällen, wo geistige Störung und verminderte Zurechnungsfähigkeit [IV] vermutet wird. Ein gewisses Zugeständnis sehe ich auch von vornherein darin, daß grade in der Diskussion Kleistscher Dichtungen (Penthesilea) von autoritativer Seite die psychiatrische Ausbildung des Literaturhistorikers gefordert worden ist. Da psychiatrische Studien ohne allgemeine medizinische Vorkenntnisse und entsprechende Ausbildung eine Unmöglichkeit sind, so müssen wir darin die Anerkennung sehen, daß die medizinisch-psychiatrische Literaturbetrachtung der rein literarischen Forschung wesentliche Forderung bringen kann. Die neurologisch-psychiatrische Forschung sieht in derartigen Studien, die sich auf der Grenzlinie von Medizin und Literatur bewegen, nicht nur ihr gutes Recht, sondern sie sucht in denselben auch ihren eigenen Vorteil. -

Frauen Im Vormärz Und Der Revolution 1848/49
Literatur Frauen im Vormärz, auf dem Hambacher Fest und in der Revolution 1848/49 Stand: 22. Mai 2007 Anneke, Mathilde Franziska: Das Weib im Conlict mit den socialen Verhältnissen, in: Möhrmann, Renate (Hg.): Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente. Stuttgart 1978, S. 82-87. Anneke, Mathilde Franziska: Memoiren einer Frau aus dem badisch-pfälzischen Feldzug. Newark 1853. Reprint in: Henkel, Martin/Tauber, Rolf: Das Weib im Conflict mit den socialen Verhältnissen. Mathilde Franziska Anneke und die erste deutsche Frauenzeitung. Bochum 1976, S. 63-121. Becker, Albert: Hambach und die Frauen, in: Die Pfalz am Rhein 30 (1957), Heft 5, S. 93. Binder, Beate: „Die Farbe der Milch hat sich … ins Himmelblaue verstiegen“. Der Milchbykott 1849 in Stuttgart, in: Lipp, Carola (Hg.): Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49. Baden-Baden 1986, S. 159-164. Binder, Beate: „Dort sah ich, dass nicht Mehl verschenkt, sondern rebellt wird“. Struktur und Ablauf des Ulmer Brotkrawalls, in: Lipp, Carola (Hg.): Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49. Baden-Baden 1986, S.88-110. Blos, Anna: Emma Herwegh, in: Dies.: Frauen der deutschen Revolution 1848. Zehn Lebensbilder und ein Vorwort. Dresden 1928, S.61-66. Blos, Anna: Mathilde Franziska Anneke, in: Dies.: Frauen der deutschen Revolution 1848. Zehn Lebensbilder und ein Vorwort. Dresden 1928, S.17-23. Böttger, Fritz (Hg.): Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz und der Revolution von 1848. Darmstadt, Neuwied 1979. Böttger, Fritz (Hg.): Malwida Meysenbug von. Aus den Memoiren einer Idealistin. Berlin (Ost) 1970. Bublies-Godau, Birgit: Geliebte, Gatten und Gefährten.