Plansprachliche Bibliotheken Und Archive
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Update/No.33, 2006
UpdateEAB www.esperanto-gb.org ✩ Gisdateˆ An organ of the Esperanto Association of Britain Organo de Esperanto-Asocio de Britio No. 33, April–June 2006 ★ N-ro 33, aprilo–junio 2006 ISSN 1741-4679 International Communication without Discrimination ★ Respect for All Cultures Internacia Komunikado sen Diskriminacio ★ Respekto por Cˆiuj Kulturoj Response to ignorance of European Commissioner Jan Figel There follows the Esperanto version of the letter by the President of the Universal Esperanto Association in reply to the European Commission’s statement that culture is by definition absent from ‘artificial lan- guages’. Every speaker of Esperanto knows, on the other hand, that Esperanto was born of art, and particu- larly of poetry by L.L. Zamenhof. Original Esperanto poetry has since developed to rival the quality of poetry in any language – and that is without mentioning the quantity of original, quality prose, which Commissioner Figel would probably not have time to read in his lifetime. Is it not sad that we are ruled by people who are unable to ascertain even the most basic facts, but instead parrot old clichés? Like Galileo’s persecutors, they cannot bring themselves to look through the telescope and observe the reality that contra- dicts their prejudices. Protests to: Mr Jan Figel, European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium. Estimata komisionano, instancoj. Mi estos feliça klarigi tuj kiam tio estos ebla. Mi estos, mi skribas al vi por esprimi la al vi persone çi-rilate la situacion poste, feliça liveri al viaj oficejoj senton de indigno de çiuj en Hungarujo, en Litovujo, en kaj al viaj fakuloj vastan esperantistoj, kaj aparte de tiuj Italujo kaj en aliaj EU-landoj. -

Israelaj Esperantistoj Kunvenis En Kibuco
revuo ISSN 0014-0635 Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko) 97-a jaro • n-ro 1168 (3) • Marto 2004 IsraelajIsraelaj esperantistojesperantistoj kunveniskunvenis enen kibucokibuco LaΩdado de Tradukmaßinoj komuna prudento kaj tradukmemoroj Çu Esperanto Tute normala Çu la movado floras en Afriko? progreso II. malbonfartas? Esperanto Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio Enhavo (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko) 51 .... Malferme: Babiloj kurzas nule aΩ LaΩdado de komuna prudento Babiloj kurzas nule aΩ Fondita en 1905 de Paul Berthelot (Renato Corsetti). (1881-1910). Establita kiel organo 52 .... Çu Esperanto floras en Afriko? Virunga klubo serças leteramikojn. de UEA en 1908 de Hector Hodler AnkaΩ kilibanoj emus korespondi. 53 .... En Benino çio iras glate. Çu granda centro en Goma? LaΩdado de komuna prudento (1887-1920). 54 .... Braza Centro seminariis. Kalimba en Kongolando. Rondvoja¸o tra Togolando. Redaktoro: Stano Marçek. UTE en Togolando. 55 .... Bona espero en Suda Afriko. Jubilea festo en Kinßaso. Juna bando en Ni¸erlando. Renato Corsetti Adreso de la redakcio: Seti Dismas. Verda Maro en Ni¸erio. Revuo Esperanto 56 .... Bona tradukmaßino bazi¸as sur tradukmemoro (Toon Witkam). a unua duono de la titolo estas mallerta provo traduki madikaj in¸enieroj ricevas la plej altajn salajrojn, sed simple p/a Stano Marçek, Zvolenská 15 57 .... Kalendaro tre sukan italan esprimon, kies senco estas, ke babiloj homoj, kiuj posedas komunan prudenton. Tiuj i¸as la gravuloj SK–036 01 Martin, Slovakio 60 .... Tute normala progreso II. (fino). (Claude Piron). L kostas neniom, ke ili estas libere doneblaj kaj libere en entreprenoj. Fakte superajn teknikistojn oni facile trovas , +421 43 4222 788 62 ... -
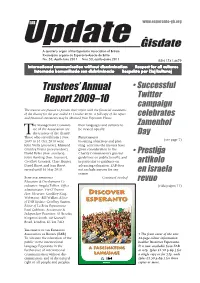
Update/No.53, 2011
UpdateEAB www.esperanto-gb.org ✩ Gisdateˆ A quarterly organ of the Esperanto Association of Britain Kvaronjara organo de Esperanto-Asocio de Britio ★ No. 53, April–June 2011 N-ro 53, aprilo–junio 2011 ISSN 1741-4679 International communication without discrimination ★ Respect for all cultures Internacia komunikado sen diskriminacio ★ Respekto por ˆiujc kulturoj Trustees’ Annual • Successful Report 2009–10 Twitter campaign The trustees are pleased to present their report with the financial statements of the charity for the year ended 31 October 2010. A full copy of the report celebrates and financial statements may be obtained from Esperanto House. he Management Commit- their languages and cultures to Zamenhof tee of the Association are be treated equally. Tthe trustees of the charity. Day Those who served from 1 Nov. PUBLIC BENEFIT 2009 to 31 Oct. 2010 were: In setting objectives and plan- (see page 7) John Wells (president), Edmund ning activities the trustees have Grimley Evans (vice-president), given consideration to the David Kelso (hon. secretary), Charity Commission’s general • Prestigˆa Joyce Bunting (hon. treasurer), guidelines on public benefit, and Geoffrey Greatrex, Clare Hunter. in particular to guidance on artikolo David Bisset and Jean Bisset advancing education. EAB does served until 16 May 2010. not exclude anyone for any en israela reason. STAFF AND APPOINTEES Continued overleaf Education & Development Co- revuo ordinator: Angela Tellier. Office (vidu pa©on 11) administrator: Viv O’Dunne. Hon. librarian: Geoffrey King. Webmaster: Bill Walker. Editor of EAB Update: Geoffrey Sutton. Editor of La Brita Esperantisto: Paul Gubbins. Accountant & Independent Examiner: N. Brooks, Kingston Smith, 60 Goswell Road, London, EC1M 7AD. -

The British Esperantist
THE BRITISH ESPERANTIST with which is incorporated “ International Language” Vol. X X X V II, No. 543/544 July/August 1950 READING BOOKS FOR YOUNG ESPERANTISTS A.B.C.-LIBRO (age: 3-7). The alphabet, each letter illustrated and with a verse by Nenio Rimanto. Printed on stout card. 1/-, post Id. ESPERANTO POR INF ANO J (age: 5-10). The adventures of a mouse family ; simple Esperanto ; many illustrations ; by G. Gladstone-Solomon (67 pp.) - - - 1/9, post 2d. JOHANO KAJ SILVIO (age : 8+). Various short everyday-life episodes about the same two children ; simple Esperanto ; by F. F. Betts (48 pp.) - - - - 1 /—, post Id. TEJO KAJ ĈERIK (age : 10+). Short stories in simple Esperanto ; illustrated ; by H. G. Toms (48 pp.) - - 1/6, post 2d. AVENTUROJ DE MARTENO DRAKE (age : 12+). Historical novel about a boy’s adventures in America in its early days as a colony; straightforward butnot simplified Esperanto (206 pp.) - - - - - cloth 5/-, post 6d. PINOKJO (age : 12+). The well known story of the adventures of a puppet ; by Collodi; illustrated (150 pp.) cloth '5/-, paper 2/6, post 4d. KNABOI DE PAŬLO-STRATO (age 12+). By the Hungarian, F. Molnar ; two gangs of children want to play in the same place ; what happens is exceedingly well told (188 pp.) 1/6, post 3d. Published by : THE ESPERANTO PUBLISHING CO. LTD. Order from : THE BRITISH ESPERANTO ASSOCIATION, INC. 140 Holland Park Avenue, London, W .ll LIBROJ VALORAJ ORIGINALA VERKARO de L. L. ZAMENHOF Kolektitaj kaj ordigitaj de D-ro JOH. DIETTERLE “No one can read these remarkable articles, prefaces, speeches, letters, and poems, without gaining a better understanding of the immense difficulties which confronted Zamenhof and the early pioneers : the ideals which inspired them, and their indomitable courage and perseverance, and without catching something of their ardent enthusiasm.”—The British Esperantist. -

Esperanto? What Is That?
Esperanto? What is that? Esperanto was proposed in the world know. Some of them 1887 as a neutral international have joined organised groups. language by Dr. L. L. Zamen- The Universal Esperanto Asso- hof, a Jewish ophthalmologist ciation (UEA = Universala Es- living in the (now Polish) west- peranto-Asocio) has members ern part of the Russian Empire. in 114 countries. The smaller His aim was to develop an eas- World Anational Association ily accessible, regular language (SAT = Sennacieca Asocio Tut- and try it out with colleagues, monda) has around 1000 mem- so that it might eventually be bers. It is a meeting-place for introduced as an international left-wing (mainly socialist, second language for everybody. anarchist and antinationalist), Zamenhof considered a neutral trade-unionist and ecologically language, one that would be- Esperanto has achieved one active Esperanto speakers. Es- long to all equally, to be not initial breakthrough: it has peranto continuously demon- only a practical matter, but a become a living language that strates its viability. It provides way to resolve conflicts and spans generations and which many practical services to its promote peace as well. tens of thousands throughout speakers. Democratic Communication on a World Scale The world dominance of just a few languages brought up lately and a response to relentless derives primarily from the power of the states capitalist globalisation from above, can only be that use them. Members of non-privileged put into practice by people who can talk to each linguistic communities communicate "uphill" other. internationally – to the extent they have a Esperanto is egalitarian. -

Archives Consultables Sur Place Arkivoj Surloke Konsulteblaj Congrès Et Événements Classés Par Pays Kongresoj Kaj Aranĝoj O
Centre de documentation et d'étude sur la langue internationale Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia CDELI, Bibliothèque de la Ville, Rue du Progrès 33, CP, CH-2303 La Chaux-de-Fonds (Suisse) www.cdeli.org Archives consultables sur place Arkivoj surloke konsulteblaj Congrès et événements classés par pays Kongresoj kaj aranĝoj ordigitaj laŭ landoj Lasta registra dato: 7-an de julio 2016 Abréviations – Mallongigoj S.l. : sans lieu = sen loko s.n. : sans nom = sen nomo s.d. : sans date = sen dato ex. : exemplaire = ekzemplero f. : feuille = folio C. : carte = karto Dépl. : dépliant = faldprospekto Br. : broché = broŝurita A : anglais = angla Ĉ : tchèque = čeĥa E : espéranto = Esperanto F : français = franca G : allemand = germana N : néerlandais = nederlanda R : russe = rusa S : suédois = sveda p. : page = paĝo Pk. : carte postale = poŝtkarto Gf : grand format = granda formato LAK/104 = congrès classés par pays = kongresoj ordigitaj laŭ landoj Codes des pays selon la norme ISO = Landaj kodoj laŭ ISO-normo : http://eo.wikipedia.org/wiki/Landaj_kodoj Exemples = ekzemploj : LAK/104/AT : Autriche = Aŭstrio ; LAK/104/AU : Australie = Aŭstralio LAK/104 Congrès classés par pays = Kongresoj ordigitaj laŭ landoj Argentino (AR) LAK/104/AR-1951-1 Sexto congreso argentino de Esperanto. Necochea : [Loka kongresa komitato], 1951. [1] f. 34 x 18 cm LAK/104/AR-1952-1 VIIo Congreso Argentino de Esperanto. Villa María : Biblioteca Bernardino Rivadavia, [ca 1952]. [2] p. 15 x 20 cm LAK/104/AR-1961-1 11-a Congreso Argentino de Esperanto.Rosario : [Loka kongresa komitato], 1961. Pk. [1] f. 11 x 18 cm LAK/104/AR-1968-1 14-a Jarkunveno de Argentina Esperanta Ligo kaj 2-a Junulara Argentina Esperanta Kongreso. -
Of Revolutionaries and Geeks
OF REVOLUTIONARIES AND GEEKS MEDIATION, SPACE AND TIME AMONG ESPERANTO SPEAKERS A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities 2019 GUILHERME MOREIRA FIANS Department of Social Anthropology | School of Social Sciences This page intentionally left blank 2 „Not all people exist in the same Now‟ Ernst Bloch (1990 [1962]: 97) „We‟re not as numerous as we wanted, but we‟re more than you can imagine‟ Ĵak Le Puil, Esperantist from Île-de-France, 2017 3 This page intentionally left blank 4 TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES ................................................................................................................. 7 GLOSSARY AND ACRONYMS ......................................................................................... 10 ABSTRACT ........................................................................................................................... 13 RESUMO (ABSTRACT IN ESPERANTO) ......................................................................... 14 DECLARATION ................................................................................................................... 15 COPYRIGHT STATEMENT ................................................................................................ 15 ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................... 18 INTRODUCTION, OR WHERE TO BEGIN? ..................................................................... 22 In the beginning -

Katalogotaj Libroj (RERO)
Katalogotaj libroj Libroj kaj broŝuroj provizore registritaj ĝis kiam ili eniros la RERO-katalogon. Situacio je 27-08-2020 A. Aaen, J.C. Laesebog i Schleyers verdenssprog Volapük. Aalborg, 1887. Li Vol 41. Aalst, Jules A. van. The universal language or Volapük containing… Amoy, 1888. Li Vol 1. ABC's of Esperanto, The. El Cerrito, 1986. ESP 5677. 'Abd al-Baha Ibn Baha Allah. Mesaĝo de 'Abdu'l-Baha. Frankfurt a.M., 1964. ESP 3953 + Li SES 646 + ESP-P 2188. 'Abd al-Baha Ibn Baha Allah. Parizaj Paroladoj de 'Abdu'l-Baha. Berno, 1978. ESP 4226 + ESP 4226b. Abdu'l-Baha. La Bahaa revelacio + La eklumiĝo de la nova tago... New York City. [s.d.]. ESP/Br 1484. Academia pro Interlingua (Torino). Fundamento de Esperanto: publicto cum commentario. Cavoretto-Torino, 1914. 15p. Li HJ 1319 + b. Academia pro Interlingua (Torino).Glossario internationale non latino classico: (Supplemento ad Vocabulario Commune de G. Peano) cum praefatione et commenrios de Ugo Cassina. Milano, 1936. Schola et Vita. Li AS 58. Academia pro Interlingua. 8p. [1921] Li AM 276. Academia pro Interlingua. Torino. Historia de Academia. Statuto de Academia- Torino. [mars 1923] Li AM 275 + Li HJ 1317 + ESP-P 5863. Academia pro Interlingua (Torino). Socios de "Academia pro Interlingua". Torino, 1912. 8p. Li HJ 1322. Abegg, Max. Raporto pri la prelegvojaĝo tra Svislando de… Zürich, 1959. 59p. Li SES 494. Abeloj, La. Udine, 1984. 22p. ESP 3637. About Esperanto. Greenfield, 1972. Channing L. Bete, 15p. ESP/Br 1727. Abraham, Georgo. Klara Vortaro Esperanto-Araba. Rotterdam, 1998. 301p. ESP 7232. Abrill, R.G. -
Esperanto? What Is That?
Esperanto? What is that? Esperanto was proposed but a way to resolve con- ist), trade-unionist and eco- in 1887 as a neutral inter- flicts and promote peace logically active Esperanto national language by Dr. as well. speakers. Esperanto con- L. L. Zamenhof, a Jewish Esperanto has actually tinuously demonstrates its ophthalmologist living in achieved one initial break- viability. It provides many the (now Polish) western through: it has become a practical services to its part of the Russian Empire. living language that spans speakers. His aim was to develop an generations and which easily accessible, regular hundreds of thousands language and try it out with throughout the world have colleagues, so that it might learned. Some of them eventually be introduced as have joined organised an international second lan- groups. The largest world- guage for everybody. Such a wide Esperanto organi- language is usually called a sation (UEA=Universala "constructed" (sometimes Esperanto-Asocio) has "artificial" or "auxiliary") 18,002 members in 114 language. It is neutral in the countries (2004). The smal- sense that it is not associ- ler World Anational Asso- ated with a particular coun- ciation SAT (=Sennacieca try or nationality. Zamen- Asocio Tutmonda) has hof considered a neutral around 1000 members. It language, one that would is a meeting place for left- belong to all equally, to be wing (mainly socialist, an- not only a practical matter, archist and antinational- Language for the World or Language for a Voluntary Speech Community? For the past two decades or so, some would be disadvantaged by the choice of speakers of Esperanto have been disputing language would never acquiesce to being about whether the classical aim to have discriminated in such a manner. -

The British Esperantist
THE BRITISH ESPERANTIST with which is incorporated “ International Language ” 47th Year, No. 554 June 1951 Kredu min, sinjorino! de CEZARO ROSSETTI Romano originals verkita en Esperanto Pli ol 250 paĝoj. Kun portreto de la aŭtoro Prezo : 10s. 6p. Afranko 6p. La plej originala Esperanta romano aperinta ĝis nun. Cezaro Rossetti, Skota samideano devenanta el la itallingva parto de Svislando, rakontas en ĉi tiu libro multnombrajn epizodojn el sia aventurriĉa vivo kiel eksponisto, epizodojn jen seriozajn, jen amuzajn, jen eĉ iom frivolajn. Lia parolo estas rekta, sincera, senŝminka, lia esprimmaniero originala, lia stilo brila. Nia fama Raymond Schwartz skribis por la libro la enkondukajn vortojn. Mendu ĉe B.E.A., 140, Holland Park Avenue, London, W .ll STRANGA RETORIKO kun aparta konsidero al HEREDAĴO la Esperanta Parolarto Romano originale Originate verkita de verkita de Doktoro Ivo LAPENNA Universitata Profesoro H. A. LUYKEN, F.B.E.A. After Vallienne, Luyken was the ENHAVO laŭ la ĉapitroj : first Esperantist writer to produce Unua parto : LA LINGVO full-size original romances in I Enkonduko. Esperanto. His four works— II Ekesto de la lingvo. Paŭlo Debenham (1911), fflirinda III Faktoroj influantaj la Amo (1913) —both now out of lingvo-evoluon. print—Stranga Heredaĵo (1922), IV Formiĝo de grandaj and Pro Iŝtar (1924) are out komunaj lingvoj. standing landmarks in the V Lingvo kaj penso. history of Esperanto Literature. From reviews of “STRANGA Dua parto : RETORIKO HEREDAĴO” in 1922:— VI Elokventeco kaj retoriko. “The British Esperantist”—"La tuta VII Fizikaj ecoj de la oratoro. libro estas minejo de trafaj esprimoj, VIII Intelektaj ecoj de la oratoro. -

Auld Collection: Monographs
AULD COLLECTION: MONOGRAPHS The shelfmark, the reference identifying a particular item, is to be found at the start of each entry. When ordering a book, please prefix this with ‘Auld.’ to get the full shelfmark. E.g. the first item should be ordered as ‘Auld.527’. 527Bibliografioj. Katalogoj Alfabeta katalogo pri la kolektoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien. Parto I, A-L. Verkita de Hugo Steiner. IEMW, Vieno, 1969. 462p. bind. 528Bibliografioj. Katalogoj Alfabeta katalogo pri la kolektoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien. Parto II, M-Z. Kompilita de Walter Hube kaj Herbert März. IEMW, Vieno, 1975. 378p. bind. c(2)Bibliografioj. Katalogoj Asahiga, N. kaj Mine, Y. Literaturo en Japana Esperanto-Movado (LJEM) 1946-1972. Esperanto-Propaganda Asocio 1973. 16p. bros. 8H(1)Bibliografioj. Katalogoj Auld, William. Esperanto-eldonaĵoj 1945-1959. 63p. fotokopio c(1)Bibliografioj. Katalogoj Auld, William. Indekso de tradukitaj poemoj publikigitaj en literatura mondo, la Nica Literatura Revuo, monda kulturo kaj norda prismo. La kompilinto, 1979. 25p. bros. manuskripto d(1)Bibliografioj. Katalogoj Bednarz, Irena. Bibliografio de la Esperanto-eldonaĵoj aperigitaj en Pollando 1945-1979. Romo-Varsovio, 1979. 29p. bros. c(3)Bibliografioj. Katalogoj Bibliografia de interlingua. Servicio de Libros U.M.I., Beekbergen, Nederlando. Edition januario 1980 - numero 7. 24p. bros. 5v(19)Bibliografioj. Katalogoj Bibliografio de Japana literaturo tradukita en Esperanto. La 43a Kongreso de Japanaj Esperantistoj por 50jara Jubileo de Japana Esperanto- Movado 1956. 21p. bros. c(4)Bibliografioj. Katalogoj Bibliografio de la franclingvaj tekstoj tradukitaj al Esperanto. Franca Esperantisto Aŭgusto, 1987. 56p. bros. c(5)Bibliografioj. Katalogoj Bibliografio de la publikaĵoj de Reinhard Haupenthal, 1962-1972. -

Update/No.48, 2010
UpdateEAB www.esperanto-gb.org ✩ Gisdateˆ A quarterly organ of the Esperanto Association of Britain Kvaronjara organo de Esperanto-Asocio de Britio ★ No. 48, January–March 2010 N-ro 48, januaro–marto 2010 ISSN 1741-4679 International communication without discrimination ★ Respect for all cultures Internacia komunikado sen diskriminacio ★ Respekto por cˆiuj kulturoj New beginning for Bonegan cooperation with Novan Jaron! Liverpool University? • Next year’s n 19 November Prof. Wim Jansen – Special 50th anniver- OProfessor of Interlinguis- tics and Esperanto in the Univer- sity of Amsterdam – delivered sary of the this year’s Buchanan Lecture in the University of Liverpool. The Esperanto subject of the open lecture was “’Our Language’ – Why language- Good attendance ‘Somera users identify with a language: Esperanto-speakers from across the case of Esperanto”. It was the country attended the lecture. held in the university’s modern The question remained how Festivalo’ Management School, opened many other people would turn in 2003. up. In the event some twenty in Barlaston The event was jointly organ- members of the university came ised by the EAB and the Univer- to listen to the lecture, which is (see page 4) sity of Liverpool. The latter had a satisfactory number for such promoted the lecture through its an event. own channels. Continued overleaf • Surveillance of the Esperanto movement by the British secret services (see page 5) EAB-Ìisdate • 1 EDUKO KAJ ESPLORADO EDUCATION AND RESEARCH Erudite and interesting knowledge of linguistics but also Head of the School of Cultures, Prof. Jansen was introduced by knowledge from his long career Language and Area Studies, Prof.