Bettmeralp Wallis 2 Zur Begrüssung 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Price-Martin-F ... Rockies and Swiss Alps.Pdf
Price, Martin Francis (Ph.D., Geography) Mountain forests as common-property resources: management policies and their outcomes in the Colorado Rockies and the Swiss Alps. Thesis directed by Professor Jack D. Ives This is a historical, comparative study of the development, implementation, and results of policies for managing the forests of the Colorado Rockies and the Swiss Alps, with emphasis on two study areas in each region. The Pikes Peak (Colorado) and Davos (Switzerland) areas have been adjacent to regional urban centers since the late 19th century. The Summit (Colorado) and Aletsch (Switzerland) areas have experienced a rapid change from a resource-based to a tourism-based economy since the 1950s. The study's theoretical basis is that of common-property resources. Three primary outputs of the forests are considered: wood, recreation, and protection. The latter includes both the protection of watersheds and the protection of infrastructure and settlements from natural hazards. Forest management policies date back to the 13th century in Switzerland and the late 19th century in Colorado, but were generally unsuccessful in achieving their objectives. In the late 19th century, the early foresters in each region succeeded in placing the protection of mountain forests on regional, and then national, political agendas. In consequence, by the beginning of the 20th century, federal policies were in place to ensure the continued provision of the primary functions of the forests recognized at that time: protection and timber supply. During the 20th century, these policies have been expanded, with increasing emphasis on the provision of public goods. However, most policies have been reactive, not proactive. -

Das Neue Kurtaxenreglement Kurz Erklärt
Eine Informationsbroschüre der Gemeinden Bettmeralp, Fiesch, Fieschertal, Lax, Mörel-Filet und Riederalp Das neue Kurtaxenreglement kurz erklärt Ausgabe für die Gemeinde Riederalp Ein Baustein für den Gast von heute und die Destination von morgen Sehr geehrte Damen und Herren Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass wir als Destination unsere Zukunft selbst gestalten können. Das müssen wir, denn unsere Gäste werden zu Recht anspruchsvoller: Sie wollen ein umfangreiches Angebot, das doch einfach ist und vor allem aus einer Hand stammt. Sie wollen zunehmend digitale Angebote, die auf Knopfdruck verfügbar sind. Die Grundlage dafür legt unter anderem das neue Kurtaxen reglement, über das wir demnächst abstimmen. Wir stellen es Ihnen auf den folgenden Seiten vor und erläutern, wie es in unseren Augen die Aletsch Arena fit für die Zukunft macht. Unsere Destination hat bereits Beachtliches vollbracht. Wir haben, gestützt durch die Bevölkerung, drei Bergbahnunternehmen fusioniert und eine neue Destination gegründet. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in Jahren, die wirtschaftlich nicht die einfachsten sind. Doch es zeigt, dass wir eine starke Destination sind, und als solche wollen wir uns weiterentwickeln – und eine lebendige Aletsch Arena bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung des neuen Kurtaxenreglements! Die Gemeindepräsidenten der Aletsch Arena: Alban Albrecht, Peter Albrecht, Peter Baehler, Iwan Eyholzer, Marco Imhasly, Bernhard Schwestermann Inhalt Die neuen Leistungen der e-Gästekarte Aletsch 4 Die vereinfachte Funktionsweise 6 Tarife und Finanzierungen 8 Das neue Kurtaxenreglement für die Gemeinde Riederalp 10 Nächste Schritte 14 2 Die drei Bestandteile des neuen Kurtaxenreglements e-Gästekarte Aletsch Jeder Übernachtungsgast hat Anspruch auf eine digitale Gäste- karte. Sie bietet umfangreiche Angebote: im Sommer zum Beispiel sämtliche Berg- und Sportbahnen – und das vom Tag der Anreise an. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Switzerland 8
©Lonely Planet Publications Pty Ltd Switzerland Basel & Aargau Northeastern (p213) Zürich (p228) Switzerland (p248) Liechtenstein Mittelland (p296) (p95) Central Switzerland Fribourg, (p190) Neuchâtel & Jura (p77) Bernese Graubünden Lake Geneva (p266) & Vaud Oberland (p56) (p109) Ticino (p169) Geneva Valais (p40) (p139) THIS EDITION WRITTEN AND RESEARCHED BY Nicola Williams, Kerry Christiani, Gregor Clark, Sally O’Brien PLAN YOUR TRIP ON THE ROAD Welcome to GENEVA . 40 BERNESE Switzerland . 4 OBERLAND . 109 Switzerland Map . .. 6 LAKE GENEVA & Interlaken . 111 Switzerland’s Top 15 . 8 VAUD . 56 Schynige Platte . 116 Lausanne . 58 St Beatus-Höhlen . 116 Need to Know . 16 La Côte . .. 66 Jungfrau Region . 116 What’s New . 18 Lavaux Wine Region . 68 Grindelwald . 116 If You Like… . 19 Swiss Riviera . 70 Kleine Scheidegg . 123 Jungfraujoch . 123 Month by Month . 21 Vevey . 70 Around Vevey . 72 Lauterbrunnen . 124 Itineraries . 23 Montreux . 72 Wengen . 125 Outdoor Switzerland . 27 Northwestern Vaud . 74 Stechelberg . 126 Regions at a Glance . 36 Yverdon-Les-Bains . 74 Mürren . 126 The Vaud Alps . 74 Gimmelwald . 128 Leysin . 75 Schilthorn . 128 Les Diablerets . 75 The Lakes . 128 Villars & Gryon . 76 Thun . 129 ANDREAS STRAUSS/GETTY IMAGES © IMAGES STRAUSS/GETTY ANDREAS Pays d’Enhaut . 76 Spiez . 131 Brienz . 132 FRIBOURG, NEUCHÂTEL East Bernese & JURA . 77 Oberland . 133 Meiringen . 133 Canton de Fribourg . 78 West Bernese Fribourg . 79 Oberland . 135 Murten . 84 Kandersteg . 135 Around Murten . 85 Gstaad . 137 Gruyères . 86 Charmey . 87 VALAIS . 139 LAGO DI LUGANO P180 Canton de Neuchâtel . 88 Lower Valais . 142 Neuchâtel . 88 Martigny . 142 Montagnes Verbier . 145 CHRISTIAN KOBER/GETTY IMAGES © IMAGES KOBER/GETTY CHRISTIAN Neuchâteloises . -

Media Trip - Back to Nature
Media Trip - Back to nature Resorts: Aletsch Arena and Val d’Hérens Dates: Sunday 12th to Thursday 16th August 2018 (5 days, 4 nights) Participants: max 10 journalists Highlights: Hiking to the Great Aletsch Glacier, introduction to yodelling, photographing stars on the Bettmerhorn, Europe’s first hotel built of straw, Green Mobility in the Val d’Hérens, “anakolodge” hamlet of renovated barns, Herens cows, alpine cheese-making, summer fair in Evolène. www.visitvalais.ch VALAIS/WALLIS PROMOTION Aletsch Arena Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: that’s the title under which the largest glacier in the Alps appears in UNESCO’s list of World Heritage Sites. Nearby, the villages in the valley and the three car- free resorts up on the alpine pastures radiate a special charm with their traditional houses, typical of Valais, their wooden chalets and atmospheric hotels. The three resorts of Fiescheralp, Bettmeralp and Riederalp bask in the sunshine, midway between the valley and the sky. Six cable cars carry visitors from the Rhône valley up to an altitude of about 2,000 m to access these resorts and the idyllic hiking trails of the Aletsch region. Other chairlifts and cable cars carry guests higher still, to panoramic vantage points such as the Eggishorn (2,927m), which offers one of the finest views of the Aletsch and Fiesch glaciers. www.aletscharena.ch Interview possibilities - Aletsch Arena: - Markus Eichenberger, photographer and expert in time-lapse photographs - Monique Martig, qualified breathing therapist (German- and French-speaking) - Manuela Lehner-Mutter, conductor of the Jodelclub-Riederalp choir - Stefan Eyholzer, manager of Restaurant Bättmer Hitta and owner of Herens cows Val d’Hérens The Val d’Hérens extends from the Rhône Valley near Sion to the foot of a string of snow- capped peaks including the Dent Blanche, Dent d’Hérens, Mont Collon and Mont Blanc de Cheilon. -

Bettmeralp Vs
BETTMERALP VS PANORAMAWANDERUNG AM ALETSCHGLETSCHER EIN GEHEIMTIPP IST DIESE WANDERUNG MITTEN Zu Beginn liegt der Gletscher noch gute 600 Höhenmeter IM UNESCO-WELTERBE «SCHWEIZER ALPEN unterhalb des Wanderwegs. In den nächsten anderthalb JUNGFRAU-ALETSCH» KAUM. DAFÜR DIE VIELLEICHT Stunden bietet die Wanderung einen überwältigenden SCHÖNSTE TAGESWANDERUNG DER SCHWEIZ. Blick auf die vergletscherte Arena. Der Weg verläuft leicht abfallend entlang der Nordflanken des Bettmer- und Eggis- Ausgangspunkt dieser spektakulären Panoramawande- horns. Über grosse Steinplatten und auf in Fels gehauenen rung bildet die Bergstation der Gondelbahn Bettmerhorn Wegen nähert man sich mit jedem einzelnen Schritt dem auf stattlichen 2647 Metern über Meer. Nicht selten liegt Gletscher. Trittsicherheit und ein Minimum an Schwindel- hier bis in die Sommermonate Schnee und der Wanderweg freiheit sind die Voraussetzungen für eine genussvolle bleibt gesperrt. Deshalb gilt es, die örtlichen Verhältnisse Tour entlang des Aletschgletschers. abzuklären, bevor die Wanderschuhe geschnürt werden. Durch die mit Landkartenflechten bewachsenen Block- felder verläuft der Weg über die Roti Chumma weiter Keine zwei Gehminuten nach dem Start führt der Weg zu Richtung Märjelensee. Während man sich in der Senke einer ersten Aussichtsterrasse. In voller Pracht präsentiert zwischen Eggishorn und Strahlhorn einst in der Arktis sich hier der längste und mächtigste Eisstrom der Alpen – wähnte, ist heute kaum noch etwas des ehemals 80 Meter der 23 Kilometer lange Grosse Aletschgletscher. Mit tiefen Gletscherrandsees zu sehen. Noch vor weniger als ihm zeigt sich das fantastische Panorama der Berner und 100 Jahren schwammen haushohe Eisblöcke auf dem tief- Walliser Alpen. Eindrücklich bahnen sich die blauen Wasser. 27 Millionen Tonnen Eis von der Jungfrauregion hinunter Beinahe etwas wehmütig verlässt man die Gletscherwelt in die Massaschlucht. -

G Rosser Al Et Schgl Etscher
EN IT Bietschhorn Breithorn Nesthorn Schinhorn Sattelhorn Aletschhorn Jungfrau Jungfraujoch Mönch Eiger Fiescherhörner Finsteraarhorn Oberaarhorn 3934 m 3785 m 3822 m 3797 m 3745 m 4193 m 4158 m 3454 m 4107 m 3970 m 4049 m 4274 m 3637 m Grosses Wannenhorn Dreieckhorn 3905 m FEELINFORMATION CABLEWAYS FREE SUMMER 2015 3810 m INFOS IMPIANTI DI RISALITA ESTATE 2015 Geisshorn 3740 m Finsteraarhornhütte (SAC) Hohstock 3048 m Unterbächhorn 3226 m Grosses Fusshorn Konkordiahütten (SAC) 3554 m Zenbächenhorn 2850 m - 3626 m Konkordiaplatz Wasenhorn B e i h 3386 m Kleines Wannenhorn c h s c 3706 m 3447 m - l e t Olmenhorn r a r Rothorn 3314 m Grisighorn O b e e Sparrhorn n 3271 m 3177 m Oberaletschhütte (SAC) r 3021 m ö 2640 m h G s l s Strahlhorn e u t 3050 m s F c r r h e e Setzehorn e h h 3061 m 2730 m r c Platta c Hohbiel, 2664 m t s 2380 m s e t Täschehorn l l e h g g Tyndalldenkmal s c e r 3008 m 2351 m e t Eggishorn c h Risihorn l e s Roti Seewe A 2926 m Märjelensee F i 2876 m e r 360° Panoramarundsicht Gletscherstube Märjelewang 2680 m Bergstation Eggishorn, 2869 m 2302 m 2346 m Lengsee Lüsgasee NEW: s Vordersee Bruchegg s 2706 m Brusee Lüsga aletscharena.ch/project_moosfluh o Roti Chumme Gletscherblick 2130 m r 2369 m 2615 m NOUVO: Tällisee Belalp, 2094 m 2124 m Wirbulsee 2724 m 2130 m aletscharena.ch/progetto_moosfluh G Bettmerhorn Tälligrat Rinnerhitta UNESC anoramaweg 2653 m Hotel Belalp O-P 2858 m 2610 m UNESCO Elsenlücke 2386 m 1931 m Furggulti-Berg, 2560 m Mittelsee Üssers Aletschji 2722 m Höhenweg n 2549 m Bäll 1756 m r 2625 m Hängebrücke -

PDF Download
St. Niklaus Telefon 027 956 13 60 www.walchmaschinen.ch www.bodentraum.ch Nr. 01 – Donnerstag, 15. Januar 2015 | Telefon 027 922 29 11 | www.rz-online.ch | Auflage 39 601 Ex. REGION Kein Impfzwang Auch wenn einige Experten es empfeh- len: Ein Impfobligatorium ist für Walliser Spitalangestellte kein Thema. Seite 3 ZERMATT/BRIG-GLIS Kinderbetreuung Im Oberwallis fehlt es an Tagesmüttern. Mehr zum alternativen Betreuungsan- gebot auf Seite 4/5 ALETSCH Gemeinde Aletsch Die Tourismus-Gemeinden im Bezirk Östlich Raron streben eine Grossfusion an. Das sagen die Beteiligten. Seite 9 FRONTAL (Symbolbild: Zaubervogel/pixelio.de) Der Vermarkter Damian Constantin, Direktor von Valais/ Wallis Promotion, ist seit 500 Tagen im Werden Hunde ausgebeutet? Amt und zieht Bilanz. Seite 24/25 SPORT Zermatt Tierschützer kritisieren vehement die Haltungsbedingungen von Bernhar- Silvan Zurbriggen dinern für Fotoshootings. Für ein schönes Foto müssten die Tiere stundenlang lei- Der Walliser Abfahrer gehört beim Ren- den. Die Folge sind entzündete Augen und ein gestörtes Verhalten. Mehr zur Kritik nen am Lauberhorn zu den Schweizer des Tierschutzes an den «Foto-Hunden» auf Seite 11 Hoffnungsträgern. Seite 27 GROSSE ZERZUBEN-FRÜHLINGS- JETZT BUCHEN! Wir verlegen KREUZFAHRT 027 948 15 15 Ihre Wünsche ab CHF KERAMIK PRO PERSON 999.– WELT 8 Tage 23. BIS 30. MAI 2015 2\UKLUWSH[[LUSLNLY Ihr Reisebegleiter Elmar Truffer NEUSTES SCHIFF Marco Zerzuben Zeughausstrasse 41 MSC PREZIOSA 3902 Glis [email protected] Genua – Rom – Palermo – Tunis – Palma de Mallorca – Valencia – Marseille – Genua www.zerzuben.com www.keramikwelt-truffer.ch Tel. 079 307 19 68 NOTFALLDIENST (SA/SO) NOTFALL Schwere Notfälle 144 Medizinischer Rat 0900 144 033 ÄRZTE Brig-Glis / Naters / Östlich Raron Infoveranstaltungen 0900 144 033 zu unseren Lehrgängen Grächen / St. -
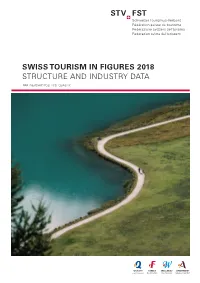
Swiss Tourism in Figures 2018 Structure and Industry Data
SWISS TOURISM IN FIGURES 2018 STRUCTURE AND INDUSTRY DATA PARTNERSHIP. POLITICS. QUALITY. Edited by Swiss Tourism Federation (STF) In cooperation with GastroSuisse | Public Transport Association | Swiss Cableways | Swiss Federal Statistical Office (SFSO) | Swiss Hiking Trail Federation | Switzerland Tourism (ST) | SwitzerlandMobility Imprint Production: Martina Bieler, STF | Photo: Silvaplana/GR (© @anneeeck, Les Others) | Print: Länggass Druck AG, 3000 Bern The brochure contains the latest figures available at the time of printing. It is also obtainable on www.stv-fst.ch/stiz. Bern, July 2019 3 CONTENTS AT A GLANCE 4 LEGAL BASES 5 TOURIST REGIONS 7 Tourism – AN IMPORTANT SECTOR OF THE ECONOMY 8 TRAVEL BEHAVIOUR OF THE SWISS RESIDENT POPULATION 14 ACCOMMODATION SECTOR 16 HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY 29 TOURISM INFRASTRUCTURE 34 FORMAL EDUCATION 47 INTERNATIONAL 49 QUALITY PROMOTION 51 TOURISM ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 55 4 AT A GLANCE CHF 44.7 billion 1 total revenue generated by Swiss tourism 28 555 km public transportation network 25 497 train stations and stops 57 554 795 air passengers 471 872 flights CHF 18.7 billion 1 gross value added 28 985 hotel and restaurant establishments 7845 trainees CHF 16.6 billion 2 revenue from foreign tourists in Switzerland CHF 17.9 billion 2 outlays by Swiss tourists abroad 175 489 full-time equivalents 1 38 806 777 hotel overnight stays average stay = 2.0 nights 4765 hotels and health establishments 274 792 hotel beds One of the largest export industries in Switzerland 4.4 % of export revenue -

FAMILIEN WILLKOMMEN Salü Liebe Kinder Und Liebe Erwachsene!
DE FAMILIEN WILLKOMMEN Salü liebe Kinder und liebe Erwachsene! Mein Name ist Gletschi. Ich bin ein Gletscherfloh und lebe hier in der Aletsch Arena zwischen Eis und Schnee. Im Unterschied zu meinen 29 dunkelfar- bigen Geschwistern habe ich flauschiges, eisblaues Fell. Und eine rote Nase. Manchmal ist es ganz schön nervig, so anders auszusehen, aber auch oft lustig und erlebnisreich. Zum Dank für mein Aussehen muss ich Menschen, die auf den Berg kom- men und trotzdem nicht fröhlich werden, im Ohr kitzeln. Bis sie lachen. Viel- leicht habt ihr ja Lust, mir dabei zu helfen? Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Aletsch Arena treffen könnten. Vielleicht erleben wir dann ge- meinsam ein lustiges Abenteuer? Ich habe euch in dieser Broschüre schon mal ein paar Tipps zusammenge- stellt, was ihr in meiner Heimat so alles unternehmen könnt. Dann wünsch ich euch viel Spass beim Abenteuer zusammenstellen. 2 Inhaltsverzeichnis Familien willkommen 4 Notfallnummern 7 Mietservice für Kinderartikel 8 Bibliothek / Ludothek 9 Sommererlebnisse Kinderwagengerechte Wanderwege 10 Kinderspielplätze 1 1 Feuerstellen 12 Gletschi-Familienpauschale 12 Abenteuer und Sport im Sommer Gletschi-Programm 13 Gletschertouren 13 Klettersteig Eggishorn 13 Seilparks 13 Kinderklettern 14 Trottinettes 15 Minigolf 15 Tierpark Aletsch 16 Lama-Trekking 16 Erlebnis Wasser 16 Gleitschirm-Passagierflüge / Kids-Flight 1 7 Themenwege 18 Abfälle in der Natur 22 Wintererlebnisse Skiunterricht 23 Familienermässigung Skipass 23 Kinderbetreuung 23 Gletschi-Programm 25 Gletschi-Familienpauschale -

Valais – Highlights of the Swiss Alps
Valais – Highlights of the Swiss Alps Naturetrek Tour Itinerary Outline itinerary Day 1 Fly Geneva and transfer by train and cable car to Bettmeralp Day 2/7 Natural history excursions from Bettmeralp Day 8 Transfer to Geneva and fly London Departs June/July Focus Alpine flowers, birds, butterflies, stunning mountain scenery and other natural history Grading Grade B – walks generally over undulating ground, or downhill. See grading section for further information. Dates and Prices Visit www.naturetrek.co.uk (tour code CHE04) or see the current Naturetrek brochure. Highlights: Spectacular mountain scenery of Valais and the Swiss Alps, with all travel by train or mountain lift! Stay in a family run hotel with beautiful mountain views Enjoy carpets of flowering bellflowers, primroses, gentians & other alpines Follow the famous Glacier Express line to Zermatt and the Gornergrat Birds including Alpine Chough, Alpine Accentor, Snow Finch, Nutcracker and Red-backed Shrike all likely From top: Aletsch Glacier (Kerrie Porteous), Alpine Toadflax Linaria alpina (Kerrie Porteous), Alpine Accentor (Martin Palanek) Naturetrek Mingledown Barn Wolf’s Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T:+44 (0)1962 733051 E:[email protected] W:www.naturetrek.co.uk Valais – Highlights of the Swiss Alps Tour Itinerary Introduction The Swiss canton of Valais lies in the heart of the Alps and is home to some of the most spectacular mountain scenery in Europe. The charming, traffic-free village of Bettmeralp will be our base for this new single- centre holiday, where — from our family-run hotel — we will explore the beautiful forests, valleys and high peaks in search of the region’s varied wildlife. -

Rundwandertickets Und Teilretouren
Grösster Gletscher der Alpen Unnerwägs iner Aletsch Arena RUNDWANDERTICKETS UND TEILRETOUREN Preise in CHF inklusive 7.7% MwST Kinder unter 6 Jahren fahren auf allen Anlagen kostenlos. Die Junior-Karte und die Kinder-Mitfahrkarte sind im Sommer auf allen Anlagen gültig. Das Generalabonnement (GA) die Tageskarte SBB, Juniorkarte und die Kinder-Mitfahrkarte der SBB sind auf den Zubringerbahnen gültig. Rundwandertickets Strecke Erwachsene Ermässigt Ab 16 Jahren Halbtax Kind 6 – 15 Jahre Swiss Travel Pass Hunde Massaweg 13.40 6.70 MGBahn Mörel – Brig Postauto Brig – Blatten b. Naters Gondelbahn Ried-Mörel – Mörel Massaweg 21.20 10.60 Gondelbahn Riederalp – Mörel MGBahn Mörel – Brig Postauto Brig – Blatten b. Naters Gondelbahn Ried-Mörel - Riederalp Hängebrücke Belalp – Riederalp 28.20 14.10 Postauto Brig – Blatten b. Naters Zugfahrt Fiesch – Brig (oder umgekehrt) Gondelbahn Blatten – Belalp Bergbahnfahrt Aletsch Bahnen (Zubringer) Teilretouren Erwachsene Kinder Ermässigt Gästekarte Ab 16 Jahren 6 – 15 Jahre Halbtax Brig-Belalp-Aletsch- Hunde Goms Swiss Travel Pass Strecke Erwachsene Kinder 6-16 J. Betten Tal – Bettmerhorn 37.80 18.90 18.90 34.30 17.20 Retour ab Bettmeralp Betten Tal – Bettmerhorn 46.20 23.10 23.10 41.10 20.60 Retour ab Wurzenbord Bettmeralp – Bettmerhorn 29.80 14.90 14.90 23.90 12.00 Wurzenbord – Bettmeralp Fiesch – Eggishorn 45.20 22.60 22.60 41.80 20.90 Retour ab Fiescheralp Mörel – Hohfluh / Moosfluh 37.80 18.90 18.90 34.30 17.20 Retour ab Riederalp Ried-Mörel /Greich – Moos-Hohfluh 31.80 15.90 15.90 27.60 13.80 Retour ab Riederalp Aletsch Bahnen AG | Hauptstrasse 12 | CH-3992 Bettmeralp | +41 27 928 41 41 | [email protected] | aletscharena.ch Grösster Gletscher der Alpen Gruppentarife Gruppenpreise gelten für Gruppen ab 10 Personen.