Vorlage – Zur Beschlussfassung –
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Design Competition Brief
Design Competition Brief The Museum of the 20th Century Berlin, June 2016 Publishing data Design competition brief compiled by: ARGE WBW-M20 Schindler Friede Architekten, Salomon Schindler a:dks mainz berlin, Marc Steinmetz On behalf of: Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) Von-der-Heydt-Straße 16-18 10785 Berlin Date / as of: 24/06/2016 Design Competition Brief The Museum of the 20th Century Part A Competition procedure ..............................................................................5 A.1 Occasion and objective .......................................................................................... 6 A.2 Parties involved in the procedure ........................................................................... 8 A.3 Competition procedure .......................................................................................... 9 A.4 Eligibility ............................................................................................................... 11 A.5 Jury, appraisers, preliminary review ...................................................................... 15 A.6 Competition documents ....................................................................................... 17 A.7 Submission requirements ...................................................................................... 18 A.8 Queries ................................................................................................................. 20 A.9 Submission of competition entries and preliminary review ................................. -

Seite 1 Von 75 Bauantragsliste 2017 Aktenzeichen Strasse Nr. Vorhaben
Bauantragsliste 2017 Aktenzeichen Strasse Nr. Vorhaben Status 1100-2017- Wiesenstra- 21 - Neubau eines Wohngebäu- Eing.:03.01.2017 18-Stadt(11)2 ße 23 des mit Kindertagesstätte Start:04.01.2017 502 und Tiefgarage Dat.Ab.:05.04.2017 1100-2017- Gertrauden- 18 - Erweiterung und Umstruktu- Eing.:31.01.2017 568- straße 20 rierung des Erdgeschosses Start:01.02.2017 Stadt(11)2 des Bestandsgebäudes Ger- Dat.Ab.:13.06.2017 504 traudenstraße 18-20 in 10178 Berlin-Mitte 100-2017- Holzmarkt- 66 Errichtung Wohn- und Ge- Eing.:02.02.2017 916- straße schäftshaus Start:01.03.2017 Stadt(11)2 200 1100-2017- Köpenicker 104 Errichtung, Neubau Wohn- Eing.:16.02.2017 925- Straße hochhaus und Flachbau Start:20.02.2017 Stadt(11)2 200 1100-2017- Körnerstraße 23 Aufstockung über 2 Ge- Eing.:23.02.2017 1000- schosse Start:24.02.2017 Stadt(11)2 Dat.Ab.:25.10.2017 402 1100-2017- Tuch- 37 Änderung und Nutzungsän- Eing.:28.02.2017 1095- olskystraße derung Dachgeschoss Start:01.03.2017 Ab- Stadt(11)2 sch.:20.06.2017 205 Dat.Ab.:20.06.2017 1100-2017- Karl- 29 Errichtung, Änderung Rück- Eing.:28.02.2017 1176- Liebknecht- bau und Neubau entlang der Start:06.03.2017 Ab- Stadt(11)2 Straße Hirtenstraße und der Kleinen sch.:03.08.2018 509 Alexanderstraße Dat.Ab.:21.08.2017 1100-2017- Koloniestra- 106 Neubau eines Gemeinde- Eing.:02.03.2017 1153- ße und Kulturzentrums (Mo- Start:06.03.2017 Ab- Stadt(11)2 schee) sch.:15.03.2017 406 Abriss vorhandener Gebäude Dat.Ab.:15.03.2017 1100-2017- Soldiner 34 Errichtung des im 2. -

The Acoustic City
The Acoustic City The Acoustic City MATTHEW GANDY, BJ NILSEN [EDS.] PREFACE Dancing outside the city: factions of bodies in Goa 108 Acoustic terrains: an introduction 7 Arun Saldanha Matthew Gandy Encountering rokesheni masculinities: music and lyrics in informal urban public transport vehicles in Zimbabwe 114 1 URBAN SOUNDSCAPES Rekopantswe Mate Rustications: animals in the urban mix 16 Music as bricolage in post-socialist Dar es Salaam 124 Steven Connor Maria Suriano Soft coercion, the city, and the recorded female voice 23 Singing the praises of power 131 Nina Power Bob White A beautiful noise emerging from the apparatus of an obstacle: trains and the sounds of the Japanese city 27 4 ACOUSTIC ECOLOGIES David Novak Cinemas’ sonic residues 138 Strange accumulations: soundscapes of late modernity Stephen Barber in J. G. Ballard’s “The Sound-Sweep” 33 Matthew Gandy Acoustic ecology: Hans Scharoun and modernist experimentation in West Berlin 145 Sandra Jasper 2 ACOUSTIC FLÂNERIE Stereo city: mobile listening in the 1980s 156 Silent city: listening to birds in urban nature 42 Heike Weber Joeri Bruyninckx Acoustic mapping: notes from the interface 164 Sonic ecology: the undetectable sounds of the city 49 Gascia Ouzounian Kate Jones The space between: a cartographic experiment 174 Recording the city: Berlin, London, Naples 55 Merijn Royaards BJ Nilsen Eavesdropping 60 5 THE POLITIcs OF NOISE Anders Albrechtslund Machines over the garden: flight paths and the suburban pastoral 186 3 SOUND CULTURES Michael Flitner Of longitude, latitude, and -

The 1963 Berlin Philharmonie – a Breakthrough Architectural Vision
PRZEGLĄD ZACHODNI I, 2017 BEATA KORNATOWSKA Poznań THE 1963 BERLIN PHILHARMONIE – A BREAKTHROUGH ARCHITECTURAL VISION „I’m convinced that we need (…) an approach that would lead to an interpretation of the far-reaching changes that are happening right in front of us by the means of expression available to modern architecture.1 Walter Gropius The Berlin Philharmonie building opened in October of 1963 and designed by Hans Scharoun has become one of the symbols of both the city and European musical life. Its character and story are inextricably linked with the history of post-war Berlin. Construction was begun thanks to the determination and un- stinting efforts of a citizens initiative – the Friends of the Berliner Philharmo- nie (Gesellschaft der Freunde der Berliner Philharmonie). The competition for a new home for the Berlin Philharmonic Orchestra (Berliner Philharmonisches Orchester) was won by Hans Scharoun whose design was brave and innovative, tailored to a young republic and democratic society. The path to turn the design into reality, however, was anything but easy. Several years were taken up with political maneuvering, debate on issues such as the optimal location, financing and the suitability of the design which brought into question the traditions of concert halls including the old Philharmonie which was destroyed during bomb- ing raids in January 1944. A little over a year after the beginning of construction the Berlin Wall appeared next to it. Thus, instead of being in the heart of the city, as had been planned, with easy access for residents of the Eastern sector, the Philharmonie found itself on the outskirts of West Berlin in the close vicinity of a symbol of the division of the city and the world. -

Kulturpalast' in the Historic Core of Dresden, Germany
- -m- -a- The Search for 'Kulturpalast' in the Historic Core of Dresden, Germany by Ho-Jeong Kim B.S in Architecture Hanyang University, Seoul, Korea February 1994 Submitted to the Department of Architecture in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of AP t')CHWSTSINSTITUTE Master of Architecture OF TECHNOLOGY at the APR 4SUuU Massachusetts Institute of Technology LIBRARIES February 2000 @ 2000 Ho-Jeong Kim. All rights reserved. The Author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part. Signature of Author ............................ ........................................... Department of Architecture January 14, 2000 Ce rtifie d by ................................................................................................................... Michael Dennis Professor of Architecture Thesis Advisor A c c e p te d by ................................................................................................................................................ Bill Hubbard, Jr. Adjunct Associate professor of Architecture Chairman, Department Committee on Graduate Students Thesis Advisor Michael Dennis Professor of Architecture Thesis Readers Stanford Anderson Professor of History and Architecture Head, Department of Architecture Ellen Dunham-Jones Associate Professor of Architecture Mark Jarzombek Associate Professor of History and Architecture THESISCOMMITTEE 2 The Search for 'Kulturpalast' in the Historic Core of Dresden, -

Geschichte BDA Berlin 79
Geschichte BDA Berlin 10.06.1915 Zusammenschluss der Vereinigung Berliner Architekten mit 1919 Erster Deutscher Architektentag in Berlin. In seiner Folge der Ortsgruppe Berlin zur Ortsgruppe Groß-Berlin des B.D.A. gründet der nationale BDA erstmals eine Hauptverwaltung in Aufnahme von rund 130 VBA Mitgliedern en bloc in den BDA Berlin-Tiergarten, Schöneberger Ufer 34. auf Grundlage einer auf dem Bundestag in Kassel eigens für diesen Zweck herbeigeführten nationalen Satzungsände- Die Ausstellung unbekannter Architekten des 'Arbeitsrats für rung, die die Übertragung von bis zu 15 Stimmen auf andere Kunst' legt den Grundstein für die Berliner Avantgarde der BDA-Mitglieder erlaubt und damit größeren Ortsgruppen mehr zwanziger Jahre. Walter Gropius gründet das Weimarer Stimmgewicht verleiht. Der BDA Berlin wird größte Ortsgruppe Bauhaus. mit weit über 200 Mitgliedern, seine Geschäftsstelle liegt im 'Architektenhaus' Wilhelmstraße 92/93 des Architektenverein 01.10.1920 Eingemeindung der sechs kreisfreien Städte Lichtenberg, zu Berlin. Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln und Spandau sowie von 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezir- 16.10.1916 Außerordentlicher Bundestag im Berliner Weinhaus Rheingold. ken (einschließlich des Stadtschlosses) in die bisherige Stadt- Das Berliner Vorstandsmitglied Arnold Hartmann wird in den gemeinde Berlin im Rahmen des Groß-Berlin-Gesetzes. Im geschäftsführenden Ausschuss gewählt. Der Bundestag setzt Vorfeld hatten nach fast einem Jahrhundert an Diskussion sich einstimmig für die Gründung von Architektenkammern Emanuel Heimann, Albert Hofmann und Theodor Goecke in ein. Die VBA stellt sich mit einer Reihe von Veranstaltungen, der Vereinigung Berliner Architekten VBA 1906 den Antrag Vorträgen und einer Ausstellung im BDA vor. zu einem Ideenwettbewerb für einen einheitlichen Grundlini- enplan gestellt, der zur Gründung des 'Architekten-Ausschuss 1914 - 1918 Erster Weltkrieg. -

Kulturforum Konzept Zur Weiterentwicklung
Kulturforum Konzept zur Weiterentwicklung Kulturforum Konzept zur Weiterentwicklung Senatsbeschluss (16. März 2004) und Informationen zu Geschichte, Planung und Konzeption Impressum Herausgeber Senatsverwaltung für Stadtentwicklung -Kommunikation- Württembergische Str. 6 10707 Berlin www.stadtentwicklung.berlin.de Koordination, Konzept und Texte Abteilung Städtebau und Projekte Referat IIA,- städtebauliche Projekte Werner Arndt, Werner Bialluch Graphische Gestaltung Graphic Design - Philipp Eder Druck: Copyhaus Berlin, Juni 2004 2 Inhalt: Seite Geleitwort 5 Senatsbeschluss über die Weiterentwicklung des Kulturforums (16. März 2004) —Schlussbericht an das Abgeordnetenhaus- 7 Zur Weiterentwicklung des Kulturforums Begründung zum Schlussbericht (Dr. Hans Stimmann) 11 Chronologie 20 Informationen zu Geschichte, Planung und Konzeption 23 3 4 Geleitwort Das Kulturforum ist als unfertiges Qualität des öffentlichen Raumes vor Dokument der Nachkriegsmoderne und der Augen. geteilten Stadt bis heute ein Ort, um Wir wollen auf dem Kulturforum dessen zukünftige Gestalt gerungen wird. öffentliche Räume für die Besucherinnen Doch bei allen unterschiedlichen und Besucher und wir wollen, dass diese Auffassungen gibt es einen gemeinsamen Räume die wichtigen architektonischen Nenner: Die derzeitige städtebauliche Momente des Ortes — die St. Matthäus Situation vor allem der öffentlichen Kirche, die Philharmonie, die Neue Freiräume ist unbefriedigend. Das Nationalgalerie und die Staatsbibliothek Kulturforum als einer der anspruchsvollsten miteinander in Beziehung setzen. Zu Orte in der Stadt bedarf einer dieser Idee des Raumes als verbindendes weiterführenden Planung, die den Namen Element gehört, Sichtbeziehungen nicht zu einlöst und den hier versammelten verstellen, sondern „auszustellen“. Daher Institutionen und Architekturen einen ist es uns wichtig, diese Sichtbeziehung angemessenen Raum, ein Forum gibt. von der Plattform der Neuen Nationalgalerie zur Philharmonie frei zu Der Senat hat vor diesem Hintergrund halten. -

Berlin Philharmonic Guided Tour
Berlin philharmonic guided tour Continue Welcome to the Philharmonic, the musical heart of Berlin.Still on the outskirts of West Berlin when the Philharmonic opened in 1963, it became part of a new urban center after the fall of the Berlin Wall. Its unusual tent shape and distinctive bright yellow color make it one of the city's landmarks. Its unusual architecture and innovative design of the concert hall initially caused controversy, but it now serves as a model for concert halls around the world. An exterior view of the Philharmonic with a memorial and information area for the victims of Nazi euthanasia killings. From this checkout tickets are available for concerts promoted by the Stiftung Berliner Philharmoniker (Berlin Philharmonic Foundation). Since 1963 the Berlin Philharmonic has been home to the Berliner Philharmonic. But not only that: many other promoters also use the Philharmonic's main auditorium and the Chamber Music Hall for concerts and other performances. A place of cultural fellowship, artistic encounters – this is exactly what architect Hans Scharoun had in mind when he conceived this building. Let's start exploring the Philharmonic, its architecture and history. B-A-C-H: In creating colorful mosaics set in natural stone floors, Erich F. Reuter was inspired by the works of Johann Sebastian Bach.In 2002. Hans Scharoun (1893-1972) won the competition in the city of Berlin in 1956. It belonged to the architectural avant-garde of its time. His vision: to create spaces for a free individual. Here... to the seat blocks on the right, as well as to the Hermann Wolff Hall and the South Foyer, the venues where the Berliner Philharmonikera pre-concert events are held. -

City Guide Berlin Und Potsdam 8. Auflage
CityGuide „Tipps für jede Generation und Interessenlage“ Potsdam GEO Spezial mit Potsdam BERLIN mit im KaDeWe Seite 236 Das bunteste Gedrängel im Kiez: Kristine Jaath der Türkenmarkt am Maybachufer Seite 266 BERLIN Handbuch für die neue, alte Hauptstadt Berlin: eintauchen und entdecken 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 1 Reisetipps A–Z Berlin und Bewohner Berlin-Mitte Berlin-Tiergarten 310be Foto: kj Foto: 310be Rund ums Zentrum Ausflüge Potsdam Anhang Stadtatlas 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 3 Kristine Jaath Berlin mit Potsdam „Ich möchte Weltbürger sein, überall zu Hause und – was noch entscheidender ist – überall unterwegs.“ Erasmus von Rotterdam 001-011b.qxd 29.07.2009 11:14 Seite 4 Impressum Kristine Jaath Berlin mit Potsdam erschienen im REISE KNOW-HOW Verlag Peter Rump GmbH Osnabrücker Straße 79, 33649 Bielefeld © Peter Rump 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 8., neu bearbeitete und komplett aktualisierte Auflage 2009 Alle Rechte vorbehalten. Gestaltung Umschlag: M. Schömann, P. Rump (Layout); Christina Hohenhoff (Realisierung) Inhalt: Günter Pawlak (Layout); Barbara Bossinger (Realisierung) Karten: Catherine Raisin, der Verlag Umschlagklappe hinten: BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) Fotos: Kristine Jaath (kj), Christian Prager (cp; S. 117), Umschlagfoto: www.fotolia.com © Bernd Kröger (Fahrradfahrer am Brandenburger Tor) Lektorat (Aktualisierung): Christina Hohenhoff Druck und Bindung Media Print, Paderborn ISBN 978-3-8317-1858-0 PRINTED IN GERMANY Dieses Buch ist erhältlich in jeder Buchhandlung Deutschlands, der Schweiz, Wir freuen uns über Kritik, Kommentare und Österreichs, Belgiens und der Niederlande. Verbesserungsvorschläge, gerne per E-Mail an Bitte informieren Sie Ihren Buchhändler [email protected]. über folgende Bezugsadressen: Alle Informationen in diesem Buch sind von der Deutschland Autorin mit größter Sorgfalt gesammelt Prolit GmbH, Postfach 9, und vom Lektorat des Verlages gewissenhaft D-35463 Fernwald (Annerod) bearbeitet und überprüft worden. -

Mitteilung – Zur Kenntnisnahme –
Drucksache 15/ 2727 30.03.2004 15. Wahlperiode Mitteilung – zur Kenntnisnahme – Weiterentwicklung des Kulturforums Drucksachen 15/611, 15/1019, 15/1214, 15/1591 und 15/1910 -Schlussbericht - Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 12.12.2002 Folgendes beschlossen: "Der Senat wird aufgefordert, auf der Grundlage der Beschlüs- se des Abgeordnetenhauses und des städtebaulichen Leitbildes von Hans Scharoun ein Konzept zur Weiterentwicklung des Kulturfo- rums vorzulegen. Dabei sind die durch die Vereinigung der Stadt und die Entwicklung des Potsdamer und Leipziger Platzes neu entstandenen stadträumlichen Beziehungen und künftigen Aufga- ben des Ortes zu berücksichtigen. Die am Ort betroffenen Einrich- tungen und Institutionen sind durch Interessenbekundungen einzu- beziehen. In dem Konzept sind mögliche landeshaushaltswirksame Belastungen dazustellen." Hierzu wird berichtet: Das Kulturforum ist als Gegenstand planerischer Überlegungen und als kulturpolitisches Dokument der ehemals geteilten Stadt an der Schnittstelle zum Potsdamer Platz der anspruchsvollste Bereich der innerstädtischen Entwicklung. Die Erstellung des vorliegenden Konzeptes erforderte eine sorgfältige und umfangreiche Recherche der komplexen Planungs-, Bau- und Eigentumsgeschichte des Ortes, intensive Abstimmungs- gespräche mit den ansässigen Institutionen und Nutzern, eine ge- naue Analyse der vorhandenen Defizite sowie die Überprüfung der bisherigen Konzeptionen. Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses -
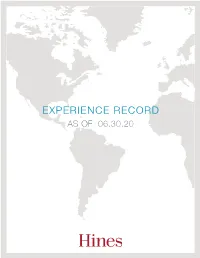
Experience Record As of 06.30.20
EXPERIENCE RECORD AS OF 06.30.20 EXPERIENCE RECORD AS OF 06-30-20 (updated semi-annually) 165 PROJECTS IN DESIGN OR UNDER CONSTRUCTION SQUARE FEET Office 27,337,600 Living/Housing 23,650,145 Industrial/Logistics 8,582,028 Retail 2,408,363 Other 1,276,806 Total SF 63,254,942 907 COMPLETED DEVELOPMENT PROJECTS Office 152,612,708 Industrial/Logistics 45,403,143 Living/Housing 31,956,204 Retail 13,076,644 Hospitality 9,069,842 Sports Facilities 3,790,107 Medical/Biotechnological 3,472,366 Arts & Cultural 2,041,130 Educational 946,952 Other 3,292,088 Total SF 265,661,184 519 ACQUISITIONS Office 148,387,664 Industrial/Logistics 38,161,731 Retail 12,879,783 Living/Housing 4,243,631 Other 3,379,233 Total SF 207,052,042 576 PROPERTY/ASSET MANAGEMENT ASSIGNMENTS Hines Investment Management, 232 projects 102,788,044 Property-Level Services, 344 projects 143,798,904 Total SF 246,586,948 225 CURRENT HINES LOCATIONS (exclusive of facility management locations) U.S. Cities 118 Cities Outside of the United States 107 Cities with Facilities Mgmt. Assignments Only 450 Global Presence (Number of Cities) 675 Projects In Design and Under Construction Office 9 STEWART STREET 36-52 WELLINGTON 92 AVENUE OF THE AMERICAS Melbourne, Victoria, Australia Melbourne, Victoria, Australia New York, NY 55,208 sq. ft. office building 195,655 sq. ft. heavy timber creative office A development management project 10 stories building 24,181 sq. ft. office building 14 stories 100 MILL 415 20TH STREET 561 GREENWICH Tempe, AZ Oakland, CA New York, NY 279,531 sq. -

Hans Scharoun Urbipedia Magazine
UMA-08 Hans Scharoun Urbipedia Magazine Papeles de Arquitectura y Urbanismo Nº 8 ISSN: 1989-5844 - Publicación trimestral - versión actualizada a febrero de 2016 de la publicación de septiembre-2012 Monográfico: Hans Scharoun Introducción Hans Scharoun se forma en el estado de fantasía expresionista que se vive en Alemania bajo la atmósfera política y cultural de la primera postguerra, junto a Biografía de Hans Scharoun Mies, Taut, Mendelsohn, Rading, Häring, los hermanos Luckhardt o el propio Poelzig, alma de la Escuela de Breslau . Esto se manifiesta en la serie de acuarelas que aporta a la Glässerne Kette –la Obras correspondencia conocida como Cadena de Cristal– y que prefiguran algunas obras futuras -es significativo el parecido formal y (1926-1927) Casa 33 en la Colonia Weissenhof cromático que guarda el Cine Universum pág 10 (1930) de Mendelsohn con la serie de los Kinos (cines) de Scharoun. Frente a los compromisos de la Alemania de Weimar, abandona la exuberancia expresionista y (1927) | Casa de madera transportable para la exposición Gugali pág 13 participa en el desarrollo posterior del racionalismo, apareciendo en sus escenarios principales. Pero no es una renuncia fácil y siempre hay en Scharoun un mayor peso de invención tipológica y (1928-1929) | Edificio de viviendas unipersonales en el WuWa formal, como puede comprobarse en las pág 15 fragmentaciones del lenguaje racionalista presentes en su casa para la Weisenhof de Stutgart (1927) o en las curvas del (1928-1929) | Edificio de apartamentos en Kaiserdamm 25 Barrio Siemenstadt de Berlín- pág 17 Charlottenburg (1928-29). Se coloca, así, en el extremo opuesto de Hannes Meyer o André Lurçat, dispuestos a reducir a cero los atributos comunicativos del lenguaje (1929-1930) | Edificio de apartamentos en Hohenzollerndamm 35 pág 19 arquitectónico, a favor de una adhesión a las tareas organizativas que el desarrollo tecnológico y político exigen.