Das Geheimnis Des Hörens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rezensionen Für
Rezensionen für Gustav Mahler: Das Lied von der Erde aud 95.491 4022143954916 Badische Zeitung 18.11.2003 (Heinz W. Koch - 2003.11.18) ... Wie spezifisch, ja wie radikal sich Gielens Mahler ausnimmt, erhellt schlagartig, wenn man Rafael Kubeliks dreieinhalb Jahrzehnte alte und vor einer Weile wiederveröffentlichte Einspielung dagegenhält. Eine gehörige Überraschung gab’s schon einmal – als nämlich die nie veröffentlichten Münchner Funk-„Meistersinger“ von 1967 plötzlich zu haben waren. Jetzt ist es Gustav Mahlers drei Jahre später eingespieltes „Lied von der Erde“, das erstmals über die Ladentische geht. Es gehört zu einer Mahler Gesamtaufnahme, die offenbar vor der rühmlich bekannten bei der Deutschen Grammophon entstand. Zumindest bei den hier behandelten Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 war das der Fall. Beim „Lied von der Erde“ offeriert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Kubelik damals war, ein erstaunlich präsentes, erstaunlich aufgesplittertes Klangbild, das sowohl das Idyllisch-Graziöse hervorkehrt wie das Schwerblütig-Ausdrucksgesättigte mit großem liedsinfonischem Atem erfüllt – eine erstrangige Wiedergabe. Auch die beiden 1967/68 erarbeiteten Sinfonien erweisen sich als bestechend durchhörbar. Vielleicht geht Kubelik eine Spur naiver vor als die beim Sezieren der Partitur schärfer verfahrenden Dirigenten wie Gielen, bricht sich, wo es geht, das ererbte böhmische Musikantentum zumindest für Momente Bahn. Da staunt einer eher vor Mahler, als dass er ihn zu zerlegen sucht. Wenn es eine Verwandtschaft gibt, dann ist es die zu Bernstein. Das Triumphale der „Dritten“, das Nostalgische an ihr wird nicht als Artefakt betrachtet, sondern „wie es ist“: Emotion zur Analyse. ... (aus einer Besprechung mit den Mahler-Interpretationen Michael Gielens) CD Compact n°169 (octobre 2003) (Benjamín Fontvelia - 2003.10.01) Rafael Kubelik/Audite Rafael Kubelik/Audite Full review text restrained for copyright reasons. -
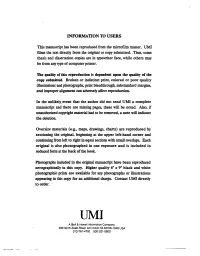
INFORMATION to USERS This Manuscript Has Been Reproduced
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 THE COMPLETED SYMPHONIC COMPOSITIONS OF ALEXANDER ZEMLINSKY DISSERTATION Volume I Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of Philosophy In the Graduate School of The Ohio State University By Robert L. -

Mahler:Das Lied Von Der Erde (The Song of the Earth)
Mahler: Das Lied von der Erde (The Song of the Earth) Stephen E. Hefling published by the press syndicate of the university of cambridge The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom cambridge university press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK http://www.cup.cam.ac.uk 40 West 20th Street, New York NY 10011–4211, USA http://www.cup.org 10 Stamford Road, Oakleigh, Melbourne 3166, Australia © Cambridge University Press 2000 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2000 Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge 1 Typeset in Ehrhardt (MT) 10 ⁄2/13pt, in QuarkXPress™ [se] A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress cataloguing in publication data Hefling, Stephen E. Mahler, Das Lied von der Erde = (The song of the earth) / Stephen E. Hefling p. cm. – (Cambridge music handbooks) Includes bibliographical references and index. ISBN 0 521 47534 1 (hardback) – ISBN 0 521 47558 9 (paperback) 1. Mahler, Gustav, 1860–1911. Lied von der Erde. I. Title. II. Title: Lied von der Erde. III. Title: Song of the earth. IV. Series. MT121.M34H44 1999 782.4′7–dc21 99-23189 CIP ISBN 0 521 47534 1 hardback ISBN 0 521 47558 9 paperback Contents List of illustrations page viii Preface ix List of abbreviations xiv 1 Background: Mahler’s “symphonic worlds” before 1908 1 2 Genesis 28 3 Reception 54 4 The music 80 Appendix: translation 120 Notes 132 Select bibliography 149 Index 154 vii 1 Background: Mahler’s “symphonic worlds” before 1908 Tragedy and the hope of redemption: Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, Lipiner Fundamental to an understanding of Mahler’s work as a whole is the Schopenhauerian worldview, embraced and extended by Wagner and Nietzsche, in which Mahler was steeped from his student days in Vienna (1875–83). -

A Collection of Stan Ruttenberg's Reviews of Mahler Recordings From
A collection of Stan Ruttenberg’s Reviews of Mahler Recordings from the Archives Of the Colorado MahlerFest (Symphonies 3 through 7 and Kindertotenlieder) Colorado MahlerFest XIII Recordings of the Mahler Third Symphony Of the fifty recordings listed in Peter Fülöp’s monumental discography (up to 1955, and many more have been added since then), I review here fifteen at my disposal, leaving out two by Boulez and one by Scherchen as not as worthy as the others. All of these fifteen are recommendable, all with fine points, all with some or more weaknesses. I cannot rank them in any numerical order, but I can say that there are four which I would rather hear more than the others — my desert island choices. I am glad to have the others for their own particular merits. Getting ready for MFest XIII we discovered that the matter of score versions and parts is complex. I use the Dover score, no date but attributed to Universal Edition; my guess this is an early version. The Kalmus edition is copied from who knows which published version. Then there is the “Critical Edition,” prepared by the Mahler Gesellschaft, Vienna. I can find two major discrepancies between the Dover/Universal and the Critical (I) the lack of horns at RN25-5, doubling the string riff and (ii) only two harp glissandi at the middle of RN28, whereas the Critical has three. Our first horn found another. Both the Dover and Critical have the horn doublings, written ff at RN 67, but only a few conductors observe them. -

A Cultural Analysis of Gustav Mahler's Early Des Knaben
A CULTURAL ANALYSIS OF GUSTAV MAHLER’S EARLY DES KNABEN WUNDERHORN SETTINGS by HARRY LUTHER BAECHTEL A LECTURE-DOCUMENT Presented to the School of Music and Dance of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts JUNE 2014 “A Cultural Analysis of Gustav Mahler’s Early Des Knaben Wunderhorn Settings,” a lecture-document prepared by Harry Luther Baechtel in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Musical Arts degree in the School of Music and Dance. This lecture-document has been approved and accepted by: Milagro Vargas, Chair of the Examining Committee Committee in Charge: Milagro Vargas, Chair Eric Mentzel Stephen Rodgers Accepted by: Ann B. Tedards, Associate Dean and Director of Graduate Studies, School of Music and Dance ii © 2014 Harry Luther Baechtel iii CURRICULUM VITAE NAME OF AUTHOR: Harry Luther Baechtel PLACE OF BIRTH: Santa Rosa, California DATE OF BIRTH: June 9, 1978 GRADUATE AND UNDERGRADUATE SCHOOLS ATTENDED: University of Oregon Boston University Northwestern University Chapman University DEGREES AWARDED: Doctor of Musical Arts, Voice Performance, 2014, University of Oregon Certificate in Opera Performance, 2005, Boston University Master of Music, Voice Performance, 2002, Northwestern University Bachelor of Music, Vocal Performance, 2000, Chapman University AREAS OF SPECIAL INTEREST: Opera Performance German Lieder PROFESSIONAL EXPERIENCE: Adjunct Voice Instructor, Lane Community College, 2012-2104 Graduate Teaching Fellow, University of Oregon, -

Gustav Mahler's Third Symphony
Gustav Mahler’s Third Symphony: Program, Reception, and Evocations of the Popular by Timothy David Freeze A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Music Musicology) in The University of Michigan 2010 Doctoral Committee: Associate Professor Steven M. Whiting, Co-Chair Professor Albrecht Riethmüller, Freie Universität Berlin, Co-Chair Professor Roland J. Wiley Professor Michael D. Bonner Associate Professor Mark A. Clague © 2010 Timothy David Freeze All rights reserved To Grit ii ACKNOWLEDGMENTS The road leading to the completion of this dissertation was longer and more scenic than I ever intended it to be. It is a great pleasure to acknowledge here the many individuals and organizations that provided support and encouragement along the way. I am especially grateful to the co-chairs of my committee. Without the unflagging support of Steven M. Whiting, whose sage counsel on matters musical and practical guided me from start to finish, this project would not have been possible. I am equally indebted to Albrecht Riethmüller, whose insight and intellectual example were a beacon by whose light this dissertation took shape. I would also like to thank R. John Wiley, whose extensive and penetrating feedback improved the dissertation and my own thinking in countless ways, and Mark Clague and Michael Bonner, both of whom provided valuable comments on content and style. In Ann Arbor, I would like to acknowledge the support of the entire musicology faculty at the University of Michigan. Louise K. Stein gave helpful advice in the early stages of this project. In Berlin, I benefited from conversations with Federico Celestini, Sherri Jones, and Peter Moormann. -

{FREE} Why Mahler? : How One Man and Ten Symphonies Changed The
WHY MAHLER? : HOW ONE MAN AND TEN SYMPHONIES CHANGED THE WORLD PDF, EPUB, EBOOK Norman Lebrecht | 384 pages | 01 Sep 2011 | FABER & FABER | 9780571260799 | English | London, United Kingdom Why Mahler? : How One Man and Ten Symphonies Changed the World PDF Book Stay ahead with Tip Sheet! The main thing that annoys me is that all these composers Mendelssohn, Mahler, and even dear old Fritz Kreisler were in a hurry to deny their cultural heritage and adopt Catholicism for self-advancement. Not, however, Norman Lebrecht, whose fascination with Mahler extends to knowing that the American chanteuse Beyonce Knowles is his eighth cousin four times removed. Anyway, who has the time to wend their way through dozens of versions of a particular symphony symphonies in Mahler's case which are frequently hitting the hour-long mark in order to gauge which interpretation suits them best? The book breaks down each of the 10 - the 10th being unfinished at M's death. I liked the beautiful buoyancy of the orchestral sound still. Each chapter centers on a single, pivotal year, allowing Lebrecht to weave together a collection of anecdotes. He was liberal in his instructions to other conductors performing his music, so much so, that some performances of a particular symphony could vary by as much as 20 minutes, depending on Mahler's mood, or the interpretation of the conductor. It did not give a clear, inter Normally I view reading in the same way that some people view food, the kind who insist on finishing everything on their plate, or I view it in the same way that the Mastermind questioner views his questions - "I've started so I'll finish". -

Mahler Symphonies Nos 1–9 Valery Gergiev
LSO Live Mahler Symphonies Nos 1–9 Valery Gergiev London Symphony Orchestra Gustav Mahler (1860–1911) Page Index Symphonies Nos 1–9 Symphony No 10 (Adagio) 3 Track listing 6 English notes Valery Gergiev conductor 16 French notes London Symphony Orchestra 28 German notes 40 Composer biography 41 Texts 46 Conductor biography 47 Soloists’ biographies 55 Chorus personnel list 56 Orchestra personnel list 57 LSO biography Recorded live September 2007 – March 2011 at the Barbican, London and St Paul’s Cathedral (Symphony No 8) The recording in St Paul’s Cathedral was made by kind permission of the Dean and Chapter, with assistance from the City of London Festival and BBC Radio 3. James Mallinson producer Classic Sound Ltd recording, editing and mastering facilities Jonathan Stokes and Neil Hutchinson for Classic Sound Ltd balance engineers Jonathan Stokes and Neil Hutchinson for Classic Sound Ltd audio editing, mixing & mastering Symphonies Nos 1, 2, 3, 4, 8, 9 & 10 published by Universal Edition AG Symphonies Nos 5 & 6 published by C.F. Kahnt Musikverlag Symphony No 7 published by Boosey & Hawkes Bote & Bock, Berlin © 2012 London Symphony Orchestra, London UK P 2012 London Symphony Orchestra, London UK 2 Track listing Symphony No 1 in D major, ‘Titan’ (1884–88, rev 1893–96) Recorded live January 2008, at the Barbican, London. Includes 5.0 multi-channel mix. i. Langsam. Schleppend – Im Angang gemächlich 14’40’’ ii. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell – Trio: Recht gemächlich – Tempo primo 8’14’’ iii. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 10’33’’ iv. Stürmisch bewegt 19’16’’ Symphony No 10 (1910) Recorded live June 2008, at the Barbican, London Adagio 22’13’’ Symphony No 2 in C minor, ‘Resurrection’ (1888–94) Elena Mosuc soprano, Zlata Bulycheva mezzo-soprano, London Symphony Chorus Recorded live April 2008, at the Barbican, London. -

Mahler-Werfel Papers Ms
Mahler-Werfel papers Ms. Coll. 575 Finding aid prepared by Violet Lutz. Last updated on June 23, 2020. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2006 Mahler-Werfel papers Table of Contents Summary Information....................................................................................................................................4 Biography/History..........................................................................................................................................5 Scope and Contents..................................................................................................................................... 34 Administrative Information......................................................................................................................... 40 Controlled Access Headings........................................................................................................................41 Other Finding Aids......................................................................................................................................42 Collection Inventory.................................................................................................................................... 43 Correspondence to and from Alma Mahler, Franz Werfel, and Adolf Klarmann.................................43 Correspondence between Alma Mahler and Franz Werfel...................................................................45 Writings by Alma -

GUSTAV MAHLER Symphony No.5 Gürzenich-Orchester Köln François-Xavier Roth FRANZ LISZT
GUSTAV MAHLER Symphony no.5 Gürzenich-Orchester Köln François-Xavier Roth FRANZ LISZT GUSTAV MAHLER (1860-1911) Symphony no.5 C sharp Minor / Ut dièse mineur / cis-Moll 1 | I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt. 12’19 2 | II. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz. 14’19 3 | III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell. 18’08 4 | IV. Adagietto. Sehr langsam. 10’46 5 | V. Rondo-Finale. Allegro. 15’10 Gürzenich-Orchester Köln François-Xavier Roth, direction Parmi celles-ci se distingue le témoignage adressé à son épouse Alma pendant les répétitions du La Cinquième Symphonie de Mahler concert de création, au sujet du 3e mouvement (Scherzo) : “Les chefs d’orchestre le prendront cinquante années durant à un tempo trop rapide et en feront un non-sens, quant au public – Ô ciel ! –, quelle figure un tournant majeur ? va-t-il faire devant un tel chaos, qui enfante continuellement un monde nouveau, lequel se désagrège dès l’instant suivant – devant ces sonorités primitives échappées d’un univers en gestation, devant cet océan qui gronde, hurle, rugit, devant ces étoiles qui dansent et ces vagues qui coupent le souffle, Le 21 mai 1905 – soit un peu plus de six mois après la création de l’œuvre à Cologne –, la Cinquième chatoient et éblouissent par leurs fulgurances ?”. Un concert donné à Hambourg le 13 mars 1905 Symphonie de Mahler fut exécutée à Strasbourg sous la direction du compositeur. Ce concert, auquel l’amena à tenir ces propos que l’on a souvent cités : “La Cinquième est une œuvre maudite. Personne Romain Rolland assistait, devait inspirer plus tard à l’écrivain français l’observation suivante : “[Mahler] ne la comprend !”. -

Symphonic Texts and the Cultural Ideology of Mahler's
SYMPHONIC TEXTS AND THE CULTURAL IDEOLOGY OF MAHLER’S LIEDER A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Cassandra Lee Henry January 2009 © 2009 Cassandra Lee Henry SYMPHONIC TEXTS AND THE CULTURAL IDEOLOGY OF MAHLER’S LIEDER Cassandra Lee Henry, Ph. D. Cornell University 2009 Although Gustav Mahler has long been considered a crucial figure in the cultural world of the fin-de-siècle, the exact nature of his involvement in the social, political, and cultural philosophies of the era has remained largely undefined. The student radicalism of his youth has been taken as a leitmotif for the social and political activity of his entire life, while his compositions have been viewed as entirely separate from his biography, with most scholarship focusing on their place in the musical canon. This dissertation attempts to rectify the misplaced scholarly emphasis by examining Mahler’s vocal works in the context of their relationship to his social, political, and cultural thought. As Mahler used both the genre categorization of his music and the texts of his works as statements of his philosophy, my analysis focuses primarily on those pieces which evince significant change in these areas, namely Mahler’s songs and song-cycles – the Wunderhorn songs, the Kindertotenlieder, and Das Lied von der Erde – and his Eighth and Third Symphonies. Preliminary to this is a discussion of Mahler’s political, social, and cultural philosophies as concern his compositional and literary output, as well as an investigation of the changing definitions of the genres of song-cycle and symphony at the turn of the century and the role that Mahler played in such a metamorphosis. -

MAHLER / SYMPHONY NO. 3 CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA / BERNARD HAITINK / MICHELLE Deyoung CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA BERNARD HAITINK / MICHELLE Deyoung 23
“The CSO has played the Mahler Third on many occasions but almost never with the degree of concentration, fervor and refinement it summoned for Haitink at this performance. But it was the sublime, transcendent finale toward which every- thing built, and Haitink rightly made it the beating heart of his performance. With Haitink and the CSO, a great musical partnership has been born.” John von Rhein, Chicago Tribune, October 21, 2006 “. Bernard Haitink debuted as CSO principal conductor with a performance of Mahler’s massive 100-minute Third Symphony that was one for the history books. Haitink showed that he was here to bring out the mysteries of this magical piece, one that contains an entire world, and that he wanted to meet the CSO’s players at a mountaintop of artistry that they would share with the composer.” Andrew Patner, Chicago Sun-Times, October 21, 2006 CSO Resound is underwritten This recording is made by a generous gift from possible with the Mr. and Mrs. Ralph Smykal. generous support of MAHLER / SYMPHONY NO. 3 CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA / BERNARD HAITINK / MICHELLE DeYOUNG CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA BERNARD HAITINK / MICHELLE DeYOUNG 23 Oboes Saxophone Tuba Eugene Izotov Burl Lane Gene Pokorny Principal Principal The Nancy and Larry The Arnold Jacobs Principal Fuller Chair Horns Tuba Chair, endowed by Michael Henoch Dale Clevenger Christine Querfeld Assistant Principal and Principal Acting English Horn Daniel Gingrich Timpani Scott Hostetler Associate Principal Donald Koss James Smelser Principal Clarinets David Griffin Vadim Karpinos Rosenberg Todd by Photo Larry Combs Oto Carrillo Assistant Bernard Haitink Principal Susanna Drake Conductor John Bruce Yeh Percussion Assistant Principal Trumpets Patricia Dash Gregory Smith Christopher Martin Acting Principal J.