Gesunde Tiere Dank Antibiotika?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ontology of Consciousness
Ontology of Consciousness Percipient Action edited by Helmut Wautischer A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England ( 2008 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or me- chanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. MIT Press books may be purchased at special quantity discounts for business or sales promotional use. For information, please e-mail [email protected] or write to Special Sales Depart- ment, The MIT Press, 55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142. This book was set in Stone Serif and Stone Sans on 3B2 by Asco Typesetters, Hong Kong, and was printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Ontology of consciousness : percipient action / edited by Helmut Wautischer. p. cm. ‘‘A Bradford book.’’ Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-262-23259-3 (hardcover : alk. paper)—ISBN 978-0-262-73184-3 (pbk. : alk. paper) 1. Consciousness. 2. Philosophical anthropology. 3. Culture—Philosophy. 4. Neuropsychology— Philosophy. 5. Mind and body. I. Wautischer, Helmut. B105.C477O58 2008 126—dc22 2006033823 10987654321 Index Abaluya culture (Kenya), 519 as limitation of Turing machines, 362 Abba Macarius of Egypt, 166 as opportunity, 365, 371 Abhidharma in dualism, person as extension of matter, as guides to Buddhist thought and practice, 167, 454 10–13, 58 in focus of attention, 336 basic content, 58 in measurement of intervals, 315 in Asanga’s ‘‘Compendium of Abhidharma’’ in regrouping of elements, 335, 344 (Abhidharma-samuccaya), 67 in technical causality, 169, 177 in Maudgalyayana’s ‘‘On the Origin of shamanic separation from body, 145 Designations’’ Prajnapti–sastra,73 Action, 252–268. -

William Seager Cv 2018
Curriculum Vitae Name: William E. Seager Birth Date: April 11, 1952 Address: 13 Sidney Street Toronto, Ontario, M4V 2G3 Canada Citizenship: Canadian Telephone: (416) 287-7151 (work) (416) 928-0668 (home) Email: [email protected] Education and Degrees: 1973 B. A. University of Alberta 1976 M. A. University of Alberta 1981 Ph. D. University of Toronto Thesis: Materialism and the Foundations of Representation Supervisor: R. B. DeSousa Advisor: E. J. Kremer Scholarships and Awards: 1977-78 Ontario Graduate Scholarship 1978-79 Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) Fellowship 1979-80 SSHRC Fellowship Teaching Experience: 1980-81 Assistant Prof. (1/2 time), University of Toronto at Scarborough. 1981-82 Assistant Professor, University of Toronto at Scarborough. 1982-83 Assistant Professor (2/3 time) at Erindale College, University of Toronto. 1983-84 Assistant Professor (1/2 time) at Erindale College. 1984-87 Assistant Professor, University of Toronto at Scarborough. 1987-92 Associate Professor, University of Toronto at Scarborough. 1992- Professor, University of Toronto at Scarborough. Books: The Leibniz Lexicon: A Dual Concordance to Leibniz’s Philosophische Schriften, Hildesheim: Olms, 1988 (419 pp.). (With R. McRae, R. Finster, G. Hunter, M. Miles.) Metaphysics of Consciousness, London: Routledge, 1991 (262 pp.). Theories of Consciousness, London: Routledge, 1999 (316 pp.). 1 / 20 Truth and Value: Essays for Hans Herzberger, Editor (with J. Tappenden and A. Varzi), University of Calgary Press, 2011 (198 pp.). Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness, Springer-Verlag (Frontiers Collection), 2012 (270pp). Theories of Consciousness (second edition), London: Routledge, 2016 (revised & extended, 340 pp.). Routledge Handbook of Panpsychism, (editor), London: Routledge, forthcoming. -
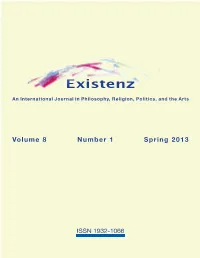
And Editors' Introduction
Existenz An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts Volume 8 Number 1 Spring 2013 ISSN 1932-1066 T ABLE OF C ON T EN T S Volume 8/1, Spring 2013 Editors' Introduction Alan M. Olson, Helmut Wautischer iii Boston University, Sonoma State University The Flame of Eternity Alan M. Olson 1 Boston University Krzysztof Michalski as Educator James Dodd 3 New School for Social Research, New York Flamme bin ich sicherlich—Flame am I…: To Eternity Babette Babich 7 Fordham University On Michalski's Nietzsche, Christianity, and Cognition Tom Rockmore 16 Duquesne University Philosophical Pathos and Spirituality Sigridur Thorgeirsdottir 21 University of Iceland, Reykjavik Comments on Krzysztof Michalski's The Flame of Eternity Lydia Voronina 25 Boston, MA The Seven Sleepers of Ephesus Herbert W. Mason 31 Boston University E DI T ORS ' I N T RODU ct ION This volume contains four critical reviews of the English edition of the late Krzysztof Michalski's The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought, Princeton University Press, 2012. The book has also been published in Polish, Russian, and is forthcoming in a French edition. The reviews are by senior scholars, Babette Babich, Professor of Philosophy at Fordham University; Sigridur Thorgeirsdottir, Professor of Philosophy at the University of Iceland; Lydia Voronina, US Department of State, retired; Tom Rockmore, Professor of Philosophy at Duquesne University. James Dodd, Professor and Chair in the Philosophy Department at the New School of Social Science in New York authored the introductory tribute to "Krzysztof Michalski as Educator." Owing to matters of health and other contingencies, the KJSNA panel review of Krzysztof Michalski's Flame of Eternity, scheduled for the Annual Meeting of the Eastern Division of the American Philosophical Association in Atlanta (2012) did not take place. -

Joanne Miyang CHO Professor Department of History William Paterson University of New Jersey 300 Pompton Road Wayne, NJ 07470 [email protected]
Joanne Miyang CHO Professor Department of History William Paterson University of New Jersey 300 Pompton Road Wayne, NJ 07470 [email protected] EDUCATION • Ph. D., Department of History, University of Chicago (1993) . Dissertation: “A Moderate Liberalism of Ernst Troeltsch (1865-1923)” . Dissertation Research in Germany: University of Bielefeld (1988-89) & The Leibniz Institute for European History (1991-93) • M.A., Department of History, University of Chicago (1984) • B.A., Department of History, University of California, Los Angeles (1983) ACADEMIC POSITIONS: • Graduate Director, History Department, William Paterson University, 2018-2019 • Acting Chair, History Department, William Paterson University, 2017-2018 • Visiting Lecturer, International Summer School, Ewha Womans University, Seoul, South Korea (2018) • Chair, History Department, William Paterson University, 2011-2017 • Professor (Modern German History), History Department, William Paterson University, 2012-Present • Associate Professor, History Department, William Paterson University, 2000-2012 • Assistant Professor, History Department, William Paterson University, 1995-2000 • Assistant Professor, History Department, Hope College, 1992-1995 • Teaching Intern, Department of History, The University of Chicago, 1988-1989. PUBLICATIONS: EDITED BOOKS • East-Asian German-East Cinema: The Transnational Screen, 1919 to the Present (New York: Routledge, forthcoming, 2021) • Musical Entanglements between East Asia and Germany: Transnational Affinity in the 20th and 21st Centuries (Basingstoke: -

Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association
January 2008 Volume 81, Issue 3 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association apa The AmericAn PhilosoPhicAl Association Pacific Division Program University of Delaware Newark, DE 19716 www.apaonline.org The American Philosophical Association Pacific Division Eighty-Second Annual Meeting Hilton Pasadena Pasadena, CA March 18 - 23, 2008 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association (ISSN 0065-972X) is published five times each year and is distributed to members of the APA as a benefit of membership and to libraries, departments, and institutions for $75 per year. It is published by The American Philosophical Association, 31 Amstel Ave., University of Delaware, Newark, DE 19716. Periodicals Postage Paid at Newark, DE and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Proceedings and Addresses, The American Philosophical Association, University of Delaware, Newark, DE 19716. Editor: David E. Schrader Phone: (302) 831-1112 Publications Coordinator: Erin Shepherd Fax: (302) 831-8690 Associate Editor: Anita Silvers Web: www.apaonline.org Meeting Coordinator: Linda Smallbrook Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association, the major publication of The American Philosophical Association, is published five times each academic year in the months of September, November, January, February, and May. Each annual volume contains the programs for the meetings of the three Divisions; the membership list; Presidential Addresses; news of the Association, its Divisions and Committees, and announcements of interest to philosophers. Other items of interest to the community of philosophers may be included by decision of the Editor or the APA Board of Officers. Microfilm copies are available through National Archive Publishing Company, Periodicals/Acquisitions Dept., P.O. -

Beilage Zur Selbstbeschreibung: Institut Für Philosophie, GEWI Fakultät, KFU Graz
Beilage zur Selbstbeschreibung: Institut für Philosophie, GEWI Fakultät, KFU Graz Inhalt I. Einleitung ..................................................................................................................... 3 A. Geschichte des Instituts ................................................................................................ 3 B. Stand heute ................................................................................................................... 4 1. Theoretische Philosophie ............................................................................................. 4 2. Geschichte der Philosophie .......................................................................................... 5 3. Praktische Philosophie ................................................................................................. 5 4. Fachdidaktiker .............................................................................................................. 5 5. Gastforscher ................................................................................................................. 6 6. Raumsituation und Raumbedarf ................................................................................... 6 C. Personalentwicklung seit der Emeritierung von Professor Haller, Zahl der Studierenden und Personalbedarf ................................................................................. 7 1. Verlust von wissenschaftlichem Personal am Institut für Philosophie im Zeitraum von 1997 – 2008 und Entwicklung ab 2009 ............................................................... -

Krankheit Und Gesundheit Herausgegeben Von Wolfgang Rother
conexus 3/2020 Krankheit und Gesundheit Herausgegeben von Wolfgang Rother Publikationen der fortgeschrittenen Forschenden und Lehrenden der Universität Zürich Publiziert mit Unterstützung der Hochschulstiftung der Universität Zürich und der Privatdozenten-Stiftung der Universität Zürich © 2020 conexus. Publikationen der fortgeschrittenen Forschenden und Lehrenden der Universität Zürich Alle Beiträge dürfen im Rahmen der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 - Creative Commons: Namensnennung/nicht kommerziell/keine Bearbeitungen - weiterverbreitet werden. conexus 3 (2020) https://doi.org/10.24445/conexus.2020.03.001 ISSN 2673-1851 conexus Publikationen der fortgeschrittenen Forschenden und Lehrenden der Universität Zürich Herausgeber Prof. Dr. Wolfgang Rother Philosophisches Seminar Redaktionskommission Prof. Dr. Jan-Andrea Bernhard Theologische Fakultät Prof. Dr. Michael Hässig Vetsuisse-Fakultät PD Dr. Sabine Hoidn Institut für Erziehungswissenschaft PD Dr. Malcolm MacLaren Rechtswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. Matthias Neugebauer Theologische Fakultät Prof. Dr. Stephan R. Vavricka Medizinische Fakultät Prof. Dr. Ulrike Zeuch Deutsches Seminar Inhalt Wolfgang Rother Vorwort ............................................................ 1-7 Simon R. Rüegg and Barbara Häsler One Health continues to evolve for better health of people, animals and ecosystems ........................... 8-25 Michael Hässig Gesunde Tiere dank Antibiotika? ............................ 26-31 Antje Heck, Eli Alon, Kyrill Schwegler und Andreas R. Gantenbein Opioide - Gefahren -

Joanne Miyang CHO Professor Department of History William Paterson University of New Jersey 300 Pompton Road Wayne, NJ 07470 [email protected]
Joanne Miyang CHO Professor Department of History William Paterson University of New Jersey 300 Pompton Road Wayne, NJ 07470 [email protected] EDUCATION • Ph. D., Department of History, University of Chicago (1993) . Dissertation: “A Moderate Liberalism of Ernst Troeltsch (1865-1923)” . Dissertation Research in Germany: University of Bielefeld (1988-89) & The Leibniz Institute for European History (1991-93) • M.A., Department of History, University of Chicago (1984) • B.A., Department of History, University of California, Los Angeles (1983) ACADEMIC POSITIONS: • Graduate Director, History Department, William Paterson University, 2018-2019 • Acting Chair, History Department, William Paterson University, 2017-2018 • Visiting Lecturer, International Summer School, Ewha Womans University, Seoul, South Korea (2018) • Chair, History Department, William Paterson University, 2011-2017 • Professor (Modern German History), History Department, William Paterson University, 2012-Present • Associate Professor, History Department, William Paterson University, 2000-2012 • Assistant Professor, History Department, William Paterson University, 1995-2000 • Assistant Professor, History Department, Hope College, 1992-1995 • Teaching Intern, Department of History, The University of Chicago, 1988-1989. PUBLICATIONS: EDITED BOOKS • East-Asian German-East Cinema: The Transnational Screen, 1919 to the Present (New York: Routledge, forthcoming, 2021) • Musical Entanglements between East Asia and Germany: Transnational Affinity in the 20th and 21st Centuries (Basingstoke: -

Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association
September 2010 Volume 84, Issue 1 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association apa THE AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION Eastern Division Program University of Delaware Newark, DE 19716 www.apaonline.org The American Philosophical Association Eastern Division One Hundred Seventh Annual Meeting Marriott/Westin-Copley Connection Boston, MA December 27 - 30, 2010 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association (ISSN 0065-972X) is published five times each year and is distributed to members of the APA as a benefit of membership and to libraries, departments, and institutions for $75 per year. It is published by The American Philosophical Association, 31 Amstel Ave., University of Delaware, Newark, DE 19716. Periodicals Postage Paid at Newark, DE and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Proceedings and Addresses, The American Philosophical Association, University of Delaware, Newark, DE 19716. Editor: David E. Schrader Phone: (302) 831-1112 Publications Coordinator: Erin Shepherd Fax: (302) 831-8690 Associate Editor: Richard Bett Web: www.apaonline.org Meeting Coordinator: Linda Smallbrook Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association, the major publication of The American Philosophical Association, is published five times each academic year in the months of September, November, January, February, and May. Each annual volume contains the programs for the meetings of the three Divisions; the membership list; Presidential Addresses; news of the Association, its Divisions and Committees, and announcements of interest to philosophers. Other items of interest to the community of philosophers may be included by decision of the Editor or the APA Board of Officers. -

Newsletter on International Cooperation
APA Newsletters Volume 05, Number 1 Fall 2005 NEWSLETTER ON INTERNATIONAL COOPERATION ANNOUNCEMENTS ARTICLES ASHRAF ADEEL “Faith, Violence, and our Integral Humanity: An Ecological Perspective” MASHUQ ALLY “Collective Responsibility and Race Cognizance as Bases for Restorative (Re)conciliation: Karl Jaspers’s Contribution to Transformation in Post-Apartheid South Africa” JACOB ELSTER “Simone Weil on the Purificational Role of Atheism and Amoralism” PAUL KURTZ “Paranatural Claims of Qur’anic Revelation Examined Critically” © 2005 by The American Philosophical Association ISSN: 1067-9464 APA NEWSLETTER ON International Cooperation Omar Dahbour, Editor Fall 2005 Volume 05, Number 1 ANNOUNCEMENTS Current Topics in Portuguese Philosophy, APA Eastern Division Meeting, New York, NY, December 2005 Searle’s Philosophy and Chinese Philosophy: Joao Branquinho (University of Lisbon), “On the Persistence Constructive Engagement, Hong Kong, of Indexical Belief” China, June 2005 Joao Saagua (New University of Lisbon), “Contextualism, Minimalism, and Communication” Participants at this conference included: Robert Allinson Antonia Marques (New University of Lisbon), “An Expressivist (Chinese University of Hong Kong), Chung-ying Cheng Point of View on the Inner and Outer Relation” (University of Hawaii), Kim-chong Chong (Hong Kong University of Science and Technology), Wan-chuan Fang (Academia Sinica, Taipei), Dingzhou Fei (Wuhan University), Christopher Fraser (Chinese University of Hong Kong), Yiu- ming Fung (Hong Kong University of Science and Technology), Philosophical Studies in China in View of Gang He (University of Shanghai for Science and Technology), Constructive Engagement, APA Eastern Soraj Hongladarom (Chulalongkorn University), Joel Krueger Division Meeting, New York, NY, December (Purdue University), Joseph Lee (Hong Kong), Jianyou Lu (China), Jeannie Lum (University of Hawaii), A. -
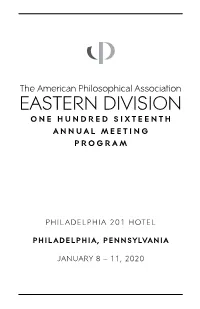
2020 APA Eastern Division Meeting Program
The American Philosophical Association EASTERN DIVISION ONE HUNDRED SIXTEENTH ANNUAL MEETING PROGRAM PHILADELPHIA 201 HOTEL PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA JANUARY 8 – 11, 2020 Visit our table at APA Eastern OFFERING A 20% (PB)/40% (HC) DISCOUNT WITH FREE SHIPPING TO THE CONTIGUOUS U.S. FOR ORDERS PLACED AT THE CONFERENCE. Merleau-Ponty and Announcements Contemporary Philosophy On Novelty Emmanuel Alloa, Frank Chouraqui, and Kristina Mendicino Rajiv Kaushik, editors Eckhart, Heidegger, Philosophers and Their Poets and the Imperative Reflections on the Poetic Turn of Releasement in Philosophy since Kant Ian Alexander Moore Charles Bambach and Theodore George, editors The Other Emptiness Rethinking the Zhentong Buddhist Earthly Encounters Discourse in Tibet Sensation, Feminist Theory, Michael R. Sheehy and and the Anthropocene Klaus-Dieter Mathes, editors Stephanie D. Clare Conflict in Aristotle’s Speaking Face to Face Political Philosophy The Visionary Philosophy Steven Skultety of María Lugones Pedro J. DiPietro, Jennifer McWeeny, and Revolutionary Time Shireen Roshanravan, editors On Time and Difference in Kristeva and Irigaray Merleau-Ponty between Fanny Söderbäck Philosophy and Symbolism The Matrixed Ontology Genealogies of the Secular Rajiv Kaushik The Making of Modern German Thought Willem Styfhals and Stéphane Symons, Homer’s Hero editors Human Excellence in the Iliad and the Odyssey The Beauty of Detours Michelle M. Kundmueller A Batesonian Philosophy of Technology Yoni Van Den Eede Walter Benjamin’s Antifascist Education Being Measured From Riddles to Radio Truth and Falsehood Tyson E. Lewis in Aristotle’s Metaphysics Mark R. Wheeler www.sunypress.edu IMPORTANT NOTICES FOR MEETING ATTENDEES SESSION LOCATIONS Please note: this online version of the program does not include session locations. -

MICHAEL ZANK Boston University
MICHAEL ZANK Boston University 147 Bay State Road Boston MA 02215 (617) 353-4434 [email protected] Teaching and research areas German Jewish intellectual history and Continental philosophy; Political Theology; Jerusalem in history and religion; Bible and biblical reception; Hermann Cohen and neo-Kantianism; modern Jewish thought (esp. Buber and Rosenzweig); Philosophy of religion. Qualifications Ph.D. in Near Eastern and Judaic Studies, Brandeis University, Waltham, Mass., 1994 Erstes Theologisches Examen, Evangelische Kirche der Pfalz, Speyer am Rhein (Germany), 1986 Academic Position Full Professor of Religion and Jewish Studies College of Arts and Sciences, Boston University. Since Sept. 2010. Administrative Position Director, Elie Wiesel Center for Jewish Studies, Boston University, since 2013. Publications Books Jerusalem. A Brief History (Oxford: Blackwell Publ.). In production. Politics, Religion and Political Theology. Edited by Allen Speight and Michael Zank [Boston Series in Philosophy and Religion, ed. Allen Speight, vol. 3], Amsterdam: Springer Verlag, 2017. Jüdische Religionsphilosophie als Apologie des Mosaismus. [Religion in Philosophy and Theology, ed. Ingo Dalferth, vol. 88]. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. The Value of the Particular: Lessons from Judaism and the Modern Jewish Experience, Festschrift for Steven T. Katz on the Occasion of his Seventieth Birthday, edited by Michael Zank and Ingrid Anderson, with the editorial assistance of Sarah Leventer and an introduction by Michael Zank [Series: Journal for Jewish Thought and Philosophy Supplementa, ed. Elliot Wolfson et al.], Boston: Brill, 2015. Take A Teacher, Make A Friend. Students Write for Elie Wiesel, edited by Michael Zank and Leanne Hoppe, with an introduction by Michael Zank (Boston: Elie Wiesel Center for Judaic Studies, 2014).