Chronik Chronik Der Naturschutzarbeit Chro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amtsblatt Der Großen Kreisstadt Görlitz, Ausgabe 2008, Nr. 12
Amtsblatt der Kreisfreien Stadt Görlitz Nr. 12 /17. Jahrgan g 3. Juni 2008 Für Augen und Ohren: Der Tag der offenen Sanierungstür 2008 Alles zu sehen, was am diesjährigen Tag der offenen Sanierungstür gezeigt wird, dürfte nahe - zu unmöglich sein. 28 Objekte der Altstadt und im Gründerzeitgebiet sind am 15. Juni zwi - schen 10:00 und 17:00 Uhr für die Besucher geöffnet. Dem veranstaltenden Stadtplanungs- und Bauordnungsamt ging es in diesem Jahr verstärkt darum, an dem lange zur guten Tra - dition gewordenen Tag der offenen Sanie - rungstür nicht nur sanierte und unsanierte Gemäuer und Flure zu zeigen, sondern diese auch zum Leben zu erwecken. Ausstellungen, Konzerte, Sport- und Spiel - aktivitäten laden an vielen Stellen zum län - geren Verweilen ein. Einzelne Höhepunkte aus dem umfangreichen Veranstaltungska - lender besonders hervorzuheben, fällt daher schwer. Ein Anziehungspunkt dürfte zweifel - los der Weinbergturm sein, der nach seiner Rekonstruktion bestiegen werden kann. Um 14 Uhr gibt es dort auch ein Turmblasen und danach eine botanische Führung zum Thema „Hängewälder und Neißeaue“ mit Dr. Sieg - fried Bräutigam vom Staatlichen Museum für Naturkunde. Den musikalischen Höhepunkt 11:00 Uhr in der Frauenkirche. Auch Kin - Sanierung ebenso wie der neu gestaltete des Tages setzt die Musikschule Johann dereinrichtungen sind an diesem Sonntag Schulhof der Grundschule 1 auf der Schul - Adam Hiller aber schon am Vormittag auf wieder offen, die neu gebaute Kindertages - straße 3. Für das leibliche Wohl der Besu - dem neu gestalteten Lutherplatz mit einem stätte auf der Biesnitzer Straße 89 und die cher wird an vielen Stellen im Stadtgebiet Platzkonzert vom deutsch-polnischen auf der Otto-Müller-Straße 4 - 6 vor deren gesorgt. -

U21-Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA Fachbeitrag WRRL Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis ...................................................................................................... 3 1 Einleitung ................................................................................................................. 4 1.1 Anlass und Zielstellung ................................................................................................ 4 1.2 Rechtliche Grundlagen ................................................................................................. 5 2 Fachliche Grundlagen ............................................................................................ 7 2.1 Bewertung von Oberflächenwasserkörpern nach WRRL .............................................. 7 2.1.1 Biologische Qualitätskomponenten ....................................................................... 7 2.1.2 Hydromorphologische Qualitätskomponenten ....................................................... 8 2.1.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten .................................. 8 2.1.4 Flussspezifische Schadstoffe .............................................................................. 10 2.1.5 Chemische Qualitätskomponenten ...................................................................... 10 2.2 Bewertung von Grundwasserkörpern nach WRRL ..................................................... 11 2.2.1 Mengenmäßiger Zustand .................................................................................... 11 -

Sternradfahrt.De
www.sternradfahrt.de 18. STERNRADFAHRT AM 11. MAI 2019 STEMPELSTELLEN UND TouREN RÜCKTRANSFER SEIFHENNERSDORF unter: Sie erhalten Sternradfahrt zur Informationen Nähere auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Herausgeber. die durch Genehmigung schriftlichen der bedürfen auszugsweise, auch An allen Stempelstellen entlang der ausgewiesenen Tou- Rücktransfer: Für müde Radler stehen ab Seifhenners- „KiEZ“ steht für Kinder- und Jugenderholungszentren. Vervielfältigung, oder Nachdruck vorbehalten. Rechte Alle © März 2019 März © ren erhalten Sie zwischen 9 und 15 Uhr (an den Startstem- dorf wieder Rückbusse gegen eine Gebühr von 7 Euro Sie sind multifunktionale Gruppenunterkünfte für Erho- Druck Graphische Werkstätten Zittau GmbH Zittau Werkstätten Graphische STERNRADFAHRT SEIFHENNERSDORF Kartengrundlage ENO mbH und Geoportal Sachsenatlas Geoportal und mbH ENO pelstellen ab 8 Uhr) einen Teilnahmepass, mit dem Sie pro Erwachsener und Fahrrad bzw. 3,50 Euro pro Kind und lungs-, Bildungs-, Freizeit- und Sportaufenthalte mit der Trebizan (Adobe Stock) Stock) (Adobe Trebizan Fotografen Samo © Titelfoto: Querxenland, KiEZ Wilhelm, Peter Goschütz, Ingo Ankunft in Seifhennersdorf bis 15.30 Uhr unterwegs Stempel sammeln können. Mit dem ausge- Fahrrad zur Verfügung: Näheres zu den Abfahrtszeiten KiEZ Querxenland in Seifhennersdorf Möglichkeit pädagogischer Angebote. Namensgeber des Satz und Gestaltung und Satz rielle Kohlschmidt (Blendwerck) Kohlschmidt rielle A füllten Teilnahmepass (mindestens drei unterschiedliche und den -

Kurzumtriebsplantagen Auf Ackerland – Ökonomische Bewertung Einer Anbauoption Mit Ökologischen Vorteilen Am Beispiel Des Freistaats Sachsen
Kurzumtriebsplantagen auf Ackerland – ökonomische Bewertung einer Anbauoption mit ökologischen Vorteilen am Beispiel des Freistaats Sachsen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) der Naturwissenschaftlichen Fakultät III Agrar‐ und Ernährungswissenschaften, Geowissenschaften und Informatik der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg vorgelegt von Herrn Kröber, Mathias Geb. am 25.01.1982 in Eilenburg Gutachter: Prof. Dr. Peter Wagner Prof. Dr. Albrecht Bemmann Verteidigung am 03.12.2018 Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundforschungsprojekts AgroForNet (Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch die Vernetzung von Produzenten und Verwertern von Dendromasse für die energetische Nutzung) an der Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg. Für die erhaltene Unterstützung, vor allem aber für den gewährten Freiraum während der Erstellung der Arbeit, bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Prof. Dr. Peter Wagner. Weiterhin danke ich besonders Herrn Dr. Jürgen Heinrich für seine unzähligen Hinweise, Verbesserungsvorschläge sowie die teilweise stundenlangen Diskussionen zur fachlichen Durchdringung spezieller Teilfragen. Zudem gilt Herrn Dr. Thomas Chudy ein spezieller Dank für die wunschgenaue Darstellung der zahlreichen Abbildungen im Text. Ebenfalls möchte ich mich bei allen Projektkollegen für die konstruktive Zusammenarbeit sowie den Erfahrungsaustausch bedanken. Besonders zu nennen ist hier Herr Hendrik Horn für die Bereitstellung der Daten zur Biomasseertragsschätzung, auf denen ein Großteil meiner in der Arbeit untersuchten Betrachtungen aufbaut. Insgesamt danke ich allen Mitarbeitern der Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre sowie der Professur für Unternehmensführung im Agribusiness für die häufig spontane und jederzeit unkomplizierte Hilfe bei der Bewältigung von kleineren und größeren Problemen. Nicht zuletzt gehört mein ausdrücklicher Dank meiner Familie und meinen Freunden. -

Pre-Event Water Contributions and Streamwater Residence Times in Different Land Use Settings of the Transboundary Mesoscale Lužická Nisa Catchment
J. Hydrol. Hydromech., 65, 2017, 2, 154–164 DOI: 10.1515/johh-2017-0003 Pre-event water contributions and streamwater residence times in different land use settings of the transboundary mesoscale Lužická Nisa catchment Martin Šanda1*, Pavlína Sedlmaierová1, Tomáš Vitvar1, Christina Seidler2, Matthias Kändler2, Jakub Jankovec1, Alena Kulasová3, František Paška4 1 Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic. 2 Technische Universität Dresden, International Institute Zittau, Markt 23, 02763 Zittau, Germany. 3 T. G. Masaryk Water Research Institute, Podbabská 30, Prague 6, Czech Republic. 4 Crop Research Institute, Drnovská 507, Prague 6, Czech Republic. * Corresponding author. Tel.: +420 22435 3739. Fax: +420 233324861. E-mail: [email protected] Abstract: The objective of the study was to evaluate the spatial distribution of peakflow pre-event water contributions and streamwater residence times with emphasis on land use patterns in 38 subcatchments within the 687 km2 large mesoscale transboundary catchment Lužická Nisa. Mean residence times between 8 and 27 months and portions of pre- event water between 10 and 97% on a storm event peakflow were determined, using 18O data in precipitation and streamwater from a weekly monitoring of nearly two years. Only a small tracer variation buffering effect of the lowland tributaries on the main stem was observed, indicating the dominant impact on the mountainous headwaters on the runoff generation. Longest mean streamwater residence times of 27 months were identified in the nearly natural headwaters of the Jizera Mountains, revealing no ambiguous correlation between the catchment area and altitude and the mean resi- dence time of streamwater. -

NACHRICHTENBLATT Der Verwaltungsgemeinschaft Der Gemeinde Großschönau Mit Dem Erholungsort Waltersdorf Und Der Gemeinde Hainewalde
NACHRICHTENBLATT der Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde Großschönau mit dem Erholungsort Waltersdorf und der Gemeinde Hainewalde 18. Jahrgang – Nr. 2 15. Februar 2019 0,50 € Liebe Leserinnen und Leser des Nachrichtenblattes, mit Beginn der Winterferien in Sachsen hoffen wir im Zittauer Gebirge auch auf ausreichend Schnee und schönes Winterwetter, damit auch viele Gäste zu uns kommen. Nun ist es aber kein Geheimnis, dass unsere Region nicht zu den schneesicheren Gebieten zählt. Dafür fehlen uns die berühmten 200, 300 Höhenmeter. Daher ist der Ansatz „Winterurlaub im Zittauer Gebir- ge mit und ohne Schnee“ aus meiner Sicht vernünftig. Schließlich haben wir auf engstem Raum viele touris- tische Attraktionen, die auch ohne Schnee genutzt werden können, ob im TRIXI-Bad, im Naturparkhaus – jetzt wieder mit dem Kinderland – oder im Deutschen Damast- und Frottiermuseum werden vielfältige An- gebote vorgehalten. Auch in den Nachbarorten wird mit einer breiten touristischen Infrastruktur (Eishalle, Schmetterlingshaus etc.) einiges geboten. Dennoch ist es sehr wichtig, dass wenn es das Wetter zulässt, Möglichkeiten für Wintersportler anzubieten. Das läuft vorbildlich am Lauschehang oder beim Spuren von Skiwanderwegen, vor allem wenn man bedenkt, dass das alles von Enthusiasten im Ehrenamt abgesichert wird. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön und den Schülern schöne Winterferien! Auch hier im Nachrichtenblatt haben wir Sie über die Entwicklungen im Zukunftsprozess „Großschönau 2030“ auf dem Laufenden gehalten. Die Gemeinde Großschönau wurde neben sieben anderen deut- schen Kommunen im Rahmen des bundesweiten Forschungsfeldes auf dem Gebiet „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ für das Projekt „Potentia- le von Kleinstädten in peripheren Lagen“ ausgewählt. Ein wesentlicher Bestandteil des daraus entstandenen Zukunftsprozesses „Großschönau 2030“ war die enge Beteiligung der Großschönauer Bürger, der Jugendli- chen im Ort, der örtlichen Vereine und der ansässigen Unternehmen. -
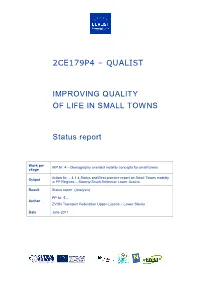
2Ce179p4 – Qualist Improving Quality of Life in Small
2CE179P4 – QUALIST IMPROVING QUALITY OF LIFE IN SMALL TOWNS Status report Work pa- WP Nr. 4 – Demography oriented mobility concepts for small towns ckage Action Nr. – 4.1.4 Status and Best practice report on Small Towns mobility Output in PP Regions – Saxony/South Bohemia/ Lower Austria Result Status report (Analysis) PP Nr. 5 – Author ZVON Transport Federation Upper-Lusatia – Lower Silesia Date June 2011 Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Preliminary remarks This “Small Towns Mobility Status Report in the PP-regions” grew out of two sub-reports: - Small towns mobility status Report (data collection, analysis of regional small towns mobility status reports, development of report for all RR regions incl. Best best practices) Responsible: Saxony Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport - Mobility Report (Status and Best practice report on Small towns in the PP regions) Responsible: Transport Federation Upper-Lusatia – Lower- Silesia (ZVON) The editorial process was carried out by the consulting engineers - LUB Consulting GmbH, Dresden - ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden 2CE179P4 - QUALIST Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Index 1 Introduction................................................................................ 1 2 Brief description of study area.................................................... 2 2.1 Saxon Vogtland .................................................................. -

District Heating in Lusatia
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg District Heating in Lusatia Status Quo and Prospects for Climate Neutrality Fernwärme in der Lausitz Status quo und Perspektiven für Klimaneutralität Thesis for the degree of Master of Science in Environmental and Resource Management submitted by Jan Christian Bahnsen 1st Examiner: Prof. Dr. Bernd Hirschl 2nd Examiner: Katharina Heinbach Submitted: 29th May 2020 Statement of Authentication I hereby declare that I am the sole author of this master thesis and that I have not used any other sources other than those listed in the bibliography and identified as references. I further declare that I have not submitted this thesis at any other institution in order to obtain a degree. The content, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. ________________________________ _____________________________________ (Place, Date) (Signature) Abstract The master thesis at hand examines the potential of district heating in Lusatia. The thesis follows the approach of first identifying technical and economic potentials in general and then transferring them to the study region. For the quantitative determination of district heating potential in Lusatia, the status quo is determined and a GIS-based analysis is carried out with regard to minimum heat demand densities. The extent to which district heating is suitable for climate-neutral heat supply will be investigated using the potential of renewable and waste heat energy sources. Furthermore, the regional economic effects of developing these potentials are examined. The results show that despite an overall decline in heat demand, there is potential to increase the relative share of district heating in Lusatia. -

Anschriftenverzeichnis Stand: 17.08.2015
Anschriftenverzeichnis Stand: 17.08.2015 63002015 - EFV Bernstadt/Dittersbach - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Holger Fiebig, Teichweg 7, 02747 Herrnhut Telefon privat: 03587342572 E-Mail: [email protected] Leiter Jugendfußball Christian Volke, Am Flutgraben 7, 02748 Bernstadt Telefon privat: 035823/ 77752, Mobil: 0152 52795619 Schiedsrichterobmann Peter Selle, Herrnhuter Str. 29 C, 02748 Bernstadt a. d. Eigen Telefon privat: 035874 229766, Telefon geschäftl.: 035874 20081, Mobil: 01733569512 E-Mail: [email protected] SP Neißestadion Ostritz, Klosterstr. 39, 02899 Ostritz SP Sportplatz Bernstadt, Schulstr., 02748 Bernstadt a. d. Eigen SP Sportplatz Dittersbach OL, Dorfstraße 53, 02748 Bernstadt a. d. Eigen SP Stadion der Jugend Löbau, Stadionweg 5 A, 02708 Löbau 63002024 - Bertsdorfer SV - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Thomas Worm, Hauptstr. 34, 02763 Bertsdorf- Hörnitz Telefon privat: 03583 692735, Mobil: 015207183087 E-Mail: [email protected] Leiter Jugendfußball Gerd Kunath, Hauptstr. 134, 02763 Bertsdorf-Hörnitz Telefon privat: 03583 692811 E-Mail: [email protected] Schiedsrichterobmann Detlev Heidenreich, Hauptstr. 69, 02763 Bertsdorf-Hörnitz Telefon privat: 03583 / 692766 E-Mail: [email protected] SP Sportpl. a d Kirche Bertsdorf, Am Sportplatz 1, 02763 Bertsdorf SP Sportplatz Hörnitz, Heinestr., 02763 Bertsdorf-Hörnitz 63002042 - SV Blau-Weiß/Empor Deutsch-Ossig - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Heiko Müller, Lilienweg 24, 02827 Görlitz Telefon privat: 03581-731883, Telefon geschäftl.: -

Erläuterungen
Erläuterungen tat geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. il'Tansgegeben vom K. Finanz -Ministerium. Bearbeitet unter der Leitung Hermann Credner. Section Zittau -Oderwitz. Blatt 88 TOB TU. Siegert. Leipzig, in Coinmisaion bei W. Engeiniann. 1895. der Kurte nebit Erläuterungen 3 Hark. SECTION ZITTAU-ODERWITZ. Oberflächengestaltung. Section Zittau- Oderwitz gehört dem Bereiche des Südlausitzer Hügellandes an und besteht wesentlich aus einer mit flachen Wellen und Kücken besetzten Hochfläche von 300 bis 350 m Meereshöhe, welche hier und dort durch steilere Kuppen von z. Th. kegel- oder glockenförmiger Gestalt überragt wird. Eine derselben, der steile Kegel des Spitzberges bei Ober oderwitz erreicht 510,2 m, vier andere sind über 450 m hoch, nehm- lich der Sonnenhübel (469,2 m) , der Lindberg (460 m), der Schwarze Stein (456,9) und ein Gipfel im Westen des letzteren (452,5 m), während sich 13 Kuppen bis zu Höhen zwischen 400 und 450 m erheben. Die Entwässerung des Sectionsareales erfolgt nach der Mandau, oder direct nach der östlich von der Section strömenden Neisse. Die Thäler sind meist flach, nur die Mandau wird stellenweise (so in Hainewalde und bei Scheibe) von steileren Thalwänden begleitet. Die Mehrzahl derselben ist unsymmetrisch ausgebildet, und zwar ist dann fast ausnahmslos das nach Osten gelegene Gehänge steiler als die westliche Thalseite. Allgemeine geologische Zusammensetzung. Der Unter grund der gesammten Section wird vom Lausitzer Hauptgranit zusammengesetzt, und zwar theilen sich zwei Varietäten, der Lau sitzer Granitit und der Rumburger Granitit derart in das Gebiet, dass ersterer ungefähr die nordwestliche, letzterer die südöstliche Hälfte der Section einnimmt. Diese Granitite werden, wie überall in der Lausitz, so auch hier von Gängen eines feinkörnigen Granites, sowie von Diabas- und Quarzgängen, endlich von Basalten und l 2 SECTION ZITTAU-ODERWITZ. -

Große Baumpflanzaktion Obstbaumprojekt Wir Freuen Uns Auf Zahlreiche fl Eißige Helfer Bei Unserer Pfl Anzaktion Für Das Obstbaum- Projekt
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf 4. Jahrgang Nr. 47 Preis 0,75 Euro Oktober 2020 Große Baumpflanzaktion Obstbaumprojekt Wir freuen uns auf zahlreiche fl eißige Helfer bei unserer Pfl anzaktion für das Obstbaum- projekt. Die vielen Obstbäume aus der bewilligten LEADER-Kleinprojekteförderung sol- len in die Erde. Deshalb ran an die Spaten und Schaufeln! Wer nicht selbst mit anpacken kann, darf die fl eißigen Gärtner gern durch kulinarische Versorgung bei Laune halten. 24.10.2020 ab 08:00 Uhr Treff: Rittergutsplatz Beiersdorf %XQWHU)DPLOLHQQDFKPLWWDJ PLW0XVLNXQG 2EHUODXVLW]HU+XPRU 6RQQWDJ2NWREHU6 DEDE8KU(LQODVV8KU 6DDOGHV%LRPDUNWVLQ2SSDFK (LQWULWWIUHLXPHLQH6SHQGHZLUGJHEHWHQ .DIIHH.XFKHQ,PELVVDQJHERW 0LW+DQQHV7KRPDVXQG-RKDQQHV.OHWVFKND 0XVLN&DURODXQG6XVL &RURQD6FKXW]EHGLQJXQJHQVLQGHLQ]XKDOWHQ (VOlGW6LHKHU]OLFKHLQGHU)UHPGHQYHUNHKUVYHUHLQ2SSDFKH9 Seite 2 Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf 1. Oktober 2020 Öffentliche Bekanntmachungen und Informationen für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Erreichbarkeit der Verwaltung Was versteht man unter RATHAUS? Es handelt sich um ein Haus, in dem man Rat sucht. Uns ist nicht entgangen, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sich oftmals ratlos fühlen. Wir haben Verständnis und möchten Ihnen gern mitteilen, wie Sie die Verwaltung erreichen können. Unsere Sprechzeiten sind: Dienstag sowie Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten bitten wir Sie, einen Termin zu vereinbaren! Tel. Durchwahl Sachgebiet -

Der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf 2
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf 2. JahrgangNr. 22 Oktober 2018 Seite 2 Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf 1. Oktober 2018 Öffentliche Bekanntmachungen und Informationen für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mitteilungen aus dem Haus des Gastes „Schützenhaus“ ACHTUNG TERMINÄNDERUNG Blutspende der Erde in Jutschugei (Nordostsibirien) bis hin nach Marble Bar zum heißesten Ort Australiens. Der für das Haus des Gastes „Schützenhaus“ Oppach Die Route führte von Rostock über Russland in die vorgesehene Blutspendentermin des DRK fi ndet am Mongolei, weiter mit unterschiedlichen Gefährten nach 05.10.2018 in der gewohnten Zeit von 15:00 bis 18:30 Uhr China, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapur bis (nicht wie ursprünglich vorgesehen am 19.10.2018) Australien. Hauptmission: Erstmaliger Aufbau zweier statt. Wetterstationen in Jutschugei (Nordostsibirien). Reisebericht Lassen Sie sich unterhalten und von spannenden Aben- im Haus des Gastes „Schützenhaus“ teuern inspirieren. Am 10.10.2018 um 19:30 Uhr spricht Ronald Prokein über seine siebente Tour vom neu entdeckten Kältepol Karten (freie Platzwahl gibt es im Vorverkauf zum Preis von 10 € (Ermäßigt: Schüler, Rentner, Schwer- behinderte 9 €) in der Gemeindeverwaltung Oppach. Vorschau November Pittiplatsch und seine Freunde Einen wunderschönen Herbsttag mit viel Sonnenschein wünschen Pittiplatsch und seine Freunde und laden herzlich ein - zu einer bunten Kinder-und Familienshow mit vielen Liedern, lustigen Szenen und einem Wieder- sehen