Armin Burkhardt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Perfekte Saison Der Dösis Bayern München 3 22 S, 8 U, 4 N B
MITTWOCH, 9. OKTOBER 2013 50 JAHRE BUNDESLIGA 11 2003/2004 GROSSE SPIELE 1. Werder Bremen Perfekte Saison der Dösis Bayern München 3 22 S, 8 U, 4 N B. Leverkusen 3 74 Pkt., 79:38 Tore Trainer: Thomas Schaaf Serie (41) – 2003/04: Werder räumt ab – Dortmunder Kartenhaus stürzt ein 20. September 2003: Zwei- mal liegen die Bayern zurück, Jörg Butt hält einen Ballack- 2. Bay. München Elfmeter, Zé Roberto fliegt 20 S, 8 U, 6 N vom Platz – und Oliver Kahn 68 Pkt., 70:39 Tore zeigt Schwächen, die man Trainer: Ottmar Hitzfeld nicht kennt, an die man sich aber gewöhnen muss. 3. B. Leverkusen 19 S, 8 U, 7 N VfL Bochum 3 65 Pkt., 73:39 Tore Bor. Dortmund 0 Trainer: Klaus Augenthaler 26. Oktober 2003: Klein ge- 4. VfB Stuttgart gen Groß, Arm gegen Reich – der VfL feiert dank der über- 18 S, 10 U, 6 N ragenden Torschützen Vahid 64 Pkt., 52:24 Tore Hashemian und Sunday Oli- Trainer: Felix Magath seh einen Sensationssieg, der ihn auf Platz sechs und bis 5. VfL Bochum auf einen Punkt an den BVB 15 S, 11 U, 8 N heranbringt. Aber es kommt noch besser … 56 Pkt., 57:39 Tore Trainer: Peter Neururer Bor. Dortmund 0 6. Bor. Dortmund FC Schalke 04 1 16 S, 7 U, 11 N 55 Pkt., 59:48 Tore 30. Januar 2004: Im Trai- Trainer: Matthias Sammer nerduell zwischen Matthias Sammer und Jupp Heynckes triumphiert der Neu-Schal- 7. FC Schalke 04 ker. Weil Frank Rost zwei Elf- 13 S, 11 U, 10 N meter hält – erst von Jan Kol- 50 Pkt., 49:42 Tore ler, dann von Torsten Frings Trainer: Jupp Heynckes – und Ebbe Sand kurz vor Schluss trifft. -

Topps Match Attax Bundesliga 2008/2009
www.soccercardindex.com Topps Match Attax German Bundesliga 2008/09 checklist Herta Berlin Werder Bremen Eintracht Frankfurt Hoffenheim □1 Jaroslav Drobny □55 A Tim Wiese (Citybank) □109 Markus Pröll 163 Ramazan Özcan □2 Josip Simunic □55 B Tim Wiese (Bwin) □110 Aaron Galindo 164 Andreas Beck □3 Kaka Ii □56 Sebastian Boenisch □111 Christoph Spycher 165 Andreas Ibertsberger □4 Marc Stein □57 Naldo □112 Habib Bellaid 166 Isaac Vorsah □5 Sofian Chahed □58 Per Mertesacker □113 Marco Russ 167 Marvin Compper □6 Steve Von Bergen □59 Petri Pasanen □114 Patrick Ochs 168 Matthias Jaissle □7 Cicero Santos □60 Sebastian Prödl □115 Benjamin Köhler 169 Per Nilsson □8 Fabian Lustehberger □61 Clemens Fritz □116 Caio 170 Zsolt Löw □9 Gojko Kacar □62 Daniel Jensen □117 Chris 171 Francisco Copado □10 Lukasz Piszczek □63 Frank Baumann □118 Faton Toski 172 Jochen Seitz □11 Maximilian Nicu □64 Jurica Vranjes □119 Junichi Inamoto 173 Luis Gustavo □12 Pal Dardai □65 Mesut Özil □120 Markus Steinhöfer 174 Sejad Salihovic □13 Patrick Ebert □66 Aaron Hunt □121 Michael Fink 175 Selim Teber □14 Valeri Domovchiyski □67 Boubacar Sanogo □122 Alexander Meier 176 Demba Ba □15 Andrej Voronin □68 Claudio Pizarro □123 Martin Fenin 177 Vedad Ibisevic □16 Raffael □69 Hugo Almeida □124 Nikos Liberopoulos 178 Wellington □17 Star - Arne Friedrich □70 Markus Rosenberg □125 Star - Ümit Korkmaz 179 Star - Carlos Eduardo □18 Star - Marko Pantelic □71 Star - Diego □126 Star - Ioannis Amanatidis 180 Star - Chinedu Obasi □72 Star - Torsten Frings Arminia Bielefeld Hamburger Sv Karlsruher -

Panini Champions League UK Edition 2007-08
www.soccercardindex.com 2007/08 Panini UEFA Champions League checklist (UK + US edition) Goalkeepers 52 Fabio Grosso 104 Ieroklis Stoltidis 1 Dida 53 Gael Givet 105 Fabian Ernst 2 Manuel Neuer 54 Carlos Salcido 106 Ryan Giggs 3 Iker Casillas 55 Sergio Ramos 107 Clarence Seedorf 4 Raphael Schafer 56 Maxwell 5 Gregory Coupet Forwards 6 Doni Midfielders 108 Samuel Eto'o 7 Petr Cech 57 Kim Kallstrom 109 Quaresma 8 Edwin Van Der Sar 58 Levan Kobiashvili 110 Filippo Inzaghi 9 Julio Cesar 59 Joe Cole 111 Gonzalo Gerardo Higuain 10 Helton 60 Daniele De Rossi 112 Kader Keita 11 Cedric Carrasso 61 Sami Khedira 113 Zlatan Ibrahimovic 12 Antonios Nikopolidis 62 Modeste M'Bami 114 Claudio Pizarro 13 Gomes 63 Fernando Ruben Gago 115 Ludovic Giuly 14 Vladimir Sojkovic 64 Andrea Pirlo 116 Ronaldinho 65 Michael Carrick 117 Jefferson Farfan Defenders 66 Deco 118 Mario Gomez 15 Kakha Kaladze 67 Ibrahim Afellay 119 Cristiano Ronaldo 16 Pepe 68 Thomas Hitzlsperger 120 Danko Lazovic 17 Bosingwa 69 Darren Fletcher 121 Gerald Asamoah 18 John Terry 70 Alberto Aquilani 122 Mirko Vicinic 19 Christian Panucci 71 Kaka 123 Thierry Henry 20 Rio Ferdinand 72 Dejan Stankovic 124 Djibril Cisse 21 Fernando Meira 73 Michael Ballack 125 David Suazo 22 Christoph Metzelder 74 Samir Nasri 126 Liedson 23 Jan Kromkamp 75 Miguel Veloso 127 Sidney Govou 24 Julio Cezar 76 Juninho Pernamucano 128 Ruud Van Nistelrooy 25 Anthony Reveillere 77 Rodrigo Taddei 129 Julio Ricardo Cruz 26 Julien Rodriguez 78 Paul Scholes 130 Didier Drogba 27 Philippe Mexes 79 Timmy Simons 131 Alberto Gilardino -

Wir Feiern in Berlin!
33 2017 DER 10. CDN-GEBURTSTAG WIR FEIERN IN BERLIN! AUF DEM WEG PHILIPP LAHMS „FÜR MICH WIE ZUM 5. STERN NÄCHSTE MISSION EIN LOTTOGEWINN“ DIE MANNSCHAFT blieb 2017 Ehrenspielführer und Serie: Hans Siemensmeyer unbesiegt und geht als Nr. 1 deutscher EM-Botschafter über sein bemerkenswertes der Weltrangliste ins WM-Jahr 10 für die EURO 2024 16 Debüt für Deutschland 30 INHALT 2 CDN-MAGAZIN 33 | 2017 6 Berlin Auf geht’s zur Nacht des großen Wiedersehens 10 Auf zum 5. Stern DIE MANNSCHAFT blieb 2017 unbesiegt und geht als Nr. 1 der Weltrangliste ins WM-Jahr 16 Neues Leben Neue Aufgaben Als Botschafter der Bewerbung um die Ausrichtung der EURO 2024 wird Lahm das Gesicht der deutschen Kampagne INHALT CDN-MAGAZIN 33 | 2017 3 30 „Das war für mich wie ein Lottogewinn“ Zwei Tore zum Einstand im Nationalteam EDITORIAL Von Szymaniak bis Kroos – Vom Profi zum „Pauker“ ein Überblick über die AUS DER KÖNIGS- Uwe Seelers Bilanz und Ausblick auf Nationalspieler im Ausland KLASSE INS den 10. Geburtstag des Clubs der IM AUSLAND GEREIFT 18 KLASSENZIMMER 38 Nationalspieler „ DER CDN – EINE EINHEIT OHNE STANDESDÜNKEL“ 4 VOR 25 JAHREN WEIHNACHTSTOURNEEN DER DDR-AUSWAHL Vor 25 Jahren starb Ernst Happel INSIDE CDN „ BIS HEUTE Weihnachten im Kreis der Familie – WEGWEISEND“ 22 in den 60er-Jahren war das für DDR- Nach 2010 kommen die Mitglieder Nationalspieler eher Ausnahme des CdN wieder im Berliner WEIHNACHTEN Olympiastadion zusammen VOR 50 JAHREN ZWISCHEN BERLIN, BERLIN, FERNWEH & HEIMWEH 42 WIR FEIERN IN BERLIN 6 Ein einziges Mal scheiterte Deutschland schon im Rahmen des Qualifikationswettbewerbs INSIDE CDN AKTUELL IM BLICKPUNKT DER ALBTRAUM VON ALBANIEN 26 Hervorragende Beteiligung beim 2017 – eins der erfolgreichsten regionalen CdN-Treffen in Köln – Jahre der DFB-Historie unvergessen: AUF ZUM 5. -

FC Carl Zeiss Jena FC Schalke 04
AnpfiffDas offizielle Stadionmagazin des FC Carl Zeiss Jena DFB-Pokal | Saison 2008/09 | Ausgabe 14 | Preis: 1 Euro Pokalschreck Jena möchte auch die Knappen ärgern Großes Interview: Max Plötner denkt an frühere Zeiten zurück Lars Fuchs ist neu beim FC Carl Zeiss Heutiger Ballsponsor: Köstritzer Schwarzbierbrauerei Unser Hauptsponsor: DM – Deutsche Massivhaus GmbH Achtelfinale — 27. Januar 2009 — 19 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC Schalke 04 VORWORT Sportlicher Inhalt Vorwort ..................................... 3 Augenblicke .......................... 4/5 Höhepunkt Heute im Stadion ...................... 7 Hinter den Kulissen .............. 9/11 Von Peter Schreiber, Präsident des FC Carl Zeiss Jena So lief es in der Liga .................13 In Jena zu Gast ............... 14/15/16 Interview .............................18/19 Liebe Fans, dem heutigen Spiel bereits ein Pokal total ............................... 20 liebe Sponsoren und Förderer, großes Geschenk gemacht. Alle Daten und Fakten .................... 21 liebe Gäste, gemeinsam haben sich durch die Aufgebote ......................... 22/23 liebe Manschaft des FCC, positiven und erfolgreichen DFB- Pokalauftritte gegen die Zweitli- Unsere Mannschaft ........... 24/24 mit dem heutigen Achtelfinale gisten 1. FC Kaiserslautern bzw. Zahlensalat ....................... 27/28 im DFB-Pokal-Wettbewerb gegen FSV Frankfurt dieses Spiel redlich Rückrundenspielplan .............. 31 den FC Schalke 04 erwartet uns erarbeitet und verdient. Premium Partner ......................32 ein sportlicher Höhepunkt, -

Korea DPR - Côte D'ivoire 0:3 (0:2) # 46 25 JUN 2010 16:00 Nelspruit / Mbombela Stadium / RSA Att
2010 FIFA World Cup South Africa™ Match Report Group G Korea DPR - Côte d'Ivoire 0:3 (0:2) # 46 25 JUN 2010 16:00 Nelspruit / Mbombela Stadium / RSA Att. 34,763 Referee: Alberto UNDIANO (ESP) Assistant Referee 1: Fermin MARTINEZ (ESP) Assistant Referee 2: Juan Carlos YUSTE JIMENEZ (ESP) 4th Official: Massimo BUSACCA (SUI) Reserve Assistant Referee: Matthias ARNET (SUI) Match Commissioner: Fred DE JONG (NZL) General Coordinator: Yon DE LUISA (MEX) Goals Scored: Yaya TOURE (CIV) 14' , ROMARIC (CIV) 20' , Salomon KALOU (CIV) 82' Korea DPR (PRK) Côte d'Ivoire (CIV) [ 1] RI Myong Guk (GK) [ 1] Boubacar BARRY (GK) [ 2] CHA Jong Hyok [ 3] Arthur BOKA [ 3] RI Jun Il [ 4] Kolo TOURE [ 4] PAK Nam Chol [ 5] Didier ZOKORA [ 5] RI Kwang Chon [ 9] Ismael TIOTE [ 8] JI Yun Nam [ 10] GERVINHO (-64') [ 9] JONG Tae Se [ 11] Didier DROGBA (C) [ 10] HONG Yong Jo (C) [ 13] ROMARIC (-79') [ 11] MUN In Guk (-67') [ 18] Kader KEITA (-64') [ 13] PAK Chol Jin [ 19] Yaya TOURE [ 17] AN Yong Hak [ 21] Emmanuel EBOUE Substitutes: Substitutes: [ 6] KIM Kum Il [ 2] Brou ANGOUA [ 7] AN Chol Hyok [ 6] Steve GOHOURI [ 12] CHOE Kum Chol (+67') [ 7] Seydou DOUMBIA (+79') [ 14] PAK Nam Chol [ 8] Salomon KALOU (+64') [ 15] KIM Yong Jun [ 12] Jean Jacques GOSSO [ 16] NAM Song Chol [ 14] Emmanuel KONE [ 18] KIM Myong Gil (GK) [ 15] Aruna DINDANE (+64') [ 19] RI Chol Myong [ 16] Aristide ZOGBO (GK) [ 20] KIM Myong Won (GK) [ 17] Siaka TIENE [ 21] RI Kwang Hyok [ 22] Souleymane BAMBA [ 22] KIM Kyong Il [ 23] Daniel YEBOAH (GK) [ 23] PAK Sung Hyok [ 20] Guy DEMEL (I) Coach KIM Jong Hun (PRK) Coach Sven Göran ERIKSSON (SWE) Cautions: Expulsions: Additional Time: First half: 0 min., second half: 5 min. -

Ist Nachwuchsförderung Im Deutschen Fußball Sportlich Und Finanziell Rentabel?
BACHELORARBEIT Herr Jan-Hendrik Schmidt Ist Nachwuchsförderung im deutschen Fußball sportlich und finanziell rentabel? Eine Analyse der Umsetzung der Vorgaben des DFB am Beispiel des Bundesligaver- eins Hamburger SV 2011 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Ist Nachwuchsförderung im deut- schen Fußball sportlich und finan- ziell rentabel? Eine Analyse der Umsetzung der Vorgaben des DFB am Beispiel des Bundesligavereins Hamburger SV Autor: Herr Jan-Hendrik Schmidt Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft Seminargruppe: AM08wJ1-B Erstprüfer: Prof. Dr. phil. Otto Altendorfer M.A Zweitprüfer: Diplom Sportwissenschaftler Andreas Horn Einreichung: Hamburg, 15.09.2011 Faculty of Media BACHELOR THESIS Is working with young talents ath- letically and financially profitable for the german football associa- tion? An analysis of standards imple- mented by the DFB based on the Bundesliga-Team Hamburger SV author: Mr. Jan-Hendrik Schmidt course of studies: Angewandte Medienwirtschaft seminar group: AM08wJ1-B first examiner: Prof. Dr. phil. Otto Altendorfer M.A second examiner: Diplom Sportwissenschaftler Andreas Horn submission: Hamburg, 15.09.2011 Inhalt Inhalt I Abbildungsverzeichnis III Abkürzungsverzeichnis IV 1 Einleitung 1 2 Der Deutsche Fußball Bund 4 2.1 DFB-Historie 5 2.2 Mitgliederstruktur des Deutschen Fußball Bundes 6 2.3 Organisation des Deutschen Fußball Bundes 8 2.4 Die Deutsche Fußball Liga und ihre Lizenzvorgaben für die Talentförderung 8 3 Nachwuchsförderung in Deutschland 10 3.1 Knackpunkt Europameisterschaft 200 in Holland/Belgien und -

Ya Tiene Preconvocados
06/05/2010 11:05 Cuerpo D Pagina 3 Cyan Magenta Amarillo Negro 3 EL SIGLO DE DURANGO | VIERNES 7 DE MAYO DE 2010 | Alemania ya tiene preconvocados Encabeza Michael Ballack lista de los jugadores para el EFE Negociación. Un diario inglés asegura que el PSV y Tottenham es- Mundial. tán negociando el pase del defensa mexicano. EFE Berlín, Alemania Tottenham tiene El mediocampista del Chel- sea, Michael Ballack, encabe- za la convocatoria provisional interés por el Maza alemana, de 27 jugadores, pre- sentada por el técnico Joa- NOTIMEX The World, Francisco ‘Maza’ chim Low para el Mundial de Londres, Inglaterra Rodríguez es del total agrado Sudáfrica. del entrenador Harry Low deberá, antes del 1 de El Tottenham, de la Liga Pre- Redknapp, quien anhela con- junio, hacer cuatro descartes mier de Inglaterra, pretende formar un equipo competitivo para presentar la lista defini- contratar al defensa mexica- para afrontar la Liga de Cam- tivaalaFIFA. no Francisco ‘Maza’ Rodrí- peones, certamen en el que el guez, quien actualmente jue- Tottenham participará por PORTERÍA ga en el PSV Eindhoven de vez primera. El técnico, tras la baja del me- Holanda, a partir de la próxi- Francisco Rodríguez po- ta titular, Rene Adler, se deci- ma temporada. dría cubrir la defensa central dió por Jorg Butt, del Bayern Luego de conseguir su junto con el capitán Ledley Munich, como tercer portero. pase a la Liga de Campeones King. Además del mexicano La decisión sobre la titu- de Europa, los Spurs están se menciona el nombre del laridad en la portería, entre dispuestos a competir de la marfileño Amara Diane, pero Manuel Neuer y Tim Wiese, mejor manera contra rivales éste para reforzar el ataque de se tomará en las próximas de la élite mundial en la los Spurs. -
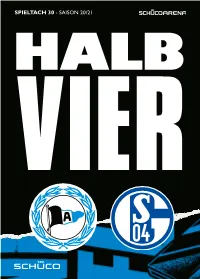
Spieltach 30 - Saison 20/21 Halb Vier Spieltach & Tabelle
SPIELTACH 30 - SAISON 20/21 HALB VIER SPIELTACH & TABELLE 30. SPIELTACH: 20.04. – 21.04. 31. SPIELTACH: 23.04. – 25.04. Di. 18:30 FC Köln - RB Leipzig Fr. 20:30 FC Augsburg - 1. FC Köln Di. 20:30 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Sa. abges. Schalke 04 - Hertha BSC Di. 20:30 FC Bayern - Bayer 04 Sa. 15:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Di. 20:30 Arminia Bielefeld - Schalke 04 Sa. 15:30 SC Freiburg - TSG Hoffenheim Mi. abges. Hertha BSC - SC Freiburg Sa. 15:30 Union Berlin - SV Werder Mi. 20:30 Borussia Dortmund - Union Berlin Sa. 15:30 Mainz 05 - FC Bayern Mi. 20:30 TSG Hoffenheim - Borussia M'gladbach Sa. 18:30 Bayer 04 - Eintracht Frankfurt Mi. 20:30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg So. 15:30 RB Leipzig - VfB Stuttgart Mi. 20:30 SV Werder - Mainz 05 So. 18:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld SP S U N Tore Diff Pkt 1. FC Bayern München 29 21 5 3 83:38 45 68 2. RB Leipzig 29 18 7 4 52:23 29 61 3. VfL Wolfsburg 29 15 9 5 51:29 22 54 4. Eintracht Frankfurt 29 14 11 4 59:44 15 53 5. Borussia Dortmund 29 15 4 10 62:42 20 49 6. Bayer 04 Leverkusen 29 13 8 8 48:32 16 47 7. Borussia M’gladbach 29 11 10 8 52:43 9 43 8. 1. FC Union Berlin 29 10 13 6 44:35 9 43 9. Sport-Club Freiburg 29 11 7 11 44:42 2 40 10. -

Discussion Papers
1432 Discussion Papers Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2014 Career Prospects and Eff ort Incentives: Evidence from Professional Soccer Jeanine Miklós-Thal and Hannes Ullrich Opinions expressed in this paper are those of the author(s) and do not necessarily reflect views of the institute. IMPRESSUM © DIW Berlin, 2014 DIW Berlin German Institute for Economic Research Mohrenstr. 58 10117 Berlin Tel. +49 (30) 897 89-0 Fax +49 (30) 897 89-200 http://www.diw.de ISSN electronic edition 1619-4535 Papers can be downloaded free of charge from the DIW Berlin website: http://www.diw.de/discussionpapers Discussion Papers of DIW Berlin are indexed in RePEc and SSRN: http://ideas.repec.org/s/diw/diwwpp.html http://www.ssrn.com/link/DIW-Berlin-German-Inst-Econ-Res.html Career Prospects and Effort Incentives: Evidence from Professional Soccer∗ Jeanine Mikl´os-Thaly Hannes Ullrichz Abstract It is difficult to test the prediction that future career prospects create implicit effort incentives because researchers cannot randomly \assign" career prospects to economic agents. To overcome this challenge, we use data from professional soccer, where employees of the same club face different external career opportunities de- pending on their nationality. We test whether the career prospect of being selected to a Euro Cup national team affects players' pre-Cup performances, using nationals of countries that did not participate in the Euro Cup as a control group. We find that the Euro Cup career prospect has positive effects on the performances of play- ers with intermediate chances of being selected to their national team, but negative effects on the performances of players whose selection is very probable. -

Panini World Cup 2006
soccercardindex.com Panini World Cup 2006 World Cup 2006 53 Cafu Ghana Poland 1 Official Emblem 54 Lucio 110 Samuel Kuffour 162 Kamil Kosowski 2 FIFA World Cup Trophy 55 Roque Junior 111 Michael Essien (MET) 163 Maciej Zurawski 112 Stephen Appiah 3 Official Mascot 56 Roberto Carlos Portugal 4 Official Poster 57 Emerson Switzerland 164 Ricardo Carvalho 58 Ze Roberto 113 Johann Vogel 165 Maniche Team Card 59 Kaka (MET) 114 Alexander Frei 166 Luis Figo (MET) 5 Angola 60 Ronaldinho (MET) 167 Deco 6 Argentina 61 Adriano Croatia 168 Pauleta 7 Australia 62 Ronaldo (MET) 115 Robert Kovac 169 Cristiano Ronaldo 116 Dario Simic 8 Brazil 117 Dado Prso Saudi Arabia Czech Republic 9 Czech Republic 170 Yasser Al Qahtani 63 Petr Cech (MET) 10 Costa Rica Iran 171 Sami Al Jaber 64 Tomas Ujfalusi 11 Ivory Coast 118 Ali Karimi 65 Marek Jankulovski 12 Germany 119 Ali Daei Serbia 66 Tomas Rosicky 172 Dejan Stankovic 13 Ecuador 67 Pavel Nedved Italy 173 Savo Milosevic 14 England 68 Karel Poborsky 120 Gianluigi Buffon (MET) 174 Mateja Kezman 15 Spain 69 Milan Baros 121 Gianluca Zambrotta 16 France 122 Fabio Cannavaro Sweden Costa Rica 17 Ghana 123 Alessandro Nesta 175 Freddy Ljungberg 70 Walter Centeno 18 Switzerland 124 Mauro Camoranesi 176 Christian Wilhelmsso 71 Paulo Wanchope 125 Gennaro Gattuso 177 Zlatan Ibrahimovic 19 Croatia 126 Andrea Pirlo 20 Iran Ivory Coast 127 Francesco Totti (MET) Togo 21 Italy 72 Kolo Toure 128 Alberto Gilardino 178 Mohamed Kader 22 Japan 73 Bonaventure -

Release List of up to 30 Players
Release list of up to 30 players Each association’s release list of up to 30 players was received by 11 May 2010 as per article 26 of the Regulations for the 2010 FIFA World Cup South Africa™. Mandatory rest period for players on the release list is from 17-23 May 2010 (except players involved in the UEFA Champions League final on 22 May). Each association must send FIFA a final list of no more than 23 players by 24.00 CET on 1 June 2010. Final list is limited to players on the release list submitted on 11 May 2010. Final list of 23 players will be published on FIFA.com at 12.00 CET on 4 June. Injured players may be replaced up to 24 hours before a team’s first match. Replacement players are not limited to the release list of up to 30 players. Liste de joueurs à libérer Les listes de joueurs à libérer (comportant jusqu’à 30 joueurs) ont été reçues de chaque association membre participante avant le 11 mai 2010 conformément à l’art. 26 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. La période de repos obligatoire à observer par les joueurs figurant sur la liste de joueurs à libérer (à l’exception des joueurs participant à la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA le 22 mai) est du 17 au 23 mai 2010. Chaque association doit envoyer à la FIFA une liste définitive comportant un maximum de 23 joueurs au plus tard le 1er juin 2010 à minuit (heure centrale européenne).