Insecta: Lepidoptera)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schutz Des Naturhaushaltes Vor Den Auswirkungen Der Anwendung Von Pflanzenschutzmitteln Aus Der Luft in Wäldern Und Im Weinbau
TEXTE 21/2017 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Forschungskennzahl 3714 67 406 0 UBA-FB 002461 Schutz des Naturhaushaltes vor den Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in Wäldern und im Weinbau von Dr. Ingo Brunk, Thomas Sobczyk, Dr. Jörg Lorenz Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Tharandt Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Professur für Forstzoologie, Prof. Dr. Mechthild Roth Pienner Straße 7 (Cotta-Bau), 01737 Tharandt Abschlussdatum: Januar 2017 Redaktion: Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutz Dr. Mareike Güth, Dr. Daniela Felsmann Publikationen als pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen ISSN 1862-4359 Dessau-Roßlau, März 2017 Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unter der Forschungskennzahl 3714 67 406 0 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. UBA Texte Entwicklung geeigneter Risikominimierungsansätze für die Luftausbringung von PSM Kurzbeschreibung Die Bekämpfung -

Moths of Poole Harbour Species List
Moths of Poole Harbour is a project of Birds of Poole Harbour Moths of Poole Harbour Species List Birds of Poole Harbour & Moths of Poole Harbour recording area The Moths of Poole Harbour Project The ‘Moths of Poole Harbour’ project (MoPH) was established in 2017 to gain knowledge of moth species occurring in Poole Harbour, Dorset, their distribution, abundance and to some extent, their habitat requirements. The study area uses the same boundaries as the Birds of Poole Harbour (BoPH) project. Abigail Gibbs and Chris Thain, previous Wardens on Brownsea Island for Dorset Wildlife Trust (DWT), were invited by BoPH to undertake a study of moths in the Poole Harbour recording area. This is an area of some 175 square kilometres stretching from Corfe Castle in the south to Canford Heath in the north of the conurbation and west as far as Wareham. 4 moth traps were purchased for the project; 3 Mercury Vapour (MV) Robinson traps with 50m extension cables and one Actinic, Ultra-violet (UV) portable Heath trap running from a rechargeable battery. This was the capability that was deployed on most of the ensuing 327 nights of trapping. Locations were selected using a number of criteria: Habitat, accessibility, existing knowledge (previously well-recorded sites were generally not included), potential for repeat visits, site security and potential for public engagement. Field work commenced from late July 2017 and continued until October. Generally, in the years 2018 – 2020 trapping field work began in March/ April and ran on until late October or early November, stopping at the first frost. -

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -
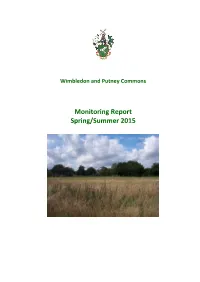
Monitoring Report Spring/Summer 2015 Contents
Wimbledon and Putney Commons Monitoring Report Spring/Summer 2015 Contents CONTEXT 1 A. SYSTEMATIC RECORDING 3 METHODS 3 OUTCOMES 6 REFLECTIONS AND RECOMMENDATIONS 18 B. BIOBLITZ 19 REFLECTIONS AND LESSONS LEARNT 21 C. REFERENCES 22 LIST OF FIGURES Figure 1 Location of The Plain on Wimbledon and Putney Commons 2 Figure 2 Experimental Reptile Refuge near the Junction of Centre Path and Somerset Ride 5 Figure 3 Contrasting Cut and Uncut Areas in the Conservation Zone of The Plain, Spring 2015 6/7 Figure 4 Notable Plant Species Recorded on The Plain, Summer 2015 8 Figure 5 Meadow Brown and white Admiral Butterflies 14 Figure 6 Hairy Dragonfly and Willow Emerald Damselfly 14 Figure 7 The BioBlitz Route 15 Figure 8 Vestal and European Corn-borer moths 16 LIST OF TABLES Table 1 Mowing Dates for the Conservation Area of The Plain 3 Table 2 Dates for General Observational Records of The Plain, 2015 10 Table 3 Birds of The Plain, Spring - Summer 2015 11 Table 4 Summary of Insect Recording in 2015 12/13 Table 5 Rare Beetles Living in the Vicinity of The Plain 15 LIST OF APPENDICES A1 The Wildlife and Conservation Forum and Volunteer Recorders 23 A2 Sward Height Data Spring 2015 24 A3 Floral Records for The Plain : Wimbledon and Putney Commons 2015 26 A4 The Plain Spring and Summer 2015 – John Weir’s General Reports 30 A5 a Birds on The Plain March to September 2015; 41 B Birds on The Plain - summary of frequencies 42 A6 ai Butterflies on The Plain (DW) 43 aii Butterfly long-term transect including The Plain (SR) 44 aiii New woodland butterfly transect -

Die Palpenmotten Nordwest-Deutschlands
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Faunistisch-Ökologische Mitteilungen Jahr/Year: 2000-2007 Band/Volume: 8 Autor(en)/Author(s): Wegner Hartmut, Kayser Christoph, Loh Hans-Joachim van Artikel/Article: Die Palpenmotten Nordwest-Deutschlands - eine Dokumentation der Beobachtungen in den Jahren 1981 - 2006 (Lepidoptera: Ge- lechiidae) 417-438 ©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at Faun.-Ökol.Mitt. 8, 417-438 Kiel, 2007 Die Palpenmotten Nordwest-Deutschlands - eine Dokumentation der Beobachtungen in den Jahren 1981 - 2006 (Lepidoptera: Ge- lechiidae) VonHartmut Wegner, Christoph Kayser & Hans-Joachim van Loh Summary The gelechiid moths of North-West Germany - a documentation of records made between 1981 and 2006 (Lepidoptera: Gelechiidae) As a result of recent observations, a first and special synopsis to the fauna of Gelechii dae in North-western Germany is compiled. Particularly remarkable species are pre sented and commented to supplementary. A checklist of all species is attached. New bionomie knowledge of some species is described, i.e. Xenolechia aethiops (H umphreys & W estwood , 1845). The zoo-geographic status of some individual species as bore- omontan is revised, i.e. Neofaculta infernella (H errich-Schàffer, 1854). A checklist of all other observed species is attached Einleitung Die Region Nordwest-Deutschland ist ein eiszeitlich geprägtes Tiefland mit höchsten Erhebungen von 169 m (Wilseder Berg in der Lüneburger Heide) und 168 m (Bungsberg in Ostholstein) über N.N., und umfasst die Bundesländer Schleswig- Holstein und das nördliche Niedersachsen inkl. Hamburg und Bremen. Die Grenze bilden im Norden Dänemark sowie die Nordsee- und Ostseeküste, im Westen die Niederlande, im Osten die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen- Anhalt und im Süden die Linie von 52° 30' nördlicher Breite. -
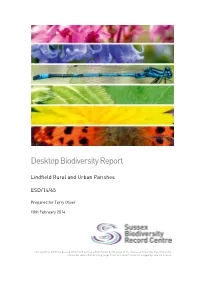
Desktop Biodiversity Report
Desktop Biodiversity Report Lindfield Rural and Urban Parishes ESD/14/65 Prepared for Terry Oliver 10th February 2014 This report is not to be passed on to third parties without prior permission of the Sussex Biodiversity Record Centre. Please be aware that printing maps from this report requires an appropriate OS licence. Sussex Biodiversity Record Centre report regarding land at Lindfield Rural and Urban Parishes 10/02/2014 Prepared for Terry Oliver ESD/14/65 The following information is enclosed within this report: Maps Sussex Protected Species Register Sussex Bat Inventory Sussex Bird Inventory UK BAP Species Inventory Sussex Rare Species Inventory Sussex Invasive Alien Species Full Species List Environmental Survey Directory SNCI L61 - Waspbourne Wood; M08 - Costells, Henfield & Nashgill Woods; M10 - Scaynes Hill Common; M18 - Walstead Cemetery; M25 - Scrase Valley Local Nature Reserve; M49 - Wickham Woods. SSSI Chailey Common. Other Designations/Ownership Area of Outstanding Natural Beauty; Environmental Stewardship Agreement; Local Nature Reserve; Notable Road Verge; Woodland Trust Site. Habitats Ancient tree; Ancient woodland; Coastal and floodplain grazing marsh; Ghyll woodland; Traditional orchard. Important information regarding this report It must not be assumed that this report contains the definitive species information for the site concerned. The species data held by the Sussex Biodiversity Record Centre (SxBRC) is collated from the biological recording community in Sussex. However, there are many areas of Sussex where the records held are limited, either spatially or taxonomically. A desktop biodiversity report from the SxBRC will give the user a clear indication of what biological recording has taken place within the area of their enquiry. -

Moths and Management of a Grassland Reserve: Regular Mowing and Temporary Abandonment Support Different Species
Biologia 67/5: 973—987, 2012 Section Zoology DOI: 10.2478/s11756-012-0095-9 Moths and management of a grassland reserve: regular mowing and temporary abandonment support different species Jan Šumpich1,2 &MartinKonvička1,3* 1Biological Centre CAS, Institute of Entomology, Branišovská 31,CZ-37005 České Budějovice, Czech Republic; e-mail: [email protected] 2Česká Bělá 212,CZ-58261 Česká Bělá, Czech Republic 3Faculty of Sciences, University South Bohemia, Branišovská 31,CZ-37005 České Budějovice, Czech Republic Abstract: Although reserves of temperate seminatural grassland require management interventions to prevent succesional change, each intervention affects the populations of sensitive organisms, including insects. Therefore, it appears as a wise bet-hedging strategy to manage reserves in diverse and patchy manners. Using portable light traps, we surveyed the effects of two contrasting management options, mowing and temporary abandonment, applied in a humid grassland reserve in a submountain area of the Czech Republic. Besides of Macrolepidoptera, we also surveyed Microlepidoptera, small moths rarely considered in community studies. Numbers of individiuals and species were similar in the two treatments, but ordionation analyses showed that catches originating from these two treatments differed in species composition, management alone explaining ca 30 per cent of variation both for all moths and if split to Marcolepidoptera and Microlepidoptera. Whereas a majority of macrolepidopteran humid grassland specialists preferred unmown sections or displayed no association with management, microlepidopteran humid grassland specialists contained equal representation of species inclining towards mown and unmown sections. We thus revealed that even mown section may host valuable species; an observation which would not have been detected had we considered Macrolepidoptera only. -

Redalyc.Miscellaneous Additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Maravalhas, E.; Passos de Carvalho, J. Miscellaneous additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 34, núm. 136, 2006, pp. 407-427 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513611 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 407-427 Miscellaneous addition 14/12/06 21:11 Página 407 SHILAP Revta. lepid., 34 (136), 2006: 407-427 SRLPEF ISSN:0300-5267 Miscellaneous additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, E. Maravalhas & J. Passos de Carvalho (†) Abstrac 143 species of Lepidoptera collected by the authors and others in various localities in Portugal are listed as additions to the Portuguese fauna. 26 of the species are new records for the Iberian Peninsula. Two species are deleted from the Portuguese list. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, distribution, Portugal. Adições à fauna de Lepidoptera de Portugal (Insecta: Lepidoptera) Resumo São referidas 143 espécies de Lepidoptera, coligidas de várias localidades de Portugal pelos autores e outros, que se considera serem novos registos para a fauna portuguesa. 26 destas espécies são também novas para a Península Ibérica. Dois registos são suprimidos. PALAVRAS CHAVE: Insecta, Lepidoptera, distribuição geográfica, Portugal. Adiciones a la fauna de Lepidoptera de Portugal (Insecta: Lepidoptera) Resumen Se citan 143 especies de Lepidoptera, cogidas en varios puntos de Portugal por los autores y otros, que se consideran nuevas para la fauna portuguesa. -

Die Schmetterlinge Oberösterreichs
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Die Schmetterlinge Oberösterreichs Im Auftrag der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum zu Linz herausgegeben von K. Kusdas und E. R. Reichl Teil 6: Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) I Bearbeiter: J. Klimesch Linz 1990 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Die Schmetterlinge Oberösterreichs Im Auftrag der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum zu Linz herausgegeben von K. Kusdas und E. R. Reichl Teil 6: Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) I Bearbeiter: J. Klimesch Linz 1990 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Die Drucklegung dieses Bandes wurde durch eine Subvention der Oberösterreichischen Landesregierung in dankenswerter Weise gefördert. © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Inhaltsübersicht Einführung 1 Literaturübersicht 9 Systematischer Teil: Micropterigidae 17 Eriocraniidae 21 Nepticulidae 23 Opostegidae 54 Tischeriidae 55 Incurvariidae 58 Heliozelidae 76 Tineidae 78 Ochsenheimeriidae 93 Lyonetiidae 95 Bucculatricidae 102 Gracillariidae 109 Phyllocnistidae 152 Ethmiidae 154 Stathmopodidae 157 Oecophoridae 158 Elachistidae 194 Coleophoridae 217 Blastodacnidae 247 Blastobasidae 249 Symmocidae 251 Batrachedridae 252 Momphidae -

Cheshire (Vice County 58) Moth Report for 2016
CHESHIRE (VICE COUNTY 58) MOTH REPORT FOR 2016 Oleander Hawk-Moth: Les Hall Authors: Steve H. Hind and Steve W. Holmes Date: May 2016 Cheshire moth report 2016 Introduction This was the final year of recording for the National Macro-moth Atlas. A few species were added to squares during daytime searches early in the year but any plans to trap in under- recorded squares were often thwarted by cold nights and it was not until mid-July that SHH considered it worthwhile venturing into the uplands. The overall atlas coverage in the county has been good and our results should compare well against the rest of the country, although there remain gaps in most squares, where we failed to find species which are most likely present. Hopefully these gaps will be filled over the next few years, as recording of our Macro-moths continue. As always, a list of those species new for their respective 10km squares during 2016 can be found after the main report. A special effort was made during the winter to add historical records from the collections at Manchester Museum and past entomological journals, which will enable us to compare our current data with that of the past. Now that recording for the Macro- moth atlas is over, our efforts turn to the Micro-moths and the ongoing Micro-moth recording scheme. There is a lot to discover about the distributions of our Micro-moths across the county and the increasing interest continues to add much valuable information. 2016 was another poor year for moths, with results from the national Garden Moth Scheme showing a 20% decline on 2015 (excluding Diamond-back Moth, of which there was a significant invasion). -

Sussex Moth Group Newsletter
SussexSussex MothMoth GroupGroup NewsletterNewsletter April 2016 Mottled Umber female by Keith Alexander Mottled Umber female Main features inside this issue: A December’s Death Head by David Burrows 2 National Moth News 3 Butterfly Conservation’s New Action Plan by Steve Wheatley 4 A Poem by Anony-moth 5 Mites on Moths by Hew Prendergast 7 2016 Events 10 Hastings Branch News by Crystal Ray 11 Discovering Moths Up North by Brad Scott 12 Committee members and 2016 indoor meeting dates Back page Chairman’s Corner We are already four months into 2016 and, although the temperatures are not exactly tropical, spring is definitely here and the trees and hedges are finally coming into leaf. Moths seem to have been in short supply so far this year but undoubtedly the numbers are going to be picking up week on week from now on. 2016 marks the last year of fieldwork for records to be included in the Na- tional Moth Atlas. Before Bob updated the database Sussex only had two 10km squares that were considered under-recorded by the NMRS standards with 50 or fewer records and 25 or fewer species (and these were both small slithers of land). We do however still have a wide spread in the num- ber of species recorded in each 10km square and undoubtedly this disparity in species records reflects recording effort more than it does species actual- ly present. Bob has now uploaded all outstanding moth records from the BRC onto our website so all of the species maps should now be up to date. -

Entomofauna in De Gemeente Ede Verslag Van De 170E NEV-Zomerbijeenkomst
174 entomologische berichten 76 (5) 2016 Entomofauna in de gemeente Ede Verslag van de 170e NEV-zomerbijeenkomst Oscar Franken Matty P. Berg TREFWOORDEN Faunistiek, Gelderland, geleedpotigen, inventarisatie, Veluwe Entomologische Berichten 76 (5): 174-195 In het weekend van 5 tot en met 7 juni 2015 is de 170e zomerbijeenkomst van de NEV gehouden. Dit jaar hebben de deelnemers in en om de gemeente Ede maar liefst 59 kilometerhokken geïnventariseerd op geleedpotigen. In totaal zijn er 1275 soorten insecten en andere geleedpotigen gevonden. Er zijn geen nieuwe soorten voor Nederland gevonden, maar er worden wel acht nieuwe soorten voor de provincie Gelderland gemeld. Dit relatief lage aantal nieuwe waarnemingen voor de provincie komt met name doordat de bezochte gebieden al zeer goed op ongewervelden geïnventariseerd zijn. Introductie Deelnemerslijst In het weekend van 5 tot en met 7 juni 2015 is de 170e zomerbij- B. Aukema, M.P. Berg, L. Blommers, J.J. Boehlé, R. de Boer, eenkomst van de NEV gehouden. Dit jaar hebben de deelnemers T. du Bois, J. Bokelaar, G. Bollen, S. Boon, T. Breeschoten, in en om de gemeente Ede geïnventariseerd, waarbij we met B. Brugge, T. van den Burg, P. Ciliberti, J.G.M. Cuppen, A.J. Dees, 48 entomologen (figuur 1) in groepsaccomodatie De Eiken Stek B. Drost, O. Franken, M. Franssen, C. Gielis, S. Gielis, K. Gigengack, (figuur 2) in Wekerom verbleven. De accommodatie was behalve T. de Goeij, W. Heitmans, J. ten Hoopen, W. van den Hoven, voor de overnachtingen ook uitermate geschikt voor het nut- H. Huijbregts, M. Jansen, R.Ph. Jansen, R.