Der Galgenkrieg 1531
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liniennetz Basel Und Umgebung Réseau Des Lignes Bâle Et Environs
Liniennetz DB nach/vers Haltingen/Freiburg nach/vers Haltingen/Kandern nach/vers Brombach (Lörrach) SBB-Linie nach/Ligne CFF vers Basel und Umgebung Zell im Wiesental Lörrach Lörrach Busbahnhof Hbf 1 0 Museum/ 6 3 1 Burghof Réseau des lignes 7 Tullastr. Weinbergstr. Stetten Bahnhof Mark- Stetten gräflerstr. Stetten Grenze Steingruben- Roten- Bâle et environs 6 Vitra Hungerbach- 1 graben /Zentrum weg halde f Riehen Grenze 32 Zoll Schusterinsel Friedhof Dreiländer- Riedlistr./ Weil am Rhein Lörracherstr. Ost brücke Kesselhaus BahnhoRathausMarktstr.Turmstr. Altes Rathaus Weilstr. Au Alte PostWeil Im Schlipf nach/vers Gare SNCF nach/vers 8 3 der Inzlinger Professeur Coste 604 Village-Neuf/ HohlwegHinterengeliIn Zoll 6 vers nach/vers Mulhouse Huningue 35 / h Tivoli 55 Platz Saint-Louis (Haut-Rhin) Berliner Läublin-park Église Ferrette Weil am Rhein Weber- Hinter Gärten Breisach Grenze Fondation nac Inzlingen Central gässchen St-Louis Carrefour Rhin 603 Kleinhüninger- Grün 99/Laguna Beyeler Gänshalden- de 3 / s anlage weg Haidweg / 2 e e Croisée des Lys N.D. de-la-Paix Gare Kleinhüningen Riehen 32 Frontière Soleil Otterbach Zoll Dorf Auf 45 Saint-Loui 3 DominikushausMoosrain Mulhous /Mulhous 6 Rücken l/ l 46 Schmiedgasse dem 3 Mohrhaldenstr. EuroAirport EuroAirport Stücki Otterbach Grenze Bettingerstr. Base Base Saint-Louis Grenze Freiburg Freiburg Inselstr. Wiesen- Dinkelbergstr. Abflug Cargo Bahnhof Ankunft platz Hochbergerstr. Zone10 Pfaffenloh Riehen Bahnhof 50 7 1 1 Bahnübergang Zone13 Zone14* 1 Burgstr. Ciba Schorenweg Chrischonaweg Place Hüningerstr. Lange Erlen Mühlestieg Bahnhof 6 Mermoz 3 Niederholzboden Verwaltung Basel St.Johann Lachenweg Friedrich St. Johann Novartis Campus Dreirosenbrücke Brombacherstr. Saint-Exupéry 1 14 Miescher-Str. 50 21 46 Habermatten Surinam Martinsrain Burgfelderhof Voltaplatz Musical Erlenmatt 5 32 Im Wasenboden Theater 42 3 Bläsiring 3 Morystr. -

International School Rheinfelden
INSIDE: YOUTH CHOIR FEST • STREET FOOD FEST • TEDX • SINFONIEORCHESTER BASEL • CITY SKATE • 3LÄNDERLAUF Volume 4 Issue 8 CHF 5 5 A Monthly Guide to Living in Basel May 2016 Circus is in the Air At academia we •Educate the whole individual: academically,socially, physically and emotionally •Nurturestudents to reach their full potential and pursue A cAsuAl excellence in everything they do ApproAch •Foster alove of learning and creativity to luxury •Develop compassionate global ambassadors •Emphasize team work and problem solving Preschool / Primary / Pre-College (K-8) •Bilingual Education (German/English) •Integrated Cambridge International Curriculum and Basel Stadt Curriculum College (9-12) AsK For A pErsoNAl AppoINtMENt. •High Quality Exam Preparation phoNE +41 79 352 42 12 · FrEIE strAssE 34, •Entry into Swiss and International Universities 4001 BAsEl · www. jANEtBArgEzI.coM Phone+41 61 260 20 80 www.academia-international.ch 2 Basel Life Magazine / www.basellife.com LETTER FROM THE EDITOR Dear Readers, The Basel Life team would like to thank you for taking the time to share your fabulous feedback over the years. It has always been a welcome confir May 2016 Volume 4 Issue 8 mation that we have succeeded in our goal of sharing our passion and knowledge of Basel with you. From its humble beginnings almost four TABLE OF CONTENTS years ago, Basel Life Magazine has always endeavored to provide its read ers with timely information on events and activities in and around Basel, cultural and historical background information on important Swiss/Basel Events in Basel: May 2016 4–7 traditions and customs, practical tips for everyday life, as well as a wealth of other information, all at the cost of the printed material. -

FEBRUAR 2020 Sand Hollow State Park, Utah, U.S.A
FEBRUAR 2020 Sand Hollow State Park, Utah, U.S.A. EDITORIAL Abo. Treffend ist, dass exakt in der Zeit Bei -10 ° C bilden sich von der Feuchtigkeit, die der See abgibt, an Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Feiertage Statistiken über die häu- den Pflanzen skurrile Eisgebilde. figste Todesursache in der Schweiz ver- In 11 Monaten ist Weihnachten. öffentlicht werden. Im Jahr 2017 starben Foto © Denise & Adrian Barth Aber vorher wollen wir uns über das neu immerhin 66‘971 Personen an Herz- begonnene 2020 freuen, ein gerades Kreislauf-Erkrankungen, was sich – wer Jahr, auch wenn der Februar wegen des hätte das gedacht – auf ungesunde Er- Schaltjahrs ungerade 29 Tage haben nährung und zu wenig Bewegung zu- wird. 2020 ist auch der Aufbruch in ein rückführen lässt. Natürlich nicht in allen neues Jahrzehnt, was uns beflügeln Fällen, jedoch ist es sicherlich nicht kann und uns zu neuen Ufern aufbre- falsch, die eigenen Gewohnheiten immer chen lässt. Glaubt man überdies der mal wieder zu überdenken. Unter Numerologie, dann ist es ein 4-er Jahr – www.witterswil.ch findet man unter Ge- denn 2+0+2+0=4. Und 4 ist eine stabile meinde – Vereine/Organisationen tolle Zahl, veranschaulicht durch einen Tisch Bewegungsangebote oder Ideen für ein mit 4 Beinen, die 4 Jahreszeiten oder ein neues Hobby. Wenn Sie nichts Passen- Die Sozialregion stellt sich vor Quadrat. des finden, gibt es aber keinen Grund zu verzagen: Die Lebenserwartung in der Nach der Schlemmerzeit der Festtage ist Schweiz hat zwischen 2007 und 2017 Mittwoch, 18. März um 19.30 Uhr der magere Januar nun schon Geschich- trotz allem um etwa 2 Jahre zugenom- Foyer des Oberstufenzentrums (OZL) in Bättwil te. -
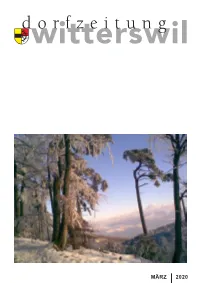
März 2020 Editorial
MÄRZ 2020 EDITORIAL Liebe Einwohnerinnen und Einwohner zweckhalle überhaupt so viele Stühle Platz hätten. Oder ob die Gemeinde In der Schweiz wird Demokratie gross überhaupt über so viele Stühle verfügt. geschrieben. Wir dürfen mitbestimmen. Und ob die 5 Gemeinderäte/innen im In keinem anderen Staat der Welt gibt es Gedränge der abstimmungslustigen auf nationaler Ebene auch nur annä- Wählerschaft überhaupt überleben wür- hernd so weit gehende direkte Volks- den. Und es bliebe auch die Frage zu Fasnachtsfüür 2020 rechte wie bei uns – und wir sind stolz klären, wie nach der Versammlung ein darauf. Die Stimmbeteiligung bei der Ab- gesitteter Gang zum gesponserten stimmung vom 9. Februar betrug im Apérobuffet aussehen würde. Einerko- Schweizer Mittel 41%. In Witterswil kön- lonnen? Nach Alphabet? Nach Alter? nen wir mit 41.5% also wacker mithalten. Wenn wir diesen Prozentsatz allerdings Seien wir froh, mit dieser Art von Prob- «Uff der Egg» Witterswil hochrechnen auf die Teilnahme und lemstellung vorderhand nicht konfrontiert Mitwirkung in den Gemeindeversamm- zu werden. Dennoch dürfte es gern ein lungen, würde man mit gut 392 Perso- wenig mehr sein: Anwesende und ein nen rechnen müssen – eine doch recht zusätzliches Gläschen Wein zum Apéro. SAMSTAG 29. Februar 2020 furchterregende Zahl. Man müsste bei- Franziska Fasolin Besammlung Fackelumzug 18:15 Uhr spielsweise abklären, ob in der Mehr- für das Redaktionsteam Abmarsch beim Rest. Pizzeria Landhuus 18:30 Uhr Impressum Herausgeber Einwohnergemeinde Witterswil, 4108 Witterswil GRATIS Fackeln für Kinder Redaktion Myrta Ziegler, Günter Bussar, Franziska Fasolin Familienfreundliche Preise Titelbild Jacques Andrey Verpflegungsmöglichkeit beim E-Mail [email protected] Fasnachtsfüür mit warmen & Website www.witterswil.ch (Dorfzeitung auch als PDF-Version abrufbar) kalten Getränken, Würste und den Auflage 695 Exemplare beliebten «Präsis Füürbrötli» sowie Erscheinen 11 x jährlich, monatlich ohne Juli Div. -

Liniennetz Basel Und Umgebung Réseau Des Lignes Bâle Et Environs
www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 50.000 Region Basel - Aargau - Olten (TNW/A-Welle) Liniennetz Basel und Umgebung Liniennetz DB nach/vers Haltingen/Freiburg nach/vers Haltingen/Kandern nach/vers Brombach (Lörrach) SBB-Linie nach/Ligne CFF vers Basel und Umgebung Zell im Wiesental Lörrach Lörrach Hbf Busbahnhof Museum/ 16 Réseau des lignes 7301 Burghof Tullastr. Weinbergstr. Stetten Bahnhof Mark- Stetten gräflerstr. Stetten Grenze Bâle et environs Vitra Steingruben-Hungerbach-Roten- 16 weg halde graben Riehen Grenze 32 Schusterinsel Friedhof Dreiländer- Riedlistr./ Weil am Rhein Lörracherstr. brücke Kesselhaus Bahnhof/ZentrumRathausMarktstr.Turmstr. Altes Rathaus Weilstr. Alte PostWeil OstIm Zoll Schlipf nach/vers Gare SNCF nach/vers 8 3 Inzlinger Professeur Coste 604 Village-Neuf/ HohlwegHinterengeliIn der Au Zoll 6 nach/vers Mulhouse Huningue 35 vers h/ Tivoli 55 Platz Saint-Louis (Haut-Rhin) Berliner Läublin-park Église Ferrette Weil am Rhein Weber- Hinter Gärten Breisach Grenze Fondation nac Inzlingen Central gässchen St-Louis Carrefour Rhin 603 Kleinhüninger- Grün 99/ Laguna Beyeler Gänshalden- anlage 3 weg Haidweg Croisée des Lys N.D. de-la-Paix 2 Gare de Kleinhüningen Riehen 32 Soleil Frontière Otterbach Zoll 45 36 Dorf Auf dem Saint-Louis DominikushausMoosrainRücken 46 Schmiedgasse 3 Mohrhaldenstr. EuroAirport EuroAirport Stücki Otterbach Grenze Bettingerstr. Basel/Mulhouse/ Basel/Mulhouse/ Saint-Louis Grenze Freiburg Freiburg Inselstr. Wiesen- Dinkelbergstr. Ankunft Abflug Cargo platz Hochbergerstr. Bahnhof 50 Zone 10 Pfaffenloh Riehen Bahnhof 17 Bahnübergang Zone 13 Zone 14 11 Burgstr. Ciba Schorenweg Chrischonaweg Place Hüningerstr. Lange Erlen Mühlestieg Bahnhof Signalstr. Mermoz Basel 36 Niederholzboden Verwaltung St.Johann Dreirosenbrücke Lachenweg Friedrich St. Johann Novartis Campus Brombacherstr. Saint-Exupéry 1 14 Miescher-Str. -

Finanzbericht 2019
Bericht der Revisionsstelle des Verein Sonnhalde Gempen, Gempen zur Jahresrechnung 2019 Bericht der Revisionsstelle an die Mitgliederversammlung des Verein Sonnhalde Gempen, Gempen Basel, 22. April 2020 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Verein Sonnhalde Gempen bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals, Kostenträger-Rechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr – mit Ausnahme der Kostenträger-Rechnung – geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle. Verantwortung des Vereinsvorstands Der Vereinsvorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften und den Stauten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines Internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vereinsvorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der Revisionsstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und -

Leitbild Gempen 2025
Liebe Leserin, lieber Leser Das neue Leitbild «Gempen 2010 –2025», das Sie in Händen halten, wurde im Auftrag des Gemeinderats von der Leitbildkommission in engagierter Zusammenarbeit mit den Einwohner- innen und Einwohnern von Gempen erarbeitet. Es soll ein Orientierungsangebot sein für Behörden, Parteien, Vereine, Institutionen, Ansässige und potentielle Neu-GempnerInnen. Was ist den GempnerInnen heute und in naher Zukunft wichtig? Wie soll unsere Gemeinde in 15 Jahren aussehen? Die Antworten auf diese Kernfragen waren die Grundlage für die in diesem Leitbild formulier ten Visionen. Da waren zum Beispiel die Primarschulkinder von Gempen, die sich mit Bildern, Texten und Gedichten beteiligt haben. Anregungen aus einem Wunschbuch und Zusendungen per Post und Mail sind ein gefl ossen; ebenso die Schlussfolgerungen aus dem offi ziellen Diskussionsa- bend, der grossen Anklang fand. Ganz wesentlich waren die Aussagen der Bevölkerung, die wir den beantworteten Fragebögen entnom men haben. Ein Drittel der Gempner Bevölkerung hat sich daran beteiligt. Die im folgenden aufgeführten Prozentzahlen und Grafi ken beziehen sich auf diese Fragebogen-Auswertungen. Das neue Leitbild schliesst sich an das erste Leitbild an, das 1995 formuliert wurde und ist entsprechend in dieselben Kapitel gegliedert. Der Gemeinderat Die Leitbildkommission Gempen, September 2011 Vorhandene Infrastruktur 2010 Fläche (in ha) Gesamt: 597 Arbeitgeber 39 gewerbliche Betriebe Landwirtschaftlich: 312 und Dienstleister Siedlungsfläche: 23 9 Landwirtschaftsbetriebe Wald, Gehölze: -

RVL Tarifzonenplan Mit TNW-Zonen 10 Und 40
nach Freiburg Notschrei nach nach Titisee Münstertal Muggen- Todtnauberg Feldberg brunn nach Freiburg Wiedener Eck 7 Fahl Belchen Branden- berg Todtnau Notschrei Multen Schlechtnau nach nach Titisee nach Münstertal Müllheim Utzenfeld Abzw.Präger Böden Todtnauberg Haldenhof 7 Geschwend Muggen- Feldberg brunn Neuenweg Präg Fachklinik nach nach nach Kandertal Freiburg Müllheim Müllheim Schönau Wiedener Eck Fahl 6 Bürchau 7 Wembach Schallsingen Marzell Belchen Branden- Mauchen 7 Hochkopfhaus Wies Raich berg Nieder- Todtnau eggenen Ehrsberg Multen Obereggenen 5 Schliengen 4 Sitzen- Schwand Schlechtnau Feuerbach kirch Liel Malsburg nach Mambach Abzw.Präger Adelsberg Müllheim Utzenfeld Hertingen Böden Bad Lehnacker Tegernau Atzenbach Haldenhof 7 Geschwend Bamlach Bellingen Riedlingen Kandern Sallneck Gresgen Zell im Gersbach Neuenweg Tannenkirch Wiesental Rheinweiler 5 6 Präg Welmlingen Schlächtenhaus Fachklinik RVL TarifzonenplanHolzen Hammerstein Wieslet nach nach nach Kandertal Enkenstein Hausen-Raitbach Freiburg Müllheim Müllheim Kleinkems Mappach Schönau Weitenau 6 6 Bürchau Wollbach Fahrnau Wembach Istein 4 Egringen Hägelberg Langenau Schallsingen Marzell Efringen- Wittlingen 7 Kirchen Mauchen Hochkopfhaus mit TNW-ZonenSchallbach 10 undSchlattholz 40 Raich 3 Hauingen Maulburg Hasel Wies Fischingen Rümmingen Nieder- Steinen Schopfheim Schopfheim Eimel- Richtung eggenen Ehrsberg West Wiechs dingen 1 Brombach/ Wehr Obereggenen 5 Binzen Hauingen Hüsingen Schliengen Märkt Tumringen Haagen/Messe 4 Sitzen- Schwand 3 Ötlingen Schwarzwaldstr. Feuerbach -

Reinach Missioni Cattoliche Di Lingua Italiana
PASTORALRAUM BIRSTAL Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach Liestal-Sissach-Oberdorf 4° Domenica di Pasqua miglie le più sentite condoglianze a nome Marek Sowulewski Le letture di questa quarta domenica di di tutta la Missione. Pasqua celebrano Gesù come il buon pa- Un piccolo barlume di sperenza store: il Signore risorto non è come gli L’aumento della somministrazione dei altri mercenari, che fingono di pascolare vaccini e le misure di confinamento por- il gregge ma lo derubano di gioia e spe- tano ragionevolmente con sé la speranza ranza. Egli ci dà l’esempio poiché per di un miglioramento della situazione. primo si è donato per il suo gregge. «In Speriamo di poter riprendere al più presto nessun altro c’è salvezza», ci dice Pietro una vita ecclesiale normale, magari con la nella prima lettura dal libro degli Atti: celebrazione dei battesimi e la pianifica- colui che doveva essere scartato, Dio lo zione di qualche matrimonio. La Chiesa ha risuscitato e lo ha rivelato come l’au- vive dei sacramenti, e riprendere a cele- tentico fondamento di tutto. In lui, il Ri- brarli non può che aumentare la grazia sorto, noi conosciamo il nostro compi- per tutta la comunità. mento, ci dice Giovanni nella seconda lettura. Egli ci rende figli di Dio e ci apre Prime comunioni Jugendanlass am Ostermorgen: «Bring den Stein ins Rollen». la strada verso la sua ultima manifesta- Il 25 aprile si celebrano nella parrocchia di zione nella gloria. La salvezza che viene Liestal le prime comunioni. Il Missionario Der unglaubliche Sisyphos da Dio è gratuita, non è imposta o frutto sarà presente nella seconda delle due cele- di costrizione. -

Hofstetten–Flüh Aktuell Hofste
P.P. CH-4114 Post CH AG Hofstetten PP 4114 Hofstetten Agenda JanuarMai / Juni / Februar 2018 2016 02/201606/2018 28.26.01. Grunzerli-Vorverkauf Häckseln Hofstetten im Mammut Hofstetten–Flüh aktuell 30.27. FG: Eröffnung Besuch im Vernetzungspfad Spielzeugwelten-Museum bei «Nideri Weid», Metzerlen 31. Errichtungsfeier Pastoralraum Sol. Leimental in Mariastein 02.06. Gwunder Schmiede: 5 Elemente Sommer Kochkurs 03.31. Finissage Kulturwerkstatt Ausstellung Ausstellung: Marlies Externbrink «Kartoffel» im APH Flühbach 06./20.03.02. Ludopoly Chumm im und Rest. lueg Kehlengrabenschlucht 07.04./05. Grunzerli SP: Jahresversammlung im Mammut Rest. Belvedere, Hofstetten 08.07. Kulturwerkstatt: MittagsTreff Ausstellungim Rest. Kreuz – Sauerkraut Belvedere, wird Hofstetten gratis abgegeben 09. Sportclub Soleita: Schaulaufen «10 Jahre Best Of» 07.-09. HOFA 09./10. Eidgenössisches Feldschiessen GSA Schürfeld, Aesch 10.10./24. Chumm Eidgenössische und lueg Volksabstimmung 12. MittagsTreff Beratung im Pro Rest. Senectute, Kehlengrabenschlucht Bättwil 16.13. Fasnachtsfüür Ferienpass-Ausgabe im OZL 16.14. Ökumenische Schützen Gesellschaft: Kirche: Gottesdienst Obligatorische mit Narrenpredigt Bundesübung 16.18. Altpapiersammlung JASOL: Oldie-Night 17. Ökumenischer Sonntag in Flüh 21. Ökumenischer Sonntag in Flüh 18. Häckseln Flüh 19.23. Ökumenische Ökumenische Kirche: Wegbegleitung, Stille Zeit Information im Pfarreiheim 20./27.23. FG: Fussball Osterhasen WM-Übertragung Filzen im «chrüz & quer» 21.24. SVP Altpapier Kreispartei + Karton Leimental, öffentliche GV 21.25. Natur- SVP und Kreispartei: Vogelschutzverein: Referat Roger Nacht derKöppel Eulen in Gempen 21.-23.26. Galerie 750 JahreJetztOderNie: Witterswil: Vernissage Das Fest im Dorf 22. MVH: Wurst- und Brotfest bei der Schreinerei, Flühstrasse 28. Abstimmungs-Sonntag 22./23. MUSOL: Der Drachenstreich, Mehrzweckhalle Witterswil 23.28. Ludothek: Metallsammlung: Jubiläumsfest Parkplatz Schulhaus, Hofstetten 24.29. -

Eröffnungsfest Bushof «Herrenmatt» in Seewen Samstag, 13. Dezember 2014
Eröffnungsfest Bushof «Herrenmatt» in Seewen Samstag, 13. Dezember 2014 Feiern Sie mit uns den neuen Bushof «Herrenmatt»! Vergessen Sie für einen Moment die vorweihnachtliche Hektik und kommen Sie an unser Eröffnungsfest. Dieser Anlass ist eine gute Gelegenheit, den neuen Bushof in Seewen kennenzulernen und sich vor Ort über das Fahrplanan gebot zu informieren. Gemeindepräsident Philippe Weber, Regierungsrat Roland Fürst und der PostAutoLeiter Region Nordschweiz Roman Cueni heissen sie herzlich willkommen und werden ein paar Worte zu diesem neuen Knotenpunkt an Sie richten. Danach haben Sie Zeit, sich in aller Ruhe auf dem neu gestalteten Bushof «Herrenmatt» umzuschauen. Geniessen Sie dazu den von uns offerierten Imbiss und nehmen Sie an unserem Wettbewerb teil. Für einen stimmungs vollen musikalischen Rahmen sorgt die Brass Band Seewen. Unsere kleinen Gäste haben die Möglichkeit, sich in der betreuten Kinder ecke mit verschie denen Weihnachtsbasteleien zu vergnügen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Programm in Kürze 10.30 Eröffnung Festgelände und Willkommensgetränk 11.00 Musikalischer Auftakt mit der Brass Band Seewen Offizielle Eröffnung des Bushofes «Herrenmatt»: Ansprache Philippe Weber, Gemeindepräsident Seewen Ansprache Roland Fürst, Regierungsrat Kanton Solothurn Ansprache Roman Cueni, Leiter PostAuto Region Nordschweiz Anschliessend: Musikalisches Rahmenprogramm mit der Brass Band Seewen 11.45 GratisImbiss und Getränke Wettbewerb Betreutes Kinderprogramm (Kibu Seewen) ab 10.30 Uhr. Dorneckberg PRATTELN Liestal 83 Bahnhof BASEL OLTEN Oris Burg BASEL Zeughaus Eglisacker Neunuglar Dornach- Orismühle Kinderheim Arlesheim Auf Berg Bahnhof Gwändweg 72 Kirche Neumatt Seltisberg Gemeinde- Gempen Nuglar zentrum Museumsplatz Dorf Dorfplatz 111 Jugendmusikschule Alte Post Sonnhalde Schulhaus Schiessstand St. Pantaleonstr. Schützenhaus bei den Tannen Degenmatt St. -

Hiag-Annual-Report-2019.Pdf
Annual Report 2019 Annual Report HIAG creates value and develops destinations where people and companies can flourish. HIAG Annual Report 2019 Seite 2 Content 4 Company Profile 5 Key Facts in a Nutshell Key Figures 8 Letter to the Shareholders 12 Executive Board Interview 19 Corporate Governance 41 Compensation Report 51 Report of the Statutory Auditor on the Remuneration Report 52 Consolidated Financial Statements 98 General Property Details 100 Report of the Statutory Auditor on the Consolidated Financial Statements 104 Independent Valuer’s Report 108 EPRA Key Performance Figures 111 Individual Financial Statement 2019 121 Report of the Statutory Auditor with Financial Statements 124 Share Information 126 Contact / Agenda / Credits HIAG Annual Report 2019 Seite 3 Company Profile HIAG’s site portfolio in Switzerland encompasses large land development reserves. Each site is transformed independently and progressively into a new cycle of use, creating lively quarters or entire city districts with their own individual character. HIAG is thus able to make profitable long-term investments in site redevelopment. The creation of new destinations generates intangible value, such as location quality and perceived attractiveness, which translate into an increase in property value and potential added value for customers. HIAG Annual Report 2019 Seite 4 Key Facts in a Nutshell Key Figures 8 7 H 6 G 1 A F 5 E D B 4 C 2 3 according to use according to canton Market value of real estate properties Market value of real estate properties by type of use as at 31.12.2019 by canton as at 31.12.2019 1 Industry, Commercial 34.6% A Zurich 26.3% 2 Residential 12.7% B Aargau 23.6% 3 Building land 12.3% C Geneva 14.6% 4 Distribution, Logistics 10.7% D Zug 7.5% 5 Office 10.7% E Solothurn 7.4% 6 Retail 10.6% F Basel-Landschaft 7.1% 7 Residential and commercial 5.6% G St.