Barock Blick in Das 17
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Flyer Eppinger Linien – Rundweg Sulzfeld-Kürnbach-Zaberfeld
Der Eppinger Linien-Weg zwischen Eppingen und Mühlacker wurde Die Eppinger Linien als Wanderweg entlang der unter dem Türkenlouis 1695 errichteten Verteidigungsanlage angelegt und mit Informationstafeln versehen. Wirksame Verteidigungsanlage – beachtenswertes Bodendenkmal Der Wanderweg führt durch abwechslungsreiches Gebiet mit reiz- Die Tochter Karl Ludwigs von der Pfalz, Lieselotte, heiratete den vollen Ausblicken über den Kraichgau und kulturellen Highlights wie Gemeindeverwaltung Sulzfeld Bruder Ludwigs XIV. von Frankreich, den Herzog von Orleans. Mit dem Kloster Maulbronn. Tel: 07269/780 · www.sulzfeld.de dem Tod von Lieselottes Bruder Karl im Jahr 1865 erhob Frankreich Das Kriegsgeschehen rund um den Bau der Eppinger Linien, insbe- Anspruch auf Teile der Pfalz, obwohl ein solcher Anspruch durch sondere die Zerstörung ganzer Landstriche am Oberrhein im 17. und Ehevertrag ausgeschlossen war. 18. Jahrhundert prägte die Region durch jahrzehntelange Kriegshand- 1688 fi elen französische Truppen im Südwesten Deutschlands ein. lungen, Devastationen, Hungersnöte und bäuerliche Armut – ganz im Rundweg Sulzfeld - Kürnbach - Zaberfeld 1689 erging der Befehl zur Zerstörung der Pfalz. Mannheim, Kontrast zum Prunk der barocken höfi schen Gesellschaft. Heidelberg, Speyer, Worms, Sinsheim, Bretten, Heidelsheim und Die historischen Geschehnisse in der Region können - zumindest am künstlerisch-historischen Wanderweg Bruchsal wurden neben vielen Dörfern niedergebrannt. Diese Po- aus europäischer Sicht - als weltgeschichtliche Ereignisse gelten: Ge- Eppinger -
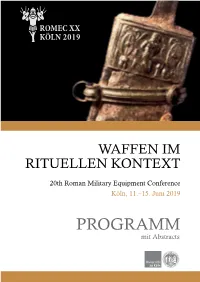
PROGRAMM Mit Abstracts
WAFFEN IM RITUELLEN KONTEXT 20th Roman Military Equipment Conference Köln, 11.–15. Juni 2019 PROGRAMM mit Abstracts ROMEC XX – KÖLN 2019 WAFFEN IM RITUELLEN KONTEXT Programm der 20. Internationalen Konferenz für Römische Militärausrüstung Köln, 11.–15. Juni 2019 WEAPONS IN RITUAL CONTEXT Programme of the 20th Roman Military Equipment Conference Cologne, June 11th–15th 2019 PATRONAGE KOOPERATIONSPARTNER INHALTSVERZEICHNIS Willkommen zur ROMEC XX ........................................................ 6 Geschichte der Roman Military Equipment Conference ........................ 8 Congresses so far .............................................................................. 10 Karten ......................................................................................... 12 Köln ................................................................... 12 Köln Campus ................................................................... 13 Köln Schienennetz ................................................................... 14 Bonn ................................................................... 15 Trier ................................................................... 16 Programmübersicht ................................................................... 18 Programm ......................................................................................... 22 Montag, 10. Juni 2019 ........................................................ 24 Dienstag, 11. Juni 2019 ........................................................ 25 Mittwoch, 12. Juni -

Burgenlandschaft Rhein-Lahn Rhein-Lahn
Burg Nassau B2 Talburg Schloß Langenau C2Kloster Arnstein (ehem. Burg) C2 Burgruine Laurenburg C1 Burgruine Balduinstein C1 Schloss Schaumburg C1 Nassau Obernhof Obernhof Laurenburg Balduinstein Balduinstein Die Wiege des niederländischen Königshauses Gaumenfreuden und lebendige Geschichte am Eingang zum Gelbachtal Postkartenmotiv: Wallfahrtsort in atemberaubender Lahnlandschaft Kleines Militärmuseum lädt zur Zeitreise im trutzigen Bergfried Malerische Mauerreste vor idyllischer Kulisse Ganz von „Zinnen“: Das „Neuschwanstein“ an der Lahn Burgenlandschaft Burgenlandschaft Rhein-Lahn Rhein-Lahn Burgen, Schlösser und Ruinen im Rhein-Lahn-Kreis Machen Sie eine Fahrt durch die 01 02 03 04 05 06 Sie sind die steinernen Zeugen einer alten Kultur landschaft: Burgen Vergangenheit einer Region und Schlösser zwischen Rhein und Lahn. Ob in kostbaren Räumen oder kargen Ruinen – hier werden Geschichte und Geschichten lebendig. mit Zukunft. Burg Lahneck A2 ABCD Grafenschloss Diez D1 Nicht nur die hohe Zahl von rund 40 Objekten ist eine Besonderheit Besuchen Sie Burgen, des Rhein-Lahn-Kreises. Es finden sich unter ihnen auch einige der Lahnstein Diez deutschlandweit be deutendsten Burgen – wie die Marksburg als ein- Schlösser und Ruinen und Templer, Goethes Geistesgruß, Geisterstunden und Kerzenführungen Jugendherberge in mächtigen Mauern zige unzerstörte Höhenburg am Rhein – und charakteristischsten BurgenlandschaftBurgenlandschaft Rhein-LahnRhein-Lahn Baudenkmäler – wie den Pfalzgrafenstein als mittelalterliches Zollamt erleben Sie die Vielfalt mitten im Rheinstrom. 08 eines Landkreises, Die vorliegende Karte gibt in Beschreibungen und Bildern einen umfassenden Überblick über den kulturgeschichtlichen Reichtum der der Lust auf mehr macht. „Burgenlandschaft“ Rhein-Lahn. 1 07 1 Wir danken dem Europäischen Burgeninstitut mit Sitz in Braubach für wissenschaftlich verlässliche Angaben zur historischen Überlieferung und zur Bausubstanz, die in die Texte Eingang gefunden haben. -

Electric Scotland's Weekly Newsletter for March 15Th, 2019
Electric Scotland's Weekly Newsletter for March 15th, 2019 For the latest news from Scotland see our ScotNews feed at: https://electricscotland.com/scotnews.htm Electric Scotland News National Trust for Scotland Foundation USA announced today that the recipient of its 2019 Great Scot Award is Andy Scott, award- winning sculptor of The Kelpies and renowned artworks across the UK and internationally. The award will be presented to Mr. Scott at the Foundation’s annual fundraising gala, A Celebration of Scotland’s Treasures, on April 11, 2019, at the Metropolitan Club in New York City. Under the guidance of co-chairs Alan Cumming and Grant Shaffer, Christopher Forbes, Joan Kahn, and Susi and Alasdair Nichol, the black-tie evening will raise funds to support the conservation of the natural, built, and cultural treasures cared for by the National Trust for Scotland. The highlight of the evening is the presentation of the Great Scot Award. The award is presented annually to a Scot or American who has contributed to the countries’ shared heritage. Past recipients include endurance athlete and world-record breaking cyclist Mark Beaumont, documentary filmmaker Ken Burns, comedian Sir Billy Connolly, actors Alan Cumming and Phyllis Logan, and author Alexander McCall Smith. “We are absolutely delighted to honor sculptor Andy Scott as our Great Scot this year,” said Charlotte Lyeth Burton, chair of the board of The National Trust for Scotland Foundation USA. “Andy’s work in Scotland and the US is rooted in the past and looks forward to the future, marking the same connections across time and place that are at the heart of our Foundation’s work.” Andy Scott works in steel and bronze, combining figurative and equine themes with contemporary techniques to create stunning landmark artworks. -

The Fortifications of Magdeburg
210 5.2 210 297 A contribution to the Monument Preservation Plan THE FORTIFICATIONS OF MAGDEBURG The building and subterranean passage of Zwischenwerk IVa (built in 1890) in the Harsdorfer Strasse, used by Magdeburg’s Landegard e.V. association from 1922 on (so-called “Fort Landegard”, which included a children’s home, a garden, and a home economy school), when another story was added to the casemate, transformed into a Waldschule (forest school) in 1925, converted into a recuperation home for women suffering from tuberculosis in 1930, and presently used by the Öko-Zentrum und Institut Magdeburg Sachsen-Anhalt e.V. - ÖZIM 108 2020 3 A contribution text to the Monument Preservation Plan THE FORTIFICATIONS OF MAGDEBURG Published by Stadtplanungsamt Magdeburg Text by Sabine Ullrich, cultcontext based on Monument Preservation Plan: The Fortifications of Magdeburg, compiled by Katja Trippler with the kind assistance of Dr. Bernhard Mai Photographs by Jill Luise Muessig and Hans-Wulf Kunze Front Cover The covered way of the counterscarp casemate in Ravelin II 4 CONTENTS :: CONTENTS View behind the crenellated wall in front of the Lukasklause, the canon is a replica of an original from 1669 in the Deutsches Historisches Museum in Berlin 5 CONTENTS :: CONTENTS CONTENTS PREFACES ...................................................................................................... 7 1. INTRODUCTION Magdeburg: the quintessential fortress city .............................................. 11 2. MONUMENT PRESERVATION PLAN Analysis – Information – -

The War of the Polish Succession
University of Kentucky UKnowledge European History History 1980 The King's Honor and the King's Cardinal: The War of the Polish Succession John L. Sutton University of Pittsburgh - Johnstown Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Sutton, John L., "The King's Honor and the King's Cardinal: The War of the Polish Succession" (1980). European History. 23. https://uknowledge.uky.edu/upk_european_history/23 The King's Honor & the King's Cardinal The War of the Polish Succession John L. Sutton THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY To JACK E. FREEMAN Soldier, scholar, administrator Library of Congress Cataloging in Publication Data Sutton, John L 1917- The King's honor and the king's Cardinal. Bibliography: p. Includes index. 1. Polish Succession, War of, 1733-1738. I. Title. DK4326.5.S95 943.8'02 80-51021 ISBN: 978-0-8131-5501-2 Copyright© 1980 by The University Press of Kentucky Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Club, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. Editorial and Sales Offices: Lexington, Kentucky 40506 CONTENTS Preface v 1. -

Billboard 1974-03-30
IVSIVSPAFER 08120 TWO SECTIONS, SECTION ONE MARCH 30, 1974 $1.25 A BILLBOARD PUBLICATION EIGHTIETH YEAR The International Music- Record Tape Newsweekly TAPE /AUDIO /VIDEO PAGE 56 HOT 100 PAGE 108 TOP LP'S PAGES 110, 112 All-Star U.S. Line -Up Sooner Group NARM Meet to Be To Participate at IMIC Wins Senate Biggest; Retailer NEW YORK -An impressive ar- can Society of Composers, Authors ray of U.S. music- record industry & Publishers, will discuss the U.S. li- Piracy Bill OK leaders will participate in the fifth censing organization's newly -con- Attendance Rises International Music Industry Con- ceived "ASCAP Think Tank." By JOHN SIPPEL By IS HOROWITZ ference, to be held at the Grosvenor Ed Cramer, president, Broadcast OKLAHOMA CITY dedi- -A HOLLYWOOD, Fla.- Advance estimated 65 percent of attendees. House, London, May 7 -10. IMIC is Music, Inc., will deliver a report on cated campaign by a handful of state contingents of industry executives All major manufacturers were due held under the auspices of the "The U.S. Copyright Act Revision - supporters of the antipiracy propos- representing every facet of the to be represented as well. worldwide Billboard Publishing An Update." al. seemingly delayed a year before record and tape marketing spectrum Total attendance was expected to Group (Billboard, High Fidelity, Bobby Brenner, Bobby Brenner consideration by the state legislature began arriving here late last week to top 1,400 at the series of meetings Music Labo, Music Week). Associates, will serve as chairman of (Billboard, Mar. 23), brought pas- participate in what was shaping up scheduled to run at the Diplomat Stanley Adams, president, Ameri- the seminar devoted to "Sound Tal- sage of the proposal last week by the as the largest and perhaps most pro- (Continued on page /3) ent Management." Seymour Heller, Senate here. -

The Dialect of Cumberland
— — 34 GLOSSARY OF THE Dess. va. To build or pile up, as applied to stacks, &c. Old Norse des, a rick, hey-des, a rick of hay, Welsh das, Gael. dais, heap, rick, stack. Deylt. adj. Moped, dispirited, impaired in mind. Old Norse duali, Dan. dvale, a trance, state of torpidity, Old Germ, tw'elan, to be torpid. Hence dwalm or dwam, swoon, suspension of the senses. Dibble, vn. To plant seed. " Sometimes applied to burying a corpse." Dick. "The syllable dib, expressing the act of striking with a sharp instrument, is a modification of Sco. dab, to prick, Bohem. dubati, to peck, Eng. job, to thrust or peck, parallel with dag or dig, to strike with a pointed instru- ment." — Wedg. Dike. sb. A hedge. Also a ditch, but rather a dry- ditch. This double sense occurs also in the Dut. dijck, both agger and fovea, [Kit.), and in the Dan. dige, ditch and bank. So also Ang.-Sax. die, Suio-Goth. dike, ditch and bank. This, observes Ihre, is naturally to be accounted for, as the same earth which is taken out of the ditch, serves to make the mound. The root, if it be the same as that found in Sansc. dih, to heap up, would seem to make it appear that the original sense was that of the bank or hedge. Dill. va. To soothe. Old Norse dilla, to lull, as a nurse does a child. Ditt. va. To stop up. Ang.-Sax. dyttan, Old Norse ditto,, to close, to stop up. Dobby. sb. A hobgoblin. -

Memory of the Third Reich in Hitler Youth Memoirs
Memory of the Third Reich in Hitler Youth Memoirs Tiia Sahrakorpi A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of University College London. Department of German University College London August 21, 2018 2 3 I, Tiia Sahrakorpi, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the work. Abstract This thesis examines how the Hitler Youth generation represented their pasts in mem- oirs written in West Germany, post-unification Germany, and North America. Its aim is two-fold: to scrutinise the under-examined source base of memoirs and to demonstrate how representations of childhood, adolescence and maturation are integral to recon- structing memory of the Nazi past. It introduces the term ‘collected memoryscape’ to encapsulate the more nebulous multi-dimensional collective memory. Historical and literary theories nuance the reading of autobiography and memoirs as ego-documents, forming a new methodological basis for historians to consider. The Hitler Youth generation is defined as those individuals born between 1925 and 1933 in Germany, who spent the majority of their formative years under Nazi educa- tional and cultural polices. The study compares published and unpublished memoirs, along with German and English-language memoirs, to examine constructions of per- sonal and historical events. Some traumas, such as rapes, have only just resurfaced publicly – despite their inclusion in private memoirs since the 1940s. While on a pub- lic level West Germans underwent Vergangenheitsbewältigung (coming to terms with the past), these memoirs illustrate that, in the post-war period, private and generational memory reinterpretation continued in multitudinous ways. -
Argument Structure and Morphology: the Case of En- Prefixation in English and Catalan
Argument Structure and Morphology: the Case of en- Prefixation in English and Catalan Susanna Padrosa Trias Supervisors: Dr. Montserrat Capdevila Batet Dr. Jaume Mateu Fontanals A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS established by the Escola de Doctorat i Formació Continuada Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Filologia Anglesa i Germanística September 2005 Acknowledgements My first debt is to my supervisors Montse Capdevila Batet i Jaume Mateu Fontanals. I would like to thank them for their guidance, advice and valuable criticisms. I also wish to thank Jaume Mateu for proofreading my work. Thanks also to Mireia Llinàs i Grau and Maria Josep Solé who read the proposal and provided comments and criticisms that resulted in some changes. Special thanks to Generalitat de Catalunya for giving me the opportunity to start working on the topic of this dissertation at University College London and continue it at Universitat Autònoma de Barcelona by providing me with the Beca Batista Roca i Beca Predoctoral de Formació d’Investigadors that partially funded this dissertation. My stay at UCL greatly benefited me. I owe special thanks to Ad Neeleman from the Department of Phonetics and Linguistics of UCL whose interest in and enthusiasm for morphology decided the topic of this thesis. I am also grateful to him for his guidance and valuable criticisms in the first stages of this study. All my subjects also deserve a special mention for their invaluable judgments. My results (from the dictionaries) could not have been corroborated without them. Some material of this work has been presented at the CamLing 2004 conference and at the 2005 BIDE Student Conference in Linguistics. -

Extracts Relating to the Zulu War of 1879
EXTRACTS RELATING TO THE ZULU WAR OF 1879 From THE GRAPHIC, AN ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER, JANUARY TO DECEMBER 1879 EDITOR’S NOTE The extracts in the following pages were made during 2003/4 from my complete collection of original editions of The Graphic, covering the period January to December 1879. Care has been taken to extract every reference having a bearing, directly or indirectly, on the Zulu War. The spelling of personal and place names is the same as used in the original, but there has also been a very wide variety of general spellings, from various journalists. So, for the purpose of clarification of place names, a list of their modern equivalent is set out below. By way of an appendix I have included a treatise on The Zulu Army compiled in 1879 by direction of Lord Chelmsford. A copy of which was made available to me by courtesy of the Durban Municipal Library. It is hoped that a further file of The Graphic pictures can be added to this section in due course. Copyright Debinair Publishing 2005. Permission to use the following material can be obtained from; Debinair Publishing Ltd Sportsman Farm Man of Kent Lane High Halden Kent. TN30 6SY 1 The Graphic; Jan. 4 1879: P.18 In SOUTH AFRICA Cetywayo maintains his sulky attitude, committing himself definitively to neither peace nor war, but it is generally thought that the outbreak of hostilities is only a question of time. The Graphic; Jan. 11, 1879; P.34 Under Foreign – Miscellaneous. In SOUTH AFRICA the preparation for war with the Zulu King Cetywayo continues, though nothing definite has been decided upon. -

Die Kurbayerische Defensionslinie Von 1702 Bei Schönbrunn, Zandt Und Winden
Die kurbayerische Defensionslinie von 1702 bei Schönbrunn, Zandt und Winden © Dr. Werner Robl, Berching, Januar 2016 Ein Blick zurück in die Geschichte Mit dem Überfall auf die Reichsstädte Ulm, Memmingen, Lauingen und Dillingen im Herbst 1702 trat das Kurfürstentum Bayern unter dem wittelsbachischen Kurfürsten Maximilian II. Emanuel, kurz Max Emanu- el, aktiv in den Spanischen Erbfolgekrieg von 1701 bis 1714 ein. Vorausgegangen war ein jahrelanges Lavieren des Landesherrn auf dem diplomatischen Parkett, mit dem er durch gegenseitiges Ausverhandeln der Großmächte Österreich und Frankreich ver- suchte, seiner Familie eine Rangerhöhung und seinem Land die territoriale Aufwertung zum Königreich zu verschaffen. Als sich seine begründete Hoffnung, über seinen Sohn Joseph Ferdinand die frei gewordene spani- sche Königskrone zu erlangen, mit dessen plötzlichem Tod zerschlug, geriet das öster- reichische Kaiserhaus in den Verdacht, dabei etwas nachgeholfen zu haben. Deshalb ging Kurfürst Maximilian II. Emanuel, Gemälde Max Emanuel schließlich bei großzügigen von 1710, Ausschnitt. Zugeständnissen des französischen Königs Ludwigs XIV. ein Bündnis mit Frankreich ein - wohl wissend, dass dies kurzfristig zum Aufrüsten und zum Krieg an mehreren Fronten führen würde. König Ludwig XIV. hatte inzwischen die spanische Krone für seinen Enkel Philipp von Anjou beansprucht, was ihm von den österreichischen Habsburgern unter Kaiser Leo- pold I. streitig gemacht wurde. Für die Mithilfe bei der Durchsetzung der französischen Interessen bot Ludwig XIV. im Gegenzug Kurbayern militärischen Beistand gegen Österreich an und stellte Max Emanuel die Königskrone von Bayern in Aussicht. So stand am Ende die neue Allianz zwischen Frankreich, Savoyen, Kurbayern und Kurköln gegen das Erzherzogtum Österreich, das sich mit den reichsfreien Ständen von Preußen, Sachsen, Schwaben und Franken und den ausländischen Mächten England und Nieder- lande verbündet hatte.